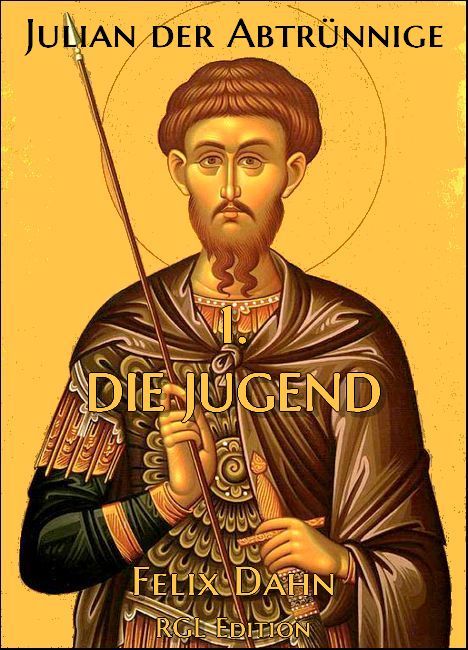
RGL e-Book Cover©
Based on an antique icon
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
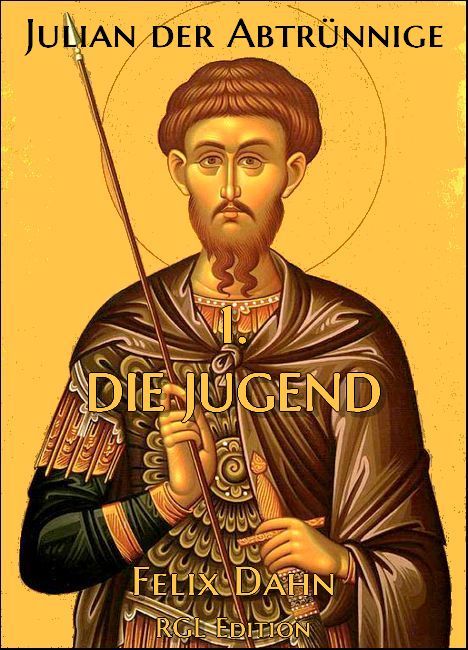
RGL e-Book Cover©
Based on an antique icon
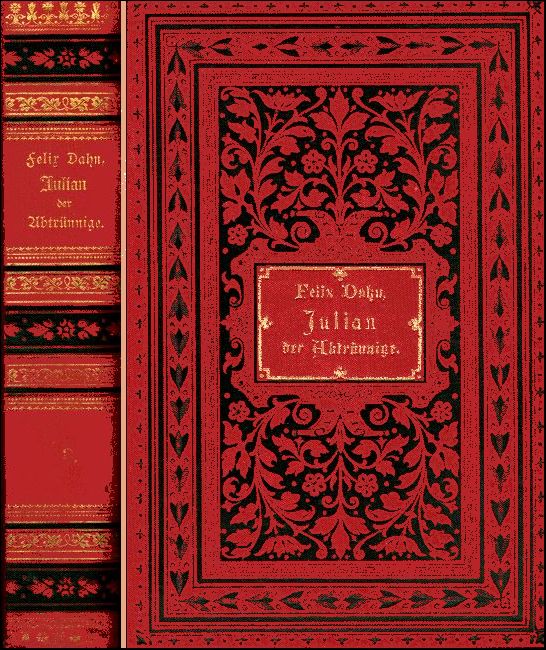
Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1893
»Wenn es, wie die Gelehrten sagen, vier Tugenden gibt: Mäßigkeit,
Weisheit, Gerechtigkeit und Tapferkeit, so hat Julianus sie alle geübt.«
Ammianus Marcellinus (Augenzeuge), XXV. 4.

Julian. An ancient Roman sculpture.
In den Vorgemächern des Kaiserpalastes zu Nikomedia in der Provinz Pontus in Kleinasien drängte sich in später Stunde einer Frühlingsnacht — es war der zweiundzwanzigste Mai des Jahres dreihundertsiebenunddreißig nach Christi Geburt — bei dem trüben Licht duftender Öllampen eine gespannte, teils bange, teils hoffnungsgierige Schar: Bischöfe, Feldherren, Staatsmänner, Höflinge.
Manchmal traten Ärzte, Freigelassene, Sklaven aus dem durch mehrfache Vorhänge abgetrennten Innenraum, hastigen Fragen selten Beachtung, seltener Antwort gebend, aus dem Palast eilend mit allerlei Aufträgen, unerhörte Arzneimittel zu holen, zu bereiten.
»Es geht rasch zu Ende«, flüsterte, nach der Ausgangstüre laufend, einer der Heilkünstler. »Nahm er die Taufe?« forschte ein Bischof. Aber jener war schon vor der Türe.
Gleich darauf aus dem Krankenzimmer schrilles Geschrei: aber nicht der Trauer, nicht Totenklage. »Tot ist der Imperator, der große Constantinus. Heil, Heil und Sieg dem neuen Imperator, Constantius, dem Herrn der Erde.« Bei dem Rufe warfen sich alle in dem Vorzimmer Versammelten nieder auf das Antlitz.
Alsbald erschien der Vorsteher des heiligen Schlafgemaches, der Präpositus sacri Cubiculi, und winkte mit erhobener Hand: »Hinweg!« Sie verschwanden in Eile.
Nach einiger Zeit trat aus dem Sterbegemach ein junger Mann in Purpurgewändern, aschfahl von Antlitz, von rastlos unstetem Blick der tiefliegenden schwarzen Augen; er zitterte vor Aufregung; sein Schritt wankte, er stützte sich schwer auf einen langen goldenen Stab: es war der Stab der Weltbeherrschung; er hatte ihn eben aufgenommen. Das Haupt hing auf die Brust, die schmalen vorgebeugten Schultern schienen die Wucht der neuen Würde nicht tragen zu können; er sah starr vor sich nieder auf den Marmorestrich.
Ein Kriegstribun, in vollen Waffen gerüstet, war der erste, der ihm aus dem Innengemach folgte: er hielt eine Papyrusrolle in der Hand. Gleich hinter ihm wandelte der Bischof der Stadt bedachtsamen Schrittes in das Vorzimmer. »Bleibt es dabei, o Imperator?« fragte mit leisem Grauen der Gepanzerte.
Constantius sah nicht auf. »Hab ich's zurückgenommen?« fragte er entgegen; scheinbar ruhig, aber seine Lippe zuckte. Er sah zweifelnd zu dem Präpositus hinüber, aber dieser hob warnend, fast drohend den Finger.
»Herr, die Liste ist lang!« sprach der Kriegsmann. »Deine drei Oheime? Also alle Brüder deines eben verewigten Vaters, darunter auch der Patricius Julius, dein eigner Schwiegervater, der Vater deiner verstorbenen Gemahlin? Und deine Vettern, alle sieben? Sind zehn! Alle deine Verwandten? Sonder Ausnahme? Sie sind ...« — »Feinde des Imperators«, unterbrach dieser. »Und der heiligen Kirche«, fiel der Bischof vortretend ein. »Heimlich heidnisch oder, was noch schlimmer, ketzerisch gesonnen im Herzen. Hilf doch, Eusebius!« Da schritt der Präpositus in seinem goldstrotzenden Gewande dicht an den Tribun heran und herrschte ihm mit heiserer Stimme zu: »Kann ein Krieger nicht mehr gehorchen?« — »Auch die Frauen, die Mädchen?« — »Alle, die noch heiraten können«, nickte der Imperator. »Sie sind so gefährlich wie die Männer.« — »Oft rachsüchtiger und schlauer!« ergänzte Eusebius. Er war der oberste Eunuch des Palastes.
»Hier stehen aber auch drei Kinder! Auch die? Deine beiden jungen Neffen? Deine kleine Nichte?« — »Was fragst du?« knirschte der Augustus, mit dem Fuß aufstampfend. »Alle, die mir jetzt oder künftig schaden können. Soll ich die Rächer heranwachsen lassen?«
Gleich darauf krachten die Haustüren gar mancher Paläste zu Nikomedia von außen nach innen: Waffenklirren — roter Schein von Pechfackeln — Lärm — Widerspruch, hier und da Widerstand der Haussklaven — gleich darauf Wehgeschrei von Sterbenden.
In das Haus des Patricius Julius, des einen Bruders des eben Verstorbenen, drang ein Centurio mit einer Schar von blonden barbarischen Söldnern. Der Hausherr selbst trat ihnen im Atrium rasch mit teilnahmsvoller Sorge entgegen.
»Wie steht's mit unserem Herrscher, meinem Bruder?« — »Das frag ihn selbst im Hades! Oder vielleicht im Himmel der Christen!« schrie der Centurio. »Mich sendet der neue Herr: dein Neffe Constantius, der schickt dir — durch mich — dies!« Er stieß ihn nieder; das kurze Römerschwert durchdrang die linken Rippen und fuhr im Rücken heraus. »Wo ist die Frau?« schrie der Wilde. »Wo das Mädchen?«
»Hier, Mörder!« rief eine ausnehmend schöne Frau von etwa vierzig Jahren, die ein kleines Mädchen an der Hand führte. »Laß uns mit ihm sterben!«
Der Legionär zückte das breite Schwert gegen sie; dabei sah er ihr in das Antlitz: so wunderbar schön waren diese Augen — er senkte erschüttert für eine kurze Weile die Waffe, die vom Blute des Mannes troff.
Der wand sich sterbend und stöhnte noch einmal. Da vergingen der Gattin die Sinne; bewußtlos sank sie auf ihr Antlitz über der Leiche zusammen. Laut weinte und schrie das geängstigte Kind.
Mit dem Fuß schob der Centurio die Ohnmächtige zur Seite und holte noch einmal aus, sie vom Rücken zu durchbohren.
Da stürzten aus einem der Schlafräume zur Rechten zwei seiner Söldner hastig zurück: »Mach, daß du fortkommst«, schrie der erste verstört, faßte ihn am Arm und drängte ihn gegen die Ausgangstür. »Seid ihr fertig?« fragte er. »Was ist euch? Wo sind die Köpfe? Zwei Knaben: Gallus heißt der eine, der andere ...« — »Gallus liegt im Sterben«, antwortete der Söldner. »So sagte uns der Arzt, ein kleiner buckeliger ...« — »An den schwarzen Blattern, bestätigte uns ein Mönch, der dabeistand«, ergänzte der zweite. »Den Blattern?« rief der Centurio. »Weh! Beim Styx! Die stecken an! Also der ältere — gefährlichere — stirbt. Und was ist's mit dem jüngeren, he, Bero, Alemannenbär?« — »Der jüngere? Das ist ein Kind von kaum sechs Jahren. Ich morde keine Kinder«, zürnte der Riese und schüttelte die roten wirr-zottigen Locken. »Willst du, so tu's selbst. Ich nicht! Geh hinein! Er liegt schluchzend über den sterbenden Bruder hingestreckt. Geh, schlachte du ihn ab!« — »Ich danke! Ich scheue jene schwarzen Beulen. Fort aus dem verpesteten Hause!« — »Alles, was schaden kann, sagte der Ober-Eunuch.« — »Kinder können doch nicht schaden. Auch nicht diese Kleine da! Weiter! Die Liste ist gar lang und kurz die Maiennacht. Und die Sonne darf keinen mehr am Leben finden, so hieß es. Fort! Hinaus!«
In Kilikien nahe bei Tarsus ragte in einer abgelegenen öden Vorstadt aus düsteren Zypressen ein düsteres Gebäude; wie eine Feste umschlossen es hohe Steinmauern.
Und es war auch eine Feste: eine Wehrburg der Kirche, eine Klosterschule, in welcher Knaben und Jünglinge, streng abgesperrt von dem Lärm und von den Verführungen des Lebens, für den Priesterberuf vorgebildet wurden. Nicht alle hatten freiwillig diese Laufbahn gewählt: es waren viele Waisen darunter, meist Söhne von »Hochverrätern«; oder doch von — Hingerichteten.
An das schweigende Haus mit seinen schmalen, lichtarmen Gängen und den schmucklosen, einfenstrigen Zellen der Zöglinge stieß ein nicht minder freudlos anmutender Garten: entlang den altersgrauen Mauern starrten die dunkelgrünen, finsteren Zypressen, und in jedem Eck der rechtwinkeligen Umwallung schüttelte eine einsame Pinie, verträumt und traurig, das schwermütige Haupt.
Der Rasen des Gartens war von der heißen Sonne braun gebrannt. In der Mitte lag der verwitterte Steinbrunnen fast ausgetrocknet: er sollte einen Springquell vorstellen; aber nur ein kläglich dünner Wasserstrahl hob sich mit schwacher Regung ein paar Fuß aus dem schwarzen Marmorgrund, um alsbald wie todesmatt und lebensmüde, wie verzweifelnd geräuschlos wieder herabzugleiten.
Es war Hochsommerzeit. Mitleidlos brannte die grelle Mittagssonne senkrecht nieder auf die blendendweißen Sandwege, die den viereckigen Raum, ein Kreuz bildend, schnitten. Kein Busch, keine Blume ward hier geduldet; sie hätte auch verschmachten müssen; daher flog hier auch nie ein Falter, kein Vogel sang; die Schwalbe hielt im Zwitschern ein, flog sie über den öden Raum dahin; rings alles still bis auf das einförmige Gezirp der Zikaden auf den in der Glut badenden waagrechten Ästen der Pinien.
Zwölf Jahre nach jener Mordnacht waren vergangen; da wandelten unermüdet, ununterbrochen, trotz der drückenden Hitze auf den schattenlosen Wegen, langsam, in immer gleichmäßigem Schritte dahin, ein Mann in reifen Jahren und ein halbwüchsiger Jüngling: beide barhäuptig, bararmig und barfuß, beide in lange weißgraue Kutten als einziges Gewand gekleidet; die waren von Ziegenfell, das Haar nach innen gekehrt; ein dreifach geknoteter derber Strick hielt das rauhe Kleid über den Hüften zusammen.
Der Jüngling bemerkte, wie der zu seiner Rechten Schreitende schwer unter der sengenden Hitze litt: Er atmete mit Anstrengung, er wischte wiederholt den Schweiß von der hohen, tiefgefurchten Stirne. »Wie kann ich dir danken?« sprach der Jüngere, das dunkle seelenvolle Auge mit den langschattenden schwarzen Wimpern zu jenem aufschlagend. »In Christo Geliebter, du mein Lehrer, mein einziger Freund auf Erden, du mein ein und alles! Mir legt der Abt die Buße auf, und du — du teilst sie freiwillig mit mir! Nur um sie ...« — »Dir zu erleichtern, mein in Gott geliebter Sohn! Eintausend Vaterunser sind dir auferlegt, hintereinander in der Sonnenglut zu beten, dann mir zu beichten und die von mir über dich zu verhängende weitere Buße zu leisten. Ich begleite dich, bis du tausend Gebete zu Ende gesprochen: ich weiß, du wandelst leichter, schreite ich neben dir.« Dankbar drückte ihm der Jüngling die Hand. »Darf ich jetzt — nachdem ich die Strafe erlitten — fragen, weshalb ich bestraft ward? Vorher ist es ja verboten.« Der andere nickte, ließ das durchdringende, fast unheimlich scharf blickende Auge auf ihm ruhen und strich ihm über das glänzendschwarze, ganz kurz geschorene Haar. »Jetzt darfst du fragen. Du wurdest gestraft wegen geistlicher Hoffart, o mein Julianus.«
»Ich?« rief der Jüngling und blieb erschrocken stehen. »Oh, die Heiligen wissen, wie demütig ich bin im tiefsten Herzen, wie zerknirscht im Bewußtsein meines Unwertes, meiner Sündhaftigkeit. Was habe ich verbrochen?«
»Du hast, als du dich unbeachtet glaubtest in deiner Zelle, einen Stachelgürtel um die Lenden geschnürt.« Jähes Blut schoß in die wachsfahlen, eingesunkenen Wangen des jungen Büßers: die schmächtige, noch beinahe knabenhafte Gestalt bebte. »Wer hat ...? Wie ist es möglich ...? Ich war ganz allein.« — »So wähntest du. Aber Gott nicht nur — auch der Abt sieht dich, wo dich niemand sieht.« Da wechselte der Ausdruck auf dem schmalen, hageren Antlitz des Jünglings; zornig loderte nun sein dunkles Auge, die blauen Adern in den Schläfen schwollen an: »Lysias, das ist elende Auflauerei.«
Erschrocken sah sich Lysias um. Er legte warnend den Zeigefinger der Linken auf den Mund.
Da lag der Jüngling schon, wie vom Blitze niedergestreckt, vor ihm im Staub, umfaßte seine Knie und flehte: »O vergib den Frevel: die Todsünde des Zornes.«
»Und die schlimmere des Zweifels, würde Abt Konon sagen«, sprach Lysias, ihn erhebend. »Kann Gott dem heiligen Abt nicht enthüllen, was du im Verborgenen treibst? Es ist aber Überhebung, ist geistlicher Hochmut, durch heimliche Kasteiung mehr Ruhm als die Brüder vor Gott gewinnen zu wollen. Nun zu deiner Beichte. Aber bevor wir damit beginnen«, hier verschärfte sich wieder wie drohend der spähende Blick, »ich muß bis in die tiefsten Wurzeln deiner Gedanken, bis in die feinsten Keime deiner Neigungen dringen und deine ganze Vergangenheit überschauen, um dich, den Gewordenen, zu begreifen: Erzähle mir also von Anfang, von deiner frühesten Kindheit an die Geschichte deines jungen Lebens. Nur stückhaft, getrübt durch der Menschen Haß oder Vorliebe, kam mir manche Kunde davon zu in — in der Einsamkeit dieses Klosters«, fügte er zögernd bei. »Gern, mein Vater. Aber du weilst noch nicht lang — nicht häufig im Kloster. Wo ...?« Ein leichtes Gewölk zog über die tiefgefurchte Stirn des Mannes. »Laß das! Einstweilen nur soviel: Ich reise oft nach Ägypten, meiner Heimat, zurück.«
»Wohl in das Mutterkloster unseres Klosters; wie fast aller andern, welches Pachomius der Fromme auf jener Insel des Nilstroms, Tabennae ...?« — »Nicht doch! Frage nicht! Dann — zu rechter Zeit — wirst du viel mehr aus meinem Munde vernehmen, als du je ahnen könntest. Beginne. »Ich weiß also: Du bist der Sohn des Patricius Julius, der Neffe des großen Imperators Constantin, der Vetter unseres jetzigen Herrn, Constantius ...« — »Dem Gott langes Leben und Sieg verleihe«, unterbrach der Jüngling, die mageren, schmalen Hände fromm zum Gebete faltend. Scharf prüfte dabei der Ältere den Ausdruck seiner Mienen: er fand — mit Überraschung —, die Worte der vorgeschriebenen Formel wurden nicht formelhaft oder erzwungen, vielmehr mit tiefer Empfindung, aufrichtig gesprochen. »Noch in der Stunde des Todes des großen Herrschers«, fuhr Lysias fort, »wurden alle seine Verwandten getötet, auf Befehl des neuen Herrn, Constantius.«
»Dem Gott langes Leben und Sieg verleihe!« wiederholte Julian; aber diesmal furchte sich ihm wider Willen die weiße Stirn.
»Ausgenommen nur seine beiden Brüder, Constans und Constantinus, mit denen er sich, nach des Vaters Gebot, in das Reich teilen mußte. Zu ihrem Glücke weilten sie nicht in Nikomedia. Damals ward auch ... hingerichtet dein Vater, obwohl er dem Constantius nicht nur Vatersbruder, auch noch sonst verbunden war. Nicht?« fragte er lauernd.
»Gewiß! Er war meines Vaters Eidam, er ist nicht nur mein Vetter, auch mein Schwager: er war mit meiner kurz vorher verstorbenen Schwester vermählt, unser Imperator Constantius, dem Gott ...«, er brach kurz ab.
Lysias warf einen befriedigten Blick auf den innerlich Ergrimmten und fuhr fort: »Als nun das Ärgste geschehen war ...«
»Als das Ärgste geschehen war«, unterbrach Julian mit einem wohlgefälligen Lächeln, »da geschah erst das Ärgste! Ist es eine Sünde, o Vater«, er errötete sehr anmutig, »daß ich mich stark erfreue an solchem dialektischen Spiel?« — »Am Wortwitz? Eine Eitelkeit ist es, eine Schwäche, nicht gerade eine Sünde. Du bist überhaupt recht witzig, aber noch viel mehr eitel als witzig, o Julianus.« — »O mein Lehrer!« — »Jawohl! Trotz aller Demut, zu der du dich — oft schwer! — zwingen mußt. Du gehst vernachlässigt einher — aber wie Sokrates zu Antisthenes sprach: Durch die Löcher deines Mantels strahlt deine Eitelkeit hindurch.« — »Du hast recht«, flüsterte Julian und schlug die langen Wimpern nieder. »Ich will es abtun.« Er bückte sich, ihm die Hand zu küssen. Lysias entzog sie. »Du wirst das nicht können, mein lieber Sohn. Es ist deine eigenste Eigenart. Aber hüte dich: Man beherrscht die Menschen durch ihre Lieblingsschwäche; dich wird man durch deine Eitelkeit beherrschen.« — »Mich, den armen Mönch? Wer sollte das der Mühe wert finden?« Ein scharfer Blick schoß hier aus den leidenschaftlichen Augen des andern. »Wer? Nun, vielleicht ich, Julianus.« — »Du scherzest! Übrigens: Von dir will ich mich beherrschen lassen — immerdar!« — »Willst du?« fragte Lysias mit einem stechenden Blick. »Ich werde dich dieses Wortes dereinst gemahnen, Julian. Aber fahre fort. Was war noch ärger als dieses Ärgste? Als diese ... Morde?«
»Der Gebrauch, der Mißbrauch, den der Mörder von dem Erfolg machte, gegenüber den Seelen von uns drei Kindern, die er — noch! — verschonte, der Herzverhaßte!« Feuer loderte aus den Blicken des Jünglings. »O vergib, mein Vater, aber ich kann ihn noch immer nicht recht lieben, den Augustus! Ich weiß ja: Liebet eure Feinde — vergebet euren Schuldigern. Und so weiter! Ach, was er mir getan — ich verzeih es ihm. Aber was er Gallus, was der heißgeliebten Mutter, der Schwester — ich kann es nicht verzeihen! Strafe mich, versage mir den Sündenerlaß — denn das ist meine schlimmste Beichte! Aber ich kann nicht. Noch nicht!«
Und in überwältigender Qual des Gewissens warf er sich abermals seinem Beichtiger zu Füßen; in heißer Angst, flehentlich sah er zu ihm empor.
Da zuckte der die Achseln, sah sich vorsichtig um und sprach dann ganz ruhig: »Wenn du nicht kannst, kannst du nicht. Ich tät's auch nicht, 's ist wider die Natur. Steh auf.«
In äußerster Überraschung, ja Bestürzung sprang der Jüngling auf die Füße und starrte ihn an. »Was — was ist das? Das war kein christlich Wort.« — »Aber ein wahres. Still! Kein Aufsehen! Die Späher! Sie lauern da oben hinter den Fenstervorhängen auf uns herab. Erzähle weiter.« Doch Julian konnte sich noch immer nicht erholen von seinem Staunen. »Wahrheit außer der Kirche? Gegen die Kirche? Das gibt es nicht!« flüsterte er entsetzt vor sich hin. »Und du, du — bist ein Priester des Herrn?« — »Ein Priester bin ich. Ein Priester großer Herren — und meines Herrn. Gedulde dich noch! Sprich weiter. Ich befehl es.« Mit Anstrengung faßte, sammelte sich Julian: Er konnte das suchende Auge nicht lösen von dem Antlitz des widerspruchsvollen, rätselhaften Mannes.
»Wir waren, sobald die Krieger hinweggestürmt, von unserem Arzt und einem Mönch, einem Freund unseres Hauses, der in der Mordnacht den todkranken Bruder pflegen half, aus den blutbespritzten Gemächern in das Asyl einer Kirche geflüchtet. Von dort aus ließ der Imperator nach mehreren Tagen uns drei Geschwister in den Palast holen. Mit Gewalt riß uns der Kriegstribun der Prätorianer aus den Armen unserer Beschützer. Zum Tode, meinten die beiden, würden auch wir nun geschleppt. Mir war's gleichgültig, ich weiß nicht, warum. Obwohl ein Kind, war ich wie lebensmüde: Ich beruhigte die Schwester Juliana, die sich ängstlich an mich klammerte, küßte sie auf die Augen — wir haben uns immer so lieb gehabt! — und sprach: ›Weine nicht, liebes Schwesterlein, wir sind Waisen; wir haben auf Erden keinen Freund. Denn auch die Mutter ist wohl ermordet.‹ Der gute Mönch sagte, sie ist aus dem Hause des Arztes, der die Bewußtlose gerettet hatte, von Kriegern mit Gewalt fortgeführt worden. Waisen aber sind am besten geborgen — im Grabe der Eltern. Denn dann sind sie nicht Waisen mehr.«
»Ein sechsjähriger Knabe«, staunte Lysias. »Widernatürlich frühreif.«
»Aber Gallus, mein Bruder, sieben Jahre älter als ich, inzwischen genesen, tobte gegen den Tribun. Er schlug nach ihm, er wollte ihm das Schwert aus der Scheide reißen; mit Gewalt mußte der Mann den Zappelnden auf den gepanzerten Arm nehmen. In dem Vorhof der Basilika wurden wir in zwei Sänften gehoben — ich mit Juliana —, den schreienden Gallus nahm der Tribun in die andere. Die Läden der Sänften wurden sorgfältig geschlossen; das Volk auf den Straßen sollte nicht erfahren, wer da in das Palatium — zum Tode? — gebracht werde, auf daß es nicht versuche, uns zu befreien! Sechzig Prätorianer waren aufgeboten, drei Kinder vom Entspringen abzuhalten: Waffenklirrend umdrängten sie die Sänften, die Neugierigen, die herzuliefen, den Aufzug zu sehen, mit gefällten Speeren abwehrend.
In dem Palast angelangt, wurden wir vor den Imperator geführt. In dem von Gold und Elfenbein leuchtenden Saale saß er, umgeben von den Großen und von den Eunuchen des Hofes, auf dem hohen Thron: blutrot der Thron, blutrot sein Mantel. Ich sah sein Antlitz zum erstenmal: das leichenfahle, hagere — stets von heftigem Zucken bewegt — den unsteten Blick ...«
»Genug! Ich kenne ihn.«
»Mir schauderte: all das Blutrot mahnte mich des Blutes der Meinen — die ja auch die Seinen gewesen! —, das er in Strömen vergossen. ›Schuldlos Blut färbt wohl besonders stark?‹ Das mußte ich immer denken. Auf einen Wink des Obereunuchen sollten wir vor dem Augustus auf die Knie niederfallen. Juliana gehorchte, auch ich, da ich mich nicht berühren lassen wollte, wie Gallus geschah, den sie an den Schultern niederdrückten. Nun ward uns verlesen — uns drei Kindern, o mein Vater! — unser Todesurteil. Mit Berufung auf Gottes Ausspruch, daß er die Schuld der Eltern rächt bis ins vierte Glied. Unsere Eltern seien wegen erheblichen Verdachtes des Hochverrats hingerichtet, wir hätten vermöge der vorbeugenden Gerechtigkeit das gleiche verdient, des Vaters und der Mutter Vermögen sei dem Fiskus verfallen und bereits eingezogen. Wir wurden nun gefragt, ob wir alles verständen? Die Schwester und ich, wir nickten stumm. Gallus aber ballte die Faust wider den Imperator und schrie zum Thron hinauf: ›Ja, ich versteh's! Blutiger Herodes! Kindermörder!‹
Der Augustus ward noch bleicher als er war — bleicher als bleich. — Klingt das nicht zierlich?«
»Schon wieder ein Wortspiel, o Julianus, du, eitler als eitel!«
»Aber Eusebius, der Präpositus und Obereunuch, fuhr fort; Constantius hatte kein Wort gesprochen, nur scheuen Auges von mir auf Gallus, von Gallus auf mich geblickt. ›Dem Tode seid ihr verfallen. Über euerm Nacken schwebt das Schwert des gefällten Urteils.‹ (Ein schiefes Bild, nicht? Ich mußte das damals schon denken.) ›Allein die Gnade des Imperators läßt es — noch! — unvollstreckt. Lebt, lebt weiter unter dem hangenden Schwert. Aber seid stets dessen gedenk: jeden Augenblick — ein Zucken der imperatorischen Wimper, und es fällt auf euere Nacken.‹
Gallus wollte erwidern; er machte drohend einen Schritt gegen den Thron hin; da winkte der erschrockene Imperator hastig mit dem Zipfel seines Purpurmantels. ›Hinaus! Hinaus!‹ stieß er hervor mit hohler Stimme — es war sein erstes Wort —, und hurtig schoben und drängten die Prätorianer uns an den Schultern aus dem Saal.
Draußen wurden wir sofort getrennt — umsonst barg ich die laut weinende Schwester an meiner Brust: sie rissen sie aus meinen Armen! Ich sah sie, sah Gallus niemals wieder. Ich ward in geschlossener Sänfte aus der Stadt geführt, ans Meer, eingeschifft und zuerst nach Ionien, alsbald aber hierher nach Kilikien gebracht. Dort, an der Schwelle der Mauerpforte, empfing mich der heilige Abt und verkündete mir, der Imperator habe mir das Leben geschenkt nur unter der Bedingung, daß ich mich nie vermähle und daß ich ein Priester des Herrn werde. Mir war alles gleich, auch Tod oder Leben. Diese hohen, finstern Mauern schienen mir Grabesmauern. Sind wir doch hier auch so gut wie begraben! Keine Kunde von der Außenwelt dringt in diese Stelle. Weiß ich doch nicht einmal, ob meine Mutter, meine Geschwister noch am Leben sind. Der heilige Abt verbot zu fragen.
Nur durch deine Güte erfuhr ich ja auch von dem Wichtigsten, was in diesem Reiche der Römer geschehen ist in all diesen zwölf Jahren. In unserem Haus, dem der Constantier, lebt, scheint es, die Wolfsart von Romulus und Remus fort. Die drei Brüder, die Söhne und Erben des großen Constantin, Constantius, Constans und Constantin, die sich in das Reich geteilt, gerieten in Streit um die Beute, das heißt um das Erbe der in jener Mainacht Gemordeten: Constantin fiel, sinnlos vor Gier, nach Räuberart in das Gebiet des Constans ein und ward erschlagen wie ein Wolf im Walde. Zehn Jahre darauf trieb Constans durch seine Ungerechtigkeit einen tapfern Feldherrn, Magnentius, zur Verzweiflung, zur Empörung und fiel auf der Flucht. Schwer, furchtbar, blutig hatten des letzten übrigen der drei Brüder, hatten des Constantius Heerführer zu ringen, bis sie Magnentius niedergekämpft hatten. So herrscht jetzt Constantius allein über den Weltkreis: von den fernsten Atropaten östlich vom Tigris im fabelhaften Morgenland bis zu den Britannen, die in den Nebeln des Weltmeers verschwinden, und vom Mittellauf des Nils bis zu dem grausigen Rheinstrom, der manchmal, sagt man, zu festem Eis gefrieren soll: Weh, wer das schauen müßte. Aber welche Fülle der Macht! Fast zu gewaltig für einen Sterblichen. Kann Constantius ...?«
Er schwieg, in Sinnen versunken.
Lysias blieb stehen: »Hättest du Lust, ihm einen Teil dieser Bürde abzunehmen?« Scharf, durchdringend prüfte er bei der Frage die Mienen des jungen Mönches. Dieser aber lächelte schwermütig: »Ich? Wie du spottest! Doch freilich: Wäre ich nicht zum Dienste des Herrn bestimmt, weißt du, was ich am liebsten werden möchte? Ein großer Feldherr. Im Dienste des Römerreichs Perser und Germanen und alle Barbaren hinwegscheuchen von den Grenzen in sieghafter Schlacht ...« — »Nun sprüht dein dunkles, sonst so träumerisches Auge Blitze! So gefällst du mir, o Julianus. Aber erzähle weiter. Wie erging es dir nun hier? Trotztest du nicht dem schimpflichen Zwange?« — »O nein! Willenlos ließ ich alles mit mir geschehen. Doch geschah mir nichts Schlimmes — nichts Schlimmeres als den anderen Knaben: lernen, beten, büßen, büßen, beten, lernen — so verstrichen mir die Jahre hier. So werden sie wohl verstreichen, bis ich sterbe — hoffentlich bald. Lernen, büßen, beten!« Erschöpft hielt der kleine Schmalbrüstige inne.
»Ja«, murmelte der andere vor sich hin. »Und was beten? Was büßen? Was lernen?« — »Wie meinst du, heiliger Vater?« — »Nenne mich nicht heilig. Nicht Menschen sind heilig, nur die ...« — »Du sagtest: ›Was lernen!‹ Ja freilich! Es genügt mir wenig! Auf die Zweifel, die Fragen, die mich zu eifrigst umtreiben, Tag und Nacht, erhalte ich Antwort weder von den Büchern, die wir auswendig lernen, inwendig wäre besser, nicht?« lächelte er, erfreut über die Wortwendung, »noch mündlich von den Vätern. Eingebungen der Dämonen nennen sie meine quälendsten Fragen und verordnen mir dafür Bußen. Ich frage gar nicht mehr! Und ich möchte doch so gern! Brennend verlangt mich zum Beispiel zu wissen — mehr zu wissen als die heiligen Bücher sagen! — vom Werden und Wesen der Welt, des Lichtes, der Sonne da oben und der Sterne! Oh, wer mir davon Kunde gäbe! Wo finde ich sie?« — »Hier«, sagte Lysias, und nach einem vorsichtigen Blick nach den Fenstern des Klosters, griff er in seine Kutte und zog zwei starke Papyrusrollen hervor. »Und hier. Rasch! Unter dein Gewand damit.«
Aber Julian zögerte. Erstaunt blickte er auf die Überschriften. »Platons Timäos! Und Plotin! Sie sind streng verboten. Bei Geißelung!« — »Fürchtest du dich, Julian? So gib sie zurück.« — »Nur mit meinem Leben! O Dank! Dank!« Und er wollte sich wieder in den Staub vor ihn werfen. Lysias hielt ihn ab. »Nicht doch! Man kniet nur vor jenen, die dem All das Licht gesandt haben und dir — mich.« — »Und meine Beichte? Und die Vergebung meiner Sünden?« — »Du trachtest nach dem Licht: der Gott des Lichts, der oberste von allen, vergibt dir — durch mich — alle Sünde. Denn nur eins ist Sünde: nicht nach dem Lichte, nicht nach den ... guten Gewalten trachten. Du bist nun reif, soviel zu hören. Bald mehr! Genug für heute! Es grüßt dich, Julianus — durch mich — der göttlichste Gott.« Er strich ihm mit der Rechten über Stirn und Augen.
Und raschen Schrittes eilte er hinweg; verzückt schaute ihm der Jüngling nach.
Tag für Tag wandelte nun der junge Mönch stundenlang allein mit Lysias, dem er von dem Abt besonders zur Ausbildung überwiesen war, in dem stillen Klostergarten, stundenlang vertieft in ernste Gespräche.
Julian ermüdete niemals zu fragen. Sein leuchtendes, schwärmerisches Auge hing ganz an den Lippen des Lehrers, und dieser ermüdete nicht, zu antworten. Freilich, seine Antworten genügten oft wenig dem scharfen, an Dialektik sich freuenden Geiste des Schülers. Es schien, als ob der so weit überlegne, reife Mann gar oft den Frager nur in den Vorhof der Weisheit dringen lasse, die letzten Aufschlüsse noch zurückhalte. Dadurch geriet der Jüngling in einen Zustand rastlosen, nagenden, bohrenden Zweifels. Immer leidenschaftlicher ward sein Drang nach Erkenntnis entfacht; hätte Lysias es auf solche Steigerung angelegt, und zugleich darauf, den Grübler immer fester an den kargen Belehrer zu knüpfen, er hätte es nicht schlauer angehen können.
Als Julian nach einigen Tagen ihm verstohlen die Schriften Platons und Plotins zurückgab, glühten die bleichen Wangen, seine magere Hand zitterte. »Dank! Heißen Dank! Aber mehr. Mehr! Alles!« flüsterte er. — »Du fieberst, mein Sohn!« sprach Lysias, die Rollen sorgfältig unter seinem Gewande verbergend. »Dein Auge glänzt, deine Schläfen brennen, doch deine Finger sind eiskalt. Wie hast du geschlafen?«
»Gar nicht. All diese Nächte nicht! Immer, immer las ich's noch mal. Ich weiß nun gar viel davon auswendig. Wieviel leichter, gieriger erfaßt mein Geist diese Wunder, diese Offenbarungen als die Offenbarung des heiligen Apostels Johannes. Wie wüst ist diese, wie ...! Aber sprich endlich, Meister! Gar vieles in diesen Lehren — und oft gerade, was mich am glühendsten begeistert — widerstreitet der Lehre der Kirche. Ach ich flehe dich an — ich ringe so hart! Was — was ist Wahrheit?« — »So fragten auch andere schon.« — »Ja, Pontius Pilatus, der Mörder des Herrn!« rief Julian mit Grauen. »Aber doch ...! Weiche mir nicht länger aus. Ich verzweifle in diesem Hin- und Herschwanken zwischen den Lehren der Kirche und den Gedanken im Timäos oder den Geheimnissen Plotins. Aber ach! Ich weiß ja gar nicht, wohin! Ich wage mich nicht weiter hinaus auf das offne Meer der Gedanken! Ich kann, ich will nicht den Anker lichten, den ich ein Jahrzehnt lang so tief in den Felsgrund der heiligen Kirche versenkt. Nur die Kirche hat die Wahrheit und das Heil. Ich kann nicht, ich werde niemals von ihr lassen.« Er seufzte. Er stöhnte. Er sah schwärmerisch gen Himmel.
Lysias ließ lange den bohrenden Blick auf ihm ruhen.
»So? Nun, es begreift sich. Die Zucht war lang, scharf und unausgesetzt. Die werdende Seele des Kindes schon ward planmäßig umsponnen. Es ist vielleicht besser so! Vielleicht irrte ich, denn die Sterne irren nicht! Ich war zu rasch! O mein Sohn, die Weltanschauung des Menschen ist gar nicht bloß das Ergebnis seiner Gedanken, noch mehr der Erleuchtung durch die Himmlischen und durch die eignen Erlebnisse. Und du — du hast noch nichts erlebt.« — »Ich dächte doch!« erwiderte erschaudernd der Jüngling. »Allerdings, deines Hauses Ausmordung, das Todesurteil über drei Kinder, verhängt durch den frommen Imperator. Es ist ziemlich viel. Aber doch, scheint es, noch nicht genug! Wie lehrt die Kirche? ›An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.‹ Constantius ist nun zwar schon eine Giftfrucht sondergleichen ...« — »Aber er ist nur Laie«, warf Julianus ein.
»Wohl! Du sollst die Früchte an den Priestern kennenlernen. Erleben sollst du nun die Erkenntnis, dann erst wieder weiter forschen, denken, Schlüsse ziehen.« — »Aber, du selbst«, rief Julian gequält, »du bist ja auch ein Priester der Kirche ...?« — »Ein Priester bin ich, ich sagte es schon. Jedoch es gibt der Götter viele — wenigstens«, verbesserte er rasch, »nach dem Glauben der Menschen! Und es gibt Grade der Erkenntnis viele — wie der Weihen.«
»O Lysias! Glaubst du, daß es irgendeine Weisheit gibt, welche ...? Ich rede nicht von der Erkenntnis der Welt; diese genügt mir nicht, wie sie die Väter lehren! Ich kann nicht an den verhängnisreichen Apfelbiß im Paradiese glauben. Äpfel sind, so scheint's, ein Obst des Unheils (ist das nicht ein hübscher Witz?). Denk an die Troer und Achäer, an Eris und Paris. Aber gibt es irgendeine Lehre, die mehr die Tugend ihrer Bekenner fördert als die Selbstverleugnungslehre unserer heiligen Kirche? Sie entzückt mich, diese begeisternde Pflichtenlehre, diese Abtötung des Fleisches, wie sie Abt Konon übt, und diese Demut, dieser Verzicht auf alle Macht und Herrschaft selbst der höchsten Bischöfe. Nie will ich anders von den Pflichten denken als die Kirche lehrt: die Flucht aus der Welt, die Verachtung der Welt, die demütige Selbstverleugnung.«
»Das also sind sie, die beiden ›Früchte‹, die dir den größten Wert zu haben scheinen? Die Hauptbeweise für die Göttlichkeit der Kirchenlehre: die Fleischabtötung und die herrschaftverachtende Demut?«
»Gewiß, mein Meister! Die Selbstverleugnung! Die Vernichtung der fleischlichen Begier und die Vernichtung der Herrschgier. O wie hat jüngst der Abt Konon den jungen Theodoretos, den schönen kraftstrotzenden Griechen, geißeln lassen, weil der den Kopf umwandte, um dem üppigen vollbrüstigen Fischermädchen nachzugucken, wie es am Fasttag die Fische aus der Stadt dem Kloster gebracht hatte! Er selbst, der hohe Abt, schwang die Geißel, daß das Blut des nackten Knaben in Strömen auf den Estrich schoß. Welch heiliger Eifer! Als war es ihm Wollust, so glühte er. Und wie kasteiet er sich selbst! Nie einen Tropfen Wein bringt er über die heiligen Lippen. Und dann: welche Demut sogar der höchsten Priester! Hast du vergessen, was neulich aus dem Briefe des Papstes Liberius verlesen ward? Wie der, dem schon nahezu alle Bischöfe eine Art von Ehrenvorrang einräumen, als dem Nachfolger Sankt Peters selbst, wie sich der Papst vor dem Imperator Constantius auf das Antlitz warf, am Eingang der Peterskirche, wie er sich ›den Knecht der Knechte Gottes‹ nannte, ›des Imperators niedrigsten Sklaven‹, wie dem Imperator allein alles Erdreich und auch die Kirche zu gehorchen habe? Und doch weiß ja der heilige Vater, daß er von Sankt Petrus den Schlüssel des Himmelreichs überkommen hat, zu binden und zu lösen für die Erde und für den Himmel. Wahrlich, eine Lehre, die solche Tugenden erzieht, ist göttlich! Was wollen dagegen Platon und Plotin! Haben sie die Heiden vor der Sünde bewahrt?«
»Gut, mein Sohn, an ihren Früchten, das heißt an ihren Priestern sollst du die Kirche erkennen. Und zwar nicht nur vom Hörensagen und nicht aus Briefen. Es wird allmählich Zeit, daß du den Blick aus diesen Klostermauern hinaus in die Welt schweifen läßt; in die Welt, wie sie ist, nicht wie sie dir geschildert wird. Noch die Pfingsttage sollst du hier erleben. Dann werde ich den hochehrwürdigen Abt bitten, daß er dich mir als Begleiter mitgibt auf eine Amtsreise. Freue dich, Julian! Du sollst die Welt sehen. Du sollst Gut und Bös unterscheiden lernen.«
Julian erschrak heftig. »O Meister! So sprach die Schlange.«
»Gewiß! Hat sie gelogen? Nur wer das Böse kennengelernt hat, kennt auch das Gute.«
Das Pfingstfest war gekommen. Schon den Tag vorher hatte die Einleitung der frommen Feier begonnen: strengeres Fasten, häufigerer Gottesdienst, zahlreichere gemeinschaftliche Gebete und Gesänge. Geistliche und Mönche waren, oft aus weiter Ferne, herzugewandert, das hohe Fest in dem seiner Heiligkeit, seiner strengen Zucht wegen berühmten Kloster zu begehen. Es hieß »Hagion«, »Heiligtum«.
Julian traf in diesen Tagen die Reihenpflicht als Pförtner. Unermüdlich und ohne Klage saß er, wie die schlummerlose Nacht hindurch, so unter dem heißen Sonnenbrand des Mittags vor der Klosterpforte und waltete seines Amtes.
Da wankte auf der staubigen Straße vom Norden, vom Taurusgebirge her, in welchem die nackten Wände steil in die Luft ragten, an seinem Stab abermals ein Pilger in brauner Mönchskutte heran. Obzwar noch rüstig an Jahren, war er gebeugt in der Haltung: die Glut des Tages, die Mühe der Wanderung schienen schwer auf ihm zu lasten; gleichwohl ging er zu Fuß neben seinem Maultier her; er bückte sich oft, von dem Rand des Grabens die kargen Halme zu pflücken und sie dem Tiere darzureichen, das dann dankbar zu ihm aufblickte. Als er in Sehnähe kam, hielt der junge Pförtner die Hand vor die Augen, die blendenden Sonnenstrahlen auszuschließen. Nun erkannte er offenbar den Wanderer. Hurtig lief er ihm entgegen. Sobald er ihn erreicht hatte, wollte er sich ihm zu Füßen werfen, aber der Ankömmling hielt ihn ab und zog ihn an die Brust.
»O Johannes, mein Vater, mein frommer Lehrer!« rief der Jüngling innig und bedeckte die hageren sonnengebräunten Hände des Pilgers mit Küssen. »Wie wohl tut es mir in der Seele, dich wiederzusehen! Allzulang bist du mir fern gewesen.«
Der Pilger ließ die sanften blauen Augen lang auf den bleichen erregten Zügen des Mönches ruhen: »Ja, mein Julianus, ich glaube, es ist gut, daß wir wieder einmal Blicke und Worte tauschen. Ich hatte starke Sehnsucht nach dir. Und schwere Träume ängstigten mich um dich. Ich sah dich Arglosen umringelt von einer giftigen Schlange, die ihre Kreise näher und näher um dich zog. Die Sorge um deine Seele trieb mich her. Ich finde dich verändert, sehr. Gar wenig jugendlich siehst du aus! Eingefallen die Wangen, bleich, nur in der Mitte ein roter brennender Fleck, schwarze Schatten um die Augen: allzuhell glänzen die aus tiefen Höhlen heraus. Und warum — ich sah es wohl! — saßest du mitten im Sonnenbrand statt in dem Schatten des vorspringenden Eckturms?«
Der Pförtner schlug die Augen nieder. Gluten schossen plötzlich in die wachsfahlen Wangen. Der schmächtige Körper, der das Mittelmaß nicht erreichte, zitterte. Er wankte. Der andere hielt ihn aufrecht an den Schultern.
»Ich ahne! Du wolltest dich wieder einmal über das Gebot der Klosterzucht hinaus kasteien! Maßlose Abtötung, nein: Peinigung des Fleisches! Selbstauferlegte Buße!« Julian barg das Angesicht an seinem Halse und weinte, weinte bitterlich. »Mein armer Sohn! Mein Liebling! Fasse dich! Was quält dich so?« — »O laß mich weinen! Weinen an deiner treuen Brust. Ah, das tut wohl wie Gewitterregen nach verzehrendem Sonnenbrand. Oh, laß mich dir beichten.« — »Nicht mir, mein Julian! Wer ist dein vom Abte verordneter Beichtiger?« — »Lysias.«
Da erschrak der Alte und fuhr zusammen.
»Aber er erläßt mir alle Sünden, die ich beichte, ohne jede Buße. Er lächelt über das, was ich Sünde nenne. Auch über ...« Er verstummte.
Der Pilger strich ihm über die Stirne: »Auch wohl über den Zweifel«, ergänzte er, »der dir immer wieder auftaucht? Mein armes Kind! Du mußt nicht zweifeln, darfst nicht grübeln. Glauben mußt du, oder elend sein.« — »Woher weißt du ...?« — »Ich liebe dich, darum kenn ich dich. Auch ich war einmal jung, war voll Fleischeslust, aber auch voll Lernbegier, war voll Hoffart weltlichen Wissens gegenüber den Lehren des Herrn, die freilich wider die Vernunft gehen, weil über die Vernunft. Darum eben müssen wir glauben. Verzage nicht, verzweifle nicht, weil du noch zweifelst, mein Sohn. Du wirst überwinden. Glaube mir, nicht durch die Bücher, nicht durch die Lehre, durch das Leben allein wirst du unlösbar mit Christus verknüpft. Man kann seinen Erlöser nicht ergrübeln, erleben muß man ihn und seine Wahrheit! Vor jenem aber, dessen Namen du vorher genannt hast, vor jenem laß dich warnen. Er ist —«
Da traf von hinten her ein heftiger Faustschlag den Kopf des Pilgers, daß dessen Reisehut zur Erde flog. Lysias stand zornglühend zwischen den beiden. Sowie Julian ihn erkannte, senkte er den Arm, den er rasch zum vergeltenden Streich erhoben hatte. »Er ist dein geistlicher Oberer, du schweifender Mönch, wie dieses Knaben, des pflichtvergessenen Pförtners, der, dem kindischen Herzen folgend, dir entgegenlief, seinen Posten verlassend. Dort stehen, von den andern Straßen her angelangt, viele Waller vor der heiligen Stätte — und der Pförtner ...?«
Schon war Julian zurückgeeilt und bat die dort Harrenden um Verzeihung.
Einstweilen hob Lysias drohend den Zeigefinger gegen den Ankömmling, und grimmig, bösartig, blitzte sein Auge wider ihn, als er rief: »Wag es, mit mir um diese Seele zu ringen! Wag es, nur noch einmal mit ihm allein zu flüstern, und er soll dich kennenlernen, du Mörder.«
»Wo ist Johannes?« fragte Julian, sobald er die angelangten Gäste über den Hof an die innere Türe geleitet und nun die Außenpforte wieder erreicht hatte.«
»Umgekehrt.« — »Ach! Warum?« klagte der Jüngling. — »Weil ich es befahl. Er ist Subdiakon. Ich bin Presbyter.« — »Und warum schlugst du ihn? Und wann werd ich ihn wiedersehn?« — »Niemals. So hoff ich.« — »Aber warum?« — »Du wagst zu fragen? Weil ich's nicht will. Das genüge dir, Knabe. Aber da ich so töricht bin, dich zu lieben, dich unaussprechlich zu lieben, — will ich deine kecke Frage beantworten: weil er Gift ist für deine Seele. Und weil er dich befleckt mit Blick und Wort. Die Schuld Kains belastet seine Seele. Und er — Er! — will dich vor mir warnen. Der Einfältige! Hat Er Antwort auf die brennenden Fragen, Erfüllung für den Wissensdrang deines Geistes? Was riet er dir?« — »Glauben.« — »Dumpfes Hinnehmen! Der Narr! Der Schwärmer, dem das nagende Gewissen die Klarheit des Gedankens zerrüttet hat. Du zweifelst? Ich sage dir: Er ist ein Mörder. Ihm könntest du folgen? Zurück in die Nacht des blöden blinden Glaubens, in die Knechtung des Verstandes, statt mir, in die Freiheit des Gedankens und in das Licht? Nein, du kannst nicht anders! Mir mußt du folgen. Warte nur noch bis dies Fest zu Ende. Die Ausgießung des Geistes, des heiligen! Jawohl! Auch auf dich soll er ausgegossen werden, der Geist meines Gottes — des Lichtgottes! — und erkennen wirst du bald an seinen Wirkungen den Geist jenes Gottes, dem Johannes dient.«
Endlich war der Abend auch des zweiten Pfingstfeiertages vorüber.
Mit Bewunderung hatte Julian zu dem Abte Konon emporgeblickt, der, ohne einen Bissen, ohne einen Tropfen Wein zu genießen, in allen diesen Tagen unermüdet der schweren Pflichten seines Amtes gewaltet hatte in Messe lesen, Predigten halten, Beichte hören, Psallieren, Umzüge führen, Pilger empfangen, ihre Wünsche und Fragen anhören, erledigen und beantworten. Und wann nun die andern Geistlichen, ermüdet, das Lager suchten, dann brannte noch die einsame Ampel hoch in dem turmähnlichen Söller des obersten Stockwerks, wo der Abt dem Gebet, der Buße, der Forschung oblag. Und wann, lange nach Mitternacht, Julian wieder erwachte, noch immer glühte da oben die Ampel, eine stille Bezeugerin des Fleißes, der Frömmigkeit, der Kasteiung.
Bald nach Mitternacht des Pfingstmontages ward Julian geweckt durch einen Luftzug, der über sein Strohlager auf dem Mosaikestrich hinstrich. Die schmale Tür seiner schmalen Zelle war halb geöffnet. In dem bleichen Licht des Mondes, das durch die ein Fenster ersetzende Luke — hoch oben in der Mauer — hereinfiel, sah er eine dunkle Gestalt regungslos auf der Schwelle stehen. Der junge Mönch erschrak bis ins tiefste Herz hinein. Unter nagenden Zweifeln, unter bohrenden Gewissensqualen war er endlich gegen Mitternacht eingeschlafen.
»Hebe dich von hinnen«, flüsterte er jetzt, und kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn, »im Namen des dreieinigen Gottes — weiche, Versucher, wie immer du heißest: Satanas oder Lucifer oder ...«
»Lysias«, tönte es da ebenso leise von der Tür her. »Steh auf und folge mir. Aber still!« Schon stand Julian hinter ihm auf der Schwelle. Nun schritt er barfuß über die kalten Marmorplatten des langen Klosterganges. Den Jüngling fror.
Geräuschlos schloß Lysias die schwere Eisentüre des Ganges auf. Sie waren im Garten. Der Führer eilte auf dessen Gittertor zu. »Das Kloster verlassen? Zur Nacht?« stammelte Julian. »Wohin?« — »Zum Abt!« und Lysias schob den Riegel zurück.
»Der Abt? Da — hinter uns — hoch oben leuchtet seine Lampe, einem schönen Sterne gleich. Seine Zelle ist ...« — »Leer. Folge!« Nun ging es rasch hinein in das Olivenwäldchen, das sich vom Kloster gegen die Vorhügel des Gebirges hinzog. Alles still und einsam. Der Mond ward hin und wieder von ziehenden Wolken verdeckt.
Plötzlich schreckte der Jüngling zusammen, ein verhaltener Schrei entfuhr ihm. Er griff mit beiden Händen nach dem Kopf. »Was war das? Was huschte über mein Haar? Ein Dämon!« — »Nein. Eine Eule. Der Vogel Athenas ... will sagen«, verbesserte er rasch, »der Weisheit. Ein gutes Wahrzeichen! Du bist auf dem Wege zur Erkenntnis. Vorwärts!«
Noch eine gute Strecke führte Lysias in den nun dichteren Wald hinein; er hatte alsbald den breiten Weg der alten Legionenstraße nach Tarsus verlassen und einen kaum wahrnehmbaren Steig seitab durch dichtes Gestrüpp eingeschlagen. Nur mit Mühe konnte Julian folgen. Die scharfen Zweige der manneshohen Dornbüsche schlugen ihm ins Gesicht, daß seine Wangen bluteten, und rissen Löcher in seine Kutte. Nun standen sie vor einem hoch in die Nachtluft ragenden Bau stolzer Halbbogen. Es war die Wasserleitung, die in besseren Tagen Roms ein Imperator — Hadrian — erbaut hatte; aber lange schon war sie verfallen. Große Steinplatten lagen auf der Erde, von Moos, von Steinbrech überwachsen. Lysias bückte sich und tastete suchend unter den Trümmern umher. Endlich griff er in die eiserne Handhabe einer gewaltigen Marmorplatte, die einem Brunnendeckel glich. Er wandte sich. Julian bog atemlos das Antlitz vor: »Jetzt schweige, was du auch sehen magst, keinen Laut! Oder wir sind beide des Todes!« Er schob nun mit Anstrengung die Platte zur Seite. Eine Schlange huschte, aufgeschreckt, mit Zischen davon. Ein paar Stufen wurden sichtbar. Lysias schritt einige dieser Staffeln hinab. Er winkte dem Jüngling, zu folgen. Sie standen jetzt auf der aus Ziegelsteinen gemauerten Wölbung eines unterirdischen, kellerähnlichen Raumes, aus welchem verworrenes Geräusch bis zu ihnen empordrang. Lysias kniete nieder, beugte das Antlitz und lugte durch einen schmalen Spalt in der Steinwölbung in die Tiefe, die offenbar früher das Wasserbecken für die Leitung gebildet hatte; aber jetzt mußte die ehemalige Brunnenstube trocken sein, denn durch den Spalt glänzte aus der Tiefe ein matter Lichtschimmer herauf.
Lysias nickte befriedigt, erhob sich, Platz zu schaffen, und wies Julian mit dem Zeigefinger die Ritze in dem Gestein. Der drückte nun das Gesicht darauf. Sofort wollte er zurückschnellen. Aber mit eiserner Faust zwang ihm der Priester den Nacken nieder.
Und Julian sah, mußte sehen! Er schloß das Auge. Allein nun vernahm er auch Worte! Und jetzt — unwillkürlich — spähte er auch wieder hinab. Da saßen und lagen in dem kreisrunden Becken bei dem Scheine von Ampeln und Fackeln auf weichen Polstern und Teppichen Konon der Abt mit etwa sechs seiner Mönche und ebensovielen der Pilger und Einsiedler, die Julian der Pförtner als Pfingstgäste eingelassen hatte. Zwischen ihnen aber, die Häupter an ihre Knie geschmiegt, ruhten etwa ebenso viele Mädchen und Weiber aus der nahen Stadt in schamloser Tracht. Der Abt wiegte auf seinem Schoß die üppige Fischerdirne. Vor ihm, auf dem Teppich, wälzte sich, sinnlos betrunken, nackt bis auf den Lendengürtel, Theodoret der junge Mönch. Lallend hielt er die leere Schale zu der Vollbusigen empor, die ihm laut lachend aus goldnem Krug einschenkte.
»Siehst du, Leaena«, begann der Abt mit schwerer Zunge, »was der Junge, der Theodoret, für weiße Glieder hat? Er ist schöner als du. Er wird dich ablösen in meiner Gunst, wie Ganymed bei Vater Zeus Frau Hera verdrängt hat. Ich merkte es schon, als ich ihn geißelte. Ich dachte nicht damals, als ich ihn so hart züchtigte ...« — »Aus eitel Eifersucht!« höhnte Leaena. — »Daß er so bald unseres Vertrauens sich würde wert erweisen. Ja, ja, Knabenschöne geht über Mädchenschöne.« — »Nicht immer«, lachte die Schwarzlockige. »Nicht vielen weich ich. Nicht viele Jünglinge sind so schön. Zum Beispiel, sieht nicht der hagere Imperatorsvetter aus wie ein kranker Ziegenbock?« Schallendes Gelächter antwortete ihr, untermischt mit den Rufen: »Der Grübler!« — »Der Dummkopf!« — »Der fromme Narr!« — »Ich trug ihm auf«, fuhr der Abt fort, »heute bis Mitternacht für mein Seelenheil zu beten. Er ist grenzenlos einfältig. Reiche den schweren Wein hervor, dort aus dem Erdloche! Schenkt ein! Wir können nicht mehr warten.« »Auf wen?« fragte einer der Klostergäste. »Nun, auf den einzigen, der heute fehlt, auf Lysias! — Horch! Was war das? Da oben? Was fiel da?« »Nichts! Ein Stein bröckelte aus der Decke!« antwortete Leaena. Aber es war Julian gewesen, der, mit halbersticktem Schrei, ohnmächtig mit dem Antlitz auf das Gewölbe niedergestürzt war.
In schwerem Fieber lag der junge Mönch auf seinem Stroh; an seiner Seite saß Lysias, mit einem in Essig getränkten Schwamm ihm die heißen Schläfen kühlend.
Schon sechs Tage waren vergangen, seit er den Taumelnden, halb stützend, halb tragend, mit äußerster Anstrengung aus jener Tiefe zurückgebracht hatte in das Kloster. Hier war Julian sofort von heftiger Gehirnkrankheit ergriffen und dem Tode so nahe gebracht worden, daß der Klosterarzt ihn verloren gab. Nicht aber Lysias. Der war Tag und Nacht nicht von seinem Lager gewichen, unermüdlich in seiner Pflege; eifersüchtig hatte er jeden andern ferngehalten von den Fieberreden des Kranken.
»Der Arzt gibt ihn auf«, hatte er zu dem Abte gesagt, »so überlaß ihn meiner Heilkunst. Du weißt, ich kenne die geheimen Kräfte der Natur.« — »Jawohl. Zwar schwerlich kommt dir solche Wissenschaft vom Heiligen Geist. In Ägypten, in Corduene, in Persien und wo sonst du dich so lang umgetrieben, da walten noch die Dämonen. Aber mir kann's gleich sein, ob der verrückte Junge lebt oder stirbt. Und der Augustus wird sich auch trösten über des lieben Vetters Tod.« So hatte Lysias freie Hand gehabt und die Horcher fernhalten können.
»Stirbt er, so stirbt mir — ach, den Göttern! — eine große, vielleicht die letzte Hoffnung. Diesen Grübler und Schwärmer, diesen für alles, was er für edel hält, begeisterten und dabei doch so eitlen Träumer kann man vorausberechnen in jeder Regung seines Geistes. Und auf ihn verweisen alle sichersten Zeichen der Gestirne — auf ihn und ... mein Haus! — Unberechenbar aber freilich ist der Zufall. So auch der Zufall, daß er mich aus dem Munde des Abtes als — angeblichen — Genossen jener Lüste kennenlernte. Das hätte ihn fast getötet. Und das zwingt mich nun, ihm früher, als ich wollte... Er schlägt die Augen auf! Der Puls — das Fieber, ist stark gefallen. Er wird leben! Für mich — und für ... sie! — soll er leben! Und mehr noch: für die Olympier alle als ihr Retter und Rächer!«
Zwei Monate später wandelten Lysias und Julian miteinander durch die Straßen Roms. Der Genesene zeigte noch vielfach Spuren der Schwäche. Oft griff er nach dem Arme seines Begleiters und stützte sich auf ihn zu kurzer Rast. Bewundernd ließ sich der Jüngling, der zum erstenmal die Ewige Stadt betrat, von seinem erfahrenen Führer die wichtigsten Bauwerke, Denkmäler, Erinnerungsstätten weisen und erklären.
Prüfend ruhten dabei jene scharfen Augen auf ihm.
»Es ist seltsam mit dir«, meinte Lysias, als er den jungen Mönch von dem Grabe Sankt Peters, wo der brünstig gebetet hatte, hinweggeleitete, zurück über den Tiber. »Woran denkst du? Schwerlich an die Ketten des Apostels, die du soeben geküßt hast. Wohin? Das ist nicht der Weg in das Haus unseres Gastfreundes auf dem Mons Pincius! Hier geht es ja ...« — »Ei, auf das Forum! Nach dem Kapitol!« rief Julian begeistert, und sein Auge leuchtete. »O laß mich heute noch einmal dorthin; laß mich die Sonne sinken sehen vom Tarpejischen Felsen aus. Es drängt meinen Geist, drängt all mein Wesen aufs Kapitol.« — »Von Sankt Petrus zum Jupiter des Kapitols? Ein weiter Weg! Weiter noch für den Gedanken als für den Fuß! Wie du doch hin- und herschwankst — nicht mit den Beinen nur! So! Lehne dich nur an mich und raste!«
Julian drückte das Haupt an die Schulter des viel höher Gewachsenen. »Ist es ein Wunder, daß ich wanke und schwanke, hin- und hergezogen? Was hab ich nicht erlebt seit zwei Monaten!« — »Nicht eben viel. Du hast die Heuchelei erkannt, die schlimmer als tierischen Begierden und Laster unter der Larve der Selbstabtötung, der Kasteiung des Fleisches. Du hast die Eine Frucht jener Lehren erkannt. Das Verbot des Natürlichen erzeugt das Widernatürliche. Das ist noch nicht viel. Und doch hättest du schier den Verstand darüber verloren — wie den Glauben.« — »Zum Glück aber noch beide nicht! Allein das Ärgste war, daß ich auch dich als einen Genossen jenes Treibens erkennen mußte. Oh, was ich litt in jenen Tagen ...« — »Bis ich dir erklären konnte ... lange Zeit warst du unfähig zu denken! Nur Gebete plappertest du und sahest überall Dämonen und halbnackte Weiber! — daß ich, um jenen Abt und sein einflußreiches Kloster und gar viele diesem Verbündete zu Rom und am Hofe des Imperators zu beherrschen, zum Schein ihre Laster teilte und so auch ihre andern Geheimnisse und zumal ihren Einfluß bei dem Augustus.« — »Ein gewaltig Opfer! Tugenden heucheln ist arg, aber Laster heucheln muß noch schwerer sein.«
»Der Zweck verlangt es. Dafür tat ich noch ganz andres!« Unheimlich funkelten die heiß blickenden grauen Augen. »Der Zweck! Ja, welcher Zweck? Wann endlich wirst du dich mir ganz enthüllen ...?« — »Wann du ganz reif sein wirst, mich ganz zu begreifen. Es fehlt noch viel. Solange du mit Inbrunst die Lippen an jene Stücke alten Eisens pressest, die man dir für die Ketten des Fischers vom Galiläischen Meer ausgibt, der vielleicht den Tiber nie gesehen ... so lange gewiß nicht. Sieh, mein Sohn, ich wiederhole: Mit leichter Mühe könnte ich dir im Wege der Logik, der Philosophie die Unmöglichkeit der ganzen Kirchenlehre dartun.« Julian schüttelte ernsthaft die dunklen Locken, die ihm in diesen Monaten der Freiheit gewachsen waren. »Du bezweifelst das? Gut, eben deshalb würde mein Sieg in dem Streit mit Gründen nichts helfen. Du würdest mir sagen: ›Ich kann dich nicht widerlegen, aber ich glaube doch.‹« — »Wahrscheinlich! Gewiß! Ja!« — »Darum sollst du die Unwahrheit der Kirchenlehre nicht erlernen, nein, erleben.« — »Oder ihre Wahrheit, lehrte Johannes!« dachte Julian bei sich, aber er sagte es nicht. — »Dann erst bist du reif für meine Offenbarungen und für meine Pläne. Ein gut Stück Kirchenlehre hat dir jene Nacht doch schon aus der Seele gerissen.« — »Ja leider, leider!« klagte Julian, die Augen schmerzlich schließend. »Allein, das ist ein Kloster, fern in Kilikien. Hier an der Stätte, die nach Jerusalem die heiligste auf Erden, hier, nahe den Gräbern der Apostelfürsten, hier, wo der Nachfolger Sankt Peters wirkt und waltet, hier wird sich diese Lehre rein und reinigend bewähren. Seit ich hier wandle, fühle ich meinen Glauben wieder erstarkt. Das heißt ...«, er stockte.
»Das heißt«, fuhr Lysias an seiner Statt fort und schlug mit der Hand auf den Schild eines ehernen Julius Cäsar, zu dessen Füßen sie eben auf dem weiten, statuengeschmückten Platz vor dem Theater des Marcellus standen, »das heißt: der da stört dich in deinem Glauben und jener da drüben« — er wies auf einen marmornen Trajan — »und dieser dort, der Germanenbesieger und Philosoph Marc Aurel — ja, auch der Jupiter und der Mars des Kapitols und Hera und Pallas Athene und dort — der Herrlichste von allen: Phöbos Apollo, der ewige Jüngling, der unbesiegte Sonnengott!« Und aus des Mannes harten Augen leuchtete eine Begeisterung, wie sie der Jüngling nie an ihm gesehn. »Woher weißt du ...? staunte er.
»Oh, ich weiß noch mehr! Mir gaben die Götter, in den Seelen der Menschen zu lesen. Wohl zieht es dich zum Grabe Sankt Peters und zum Hause seines Nachfolgers. Aber stärker doch bewegen dir, seit du hier weilst, die jugendliche Seele, die alten Helden und die alten Götter Roms. Ich wußte das voraus! Und sieh, das ist der zweite Grund, aus dem ich dich bei dem ersten Schritt in die Welt aus jenem Kloster gerade hierher geführt. Du sagst dir hier in schlummerlosen Nächten: »Was ward aus Rom, da es den alten, großen, schönen, erhabenen Göttern diente, durch die Scipionen, Cäsar, Trajan, Hadrian? Die Herrin der Welt! Was ward aus Rom seit Constantin ...? — Sein Name sei gepriesen! — Und Constantius, der Liebling Christi«, sprach er plötzlich ganz laut. »Gott verleih ihm Sieg und langes Leben.«
»Was hast du auf einmal?« — »Jener Priester, er folgt uns schon lang, ist ein bezahlter Angeber, ein Späher des Obereunuchen Eusebius. Ich kenne ihn. Aber er weiß nicht, daß ich ihn kenne und daß ich auch zu den Günstlingen des frommen Imperators zähle.« — »Du?« — »Was also«, fuhr Lysias wild leidenschaftlich fort, »was ward aus Rom, seit Constantin, abgefallen von den Göttern unserer Väter, den Legionen die alten Siegesadler nahm und sie ersetzte durch ...« — »Das Labarum!« unterbrach Julian ehrfürchtig. »Das heilige Zeichen des Kreuzes und den Anfang des Namens Christi.« — »Ein Zeichen, das nichts von Romas alten Siegen weiß! Unter dem die Legionen geschlagen werden von Parthern und Persern am Tigris, von Jazygen am Ister, von Franken und Alemannen ...«
»Franken? Alemannen? Was sind denn das für Leute?« forschte der Jüngling, hochaufhorchend.
»Unter neuen Namen alte Feinde: Germanen des Rheins. Gesteh es nur, deine Träume sind, seit du hier weilst im Schatten des Kapitols, mehr von Waffen als von heiligen Ketten, mehr von Cäsar als von Christus erfüllt. Deshalb gerade erbat ich mir vom Abt — du weißt jetzt, warum er gewähren muß, was ich ernstlich fordere! — dich, den kaum Genesenen, zum Begleiter, als er mich hierher an den römischen Bischof sandte. Dankst du mir nicht, daß ich dir das ewige Rom gezeigt?«
»Ach wie heiß! Eine ganze Welt ist mir hier neu aufgegangen. Mir schwindelt manchmal! Nicht all die Fülle von Gestalten kann ich bewältigen, die hier aus Tempeln und Palästen und Bildsäulen auf mich eindringt. Ich verstehe noch nicht alles.«
»Wie solltest du! Haben sie dir doch im Kloster von der Geschichte der Hellenen und der Römer nur beigebracht, was dich mit Abscheu vor ihren Lastern erfüllen sollte. Was erfuhrst du von der Herrlichkeit ihrer Götter, ihrer Waffen, ihres Heldentums, ihrer Staatskunst, ihrer Welteroberung? Nichts. Aber Geduld! Bald sollst du Roms Geschichte von Männern lernen, nicht von Priestern.« — »Dort? Im Kloster?« — »Nie sieht dich das Kloster wieder!« — »O Dank! Mir graut davor.« — Da traf ihn ein lodernder Blick. »So heb es auf. Und alle seinesgleichen.« — »Lysias! Du redest irr. Ich!« — »Willst du es?« — »Ich wollt es, wenn ...« — »Willst du es?« — »Ja, ich will!« — »So wirst du's tun. Denn wisse: du — Liebling der Götter — wirst einst alles können, was du wollen wirst.« — »Ich verstehe dich nicht, Meister.« — »Solange der Papst dein Meister ist, bin ich es nicht.«
Julian schwieg eine Weile nachdenklich. »Wohin führst du mich?« fragte er dann erstaunt. »Du bogst längst ab von dem Wege nach dem Kapitol. Wir müssen weit darüber hinaus sein, im Osten der Stadt! Wohin gehen wir?« — »Zum Heiligen Vater.« — »Zu Liberius selbst?« rief der Jüngling, in Ehrfurcht erschauernd. Er blieb stehen. »Er soll so weise sein, so klug sein ...« — »Wie die Schlangen. Aber nicht ganz so harmlos wie die Tauben. Übrigens hat sich der Galiläer geirrt; wie bei jenem Feigenbaum, an dem er — der Allwissende! — Feigen zu finden glaubte und nicht fand; denn weder sind die Schlangen klug noch die Tauben sanft. Komm hier hinab, diese Stufen.« — »Und so demütig ist er, so fern von jedem weltlichen Gedanken, des Imperators treuester Untertan.« — »Halt! Stolpere nicht. Hier wird es dunkel. Da, halte dich an meine Hand.« — »Wo sind wir?« — »Auf dem Esquilin, dem Speisemarkt der Livia, in der Krypta der neu vom Papst errichteten Basilika, der Liberiana, wie sie schon im Volke heißt. Hierher hat er mich beschieden. Er hat mir Wichtiges zu vertrauen, einen Auftrag. Und einen im Urkundenwesen, in Rechtsschriften gewandten Geistlichen sollte ich mitbringen. Du hast, unterwiesen von dem Abt, dem ehemaligen Juristen, die Verträge des Klosters verfaßt, viele Jahre lang. So durfte ich dich wählen. Aber daß du der Vetter des Imperators bist, dem Gott ... nun, sagst du die Formel nicht mehr auf?« — »Nein! Ich mag nicht. Sie ist Lüge.« — »Das verschweige sorgfältig.« — »Die Vetterschaft ist weder Ruhm noch Glück! Aber weshalb nicht im Sankt Peter? Weshalb dies Geheimnis?« — »Man soll nicht erfahren von unserm Verkehr. Halt, wir sind am Ziel. Es hieß: ›Zwölf Stufen, dann zwölf Schritte nach rechts. Dann an dem Holzverschlag der Mauer eine vorspringende Scheibe...‹ Hier ist sie! ›Diese einwärts drücken‹, sie gibt nach! — eine schmale Pforte tut sich auf; sieh: Licht schimmert uns entgegen; folge mir, tritt ein.«
Sie standen in einem halbkreisförmigen Raum; er entsprach der Apsis oben in der Basilika. Die Mosaiken an den Wänden waren bereits verdunkelt durch den Qualm einer Öllampe, welche hier nie erlöschen durfte. Die christlichen Symbole: der Fisch, das Lamm, der Gute Hirte, kehrten in eintöniger Reihenfolge immer wieder.
Da rauschte der dunkelbraune Vorhang, der den Abschluß des Halbkreises verhüllte, und vor ihnen stand in reichem bischöflichen Ornat eine stattliche Gestalt. Die beiden sanken sofort in die Knie; sie küßten den Saum des goldgestickten Gewandes. »Erhebt euch, meine Söhne, und empfangt den Segen des Herrn«, sprach der Papst mit wohllautender, gebietender und doch herzgewinnender, vertrauenerweckender Stimme. Ehrfurchtsvoll ruhten Julians Augen auf den bedeutenden, schönen und vom tiefsten Frieden geweihten Zügen des etwa sechzigjährigen Mannes. Wunschlos gegenüber allem Irdischen, nur auf das Himmlische gerichtet mußte diese Seele sein, das bezeugte das sanfte, wie verklärte Antlitz; die Farbe war zartrosa wie eines Mädchens Wangen.
»In Demut danke ich«, begann die silbertönige Stimme aufs neue, »meinem ehrwürdigen Bruder, dem Abt Konon, daß er, meinem Wunsche gemäß, gerade dich, o Presbyter Lysias, zur Ausrichtung eines Geschäftes mir zugesandt hat, das der armen Magd Christi, seiner heiligen Kirche, unter dem Segen des Höchsten, zum Heil ausschlagen soll, wie ich hoffe. Vernimm sogleich, um was es sich handelt. Dieser Knabe ist also verlässig?« — »Ich bürge für ihn.« — »Das genügt. Die Geheimnisse der heiligen Kirche werden nicht ungestraft ausgeplaudert. Dafür ist gesorgt«, fügte er langsam bei.
Da erschrak Julian heftig. Das war ein ganz anderer, ein scharfer Ton gewesen. Diese finstere Drohung schien nicht aus jener verklärten Seele aufgestiegen. Aber nun, gleich wieder ganz sanft und friedlich geworden, ließ sich Liberius auf eine Art Thronsitz nieder, vor dessen Stufen die beiden Besucher ehrerbietig zu ihm emporblickten. Er begann jetzt in jenem weichen, demutvoll klagenden Tonfall, der so bezeichnend ist für die Sprache der Kirche. »Unleidlich ist es, in dem Herrn geliebte Brüder, daß nicht einmal in dieser Stadt, die der Herr gewürdigt hat, die Gebeine der Apostelfürsten zu umschließen, dessen Nachfolger das mindeste zu sagen hat. Der Papst, der das von Gott verliehene Recht hat, den ganzen Weltkreis zu beherrschen, muß wenigstens in dieser seiner Stadt gebieten, die sein Haus, in deren Weichbild, die nur sein Hausgarten ist. Von hier aus mögen meine Nachfolger dann den ›orbis‹ erobern; ich beginne mit der ›urbs‹: mir nur die Stadt, ihnen dann einst — die Welt.«
»All das ist streng logisch«, sprach Lysias, »ist von jener großartigen Unbeugsamkeit, Unerbittlichkeit des Gedankens, welche die Kirche allunüberwindlich macht, sobald man ihr den ersten Heischesatz eingeräumt hat. Siehst du das ein, mein junger Freund?« Flammende Hitze war bei des Papstes Worten aufgestiegen in Julians bleiche Wangen; staunend hatte er die großen dunklen Augen auf den Redner geheftet. Jetzt, auf die Frage des Lysias hin, wollte er seinem Widerspruch stürmisch Ausdruck geben; allein, er bemerkte die scharf warnende Miene des Freundes. So bezwang er die heftige Wallung und brachte nur die verhaltenen Worte hervor: »Gewiß! Wenn man den Vordersatz zugibt. Allein ...«
»Du zweifelst, Knabe?« herrschte ihn der Bischof an. »Lerne glauben, ohne zu zweifeln; hören und gehorchen werde dir eins. Noch wenig gereift hat ihn deine Zucht, Lysias.« — »Vergib ihm! Er ist noch gar jung, noch ungebrochen der natürliche sündhafte Mensch in ihm. Die Vernunft ...« — »Diese Buhle des Satans!« — »Zumal aber der weltliche Sinn hält ihn noch gefangen, die stolze Freude an Staat und Staatsgewalt. Ist er doch, wie ich dir schrieb, einem Geschlecht entstammt, das wiederholt hervorglänzte in der Geschichte dieses Römerreiches ...« — »Des heidnischen! Von allen Sünden und allen Dämonen beherrschten!« — »Aber doch des Großartigsten«, wagte Julian einzuwerfen, »was bisher Manneskraft und Heldentum geschaffen haben auf Erden.«
»Mag sein, kühner Weltling! Denn die Kirche, die unvergleichbar großartigere, hat nicht sündige Menschenkraft, sie hat der Heilige Geist geschaffen. Und — sehen wir davon ab! — welchen Wert haben im Vergleich mit der Kirche Recht und Staat und des Staates ganze sogenannte Herrlichkeit?« — »Heiliger Vater«, wagte der Jüngling schüchtern zu fragen, »haben nicht doch auch Staat und Vaterland ihre Berechtigung? Von jeher haben die Menschen in dem Helden, der für sein Volk kämpft, ein Herrliches bewundert ...« — »Heidnische Menschen.« — »Die Dichter und die Geschichtsschreiber von Homer und Herodot bis auf unsere Tage ...« — »Fleischlich, weltlich Gesinnte. Sie preisen die rohe blutige Gewalt.« — »Aber die Pflege des Rechts durch seine Juristen ist doch der Stolz des römischen Volkes! Und sagt nicht selbst der Apostel Paulus: ›Alle Obrigkeit ist von Gott geordnet‹?« — »Du wähnst in deiner Eitelkeit, mich in die Enge zu treiben, junger Mönch; aber du zwingst mich nur, noch tiefer einzudringen, dein Irrsal an der Wurzel zu fassen und es dir ganz aus den Gedanken zu reißen. Recht und Staat! Wohl; der Apostel nennt auch sie von Gott geordnet, und jedermann soll Untertan sein der Obrigkeit, die nun einmal Gewalt über ihn hat. Allein, sagt er etwa, daß dies erfreulich sei? Mitnichten!
Freilich: Recht und Staat und Obrigkeit sind notwendig. Unentbehrlich sind sie, jawohl! Aber nicht ein notwendiges Gut wie Kirche und Glaube, nein, wie die Krücke dem Lahmen, wie die bittere — oft an sich giftige — Arznei dem Kranken oder — gut für die andern! So wie der Maulkorb dem beißenden Hund, wie die Fessel dem Tobsüchtigen, wie der Käfig dem reißenden Tier nicht zu seinem, sondern zu der andern Vorteil aufgezwungen wird. Ein notwendig Übel sind Recht und Staat. Bevor der Lahme lahmte, bedurfte er der Krücke nicht, und gesundet er, fort wirft er den verhaßten Notbehelf, der ihn an seine Entwürdigung gemahnt. Der Gesunde nimmt die ekle Arznei nicht, und der Genesende speit sie aus seinem Munde.«
»Und das soll — ähnlich — gelten von Recht und Staat?« — »Gewiß, du allzu weltlicher Mönch! Oh, ich will sie dir zerschlagen, Recht und Staat und Heldentum, diese deine hohlen Götzen von Ton, daß du ihre Scherben mit Verachtung auf dem Boden von dir stoßest.« — »Darauf bin ich doch neugierig«, dachte Julian, mit kochendem Unwillen im Herzen. — »Waren im Paradiese Recht und Gericht und Staatsgewalt? Waren Krieger und Richter erforderlich, ja nur denkbar, solang der Mensch vollkommen war, wie Gott ihn geschaffen und gewollt? Sicher nicht! Erst durch den Sündenfall — also durch den Teufel — ist der Streit um Mein und Dein, ist der schwere Fluch der Arbeit — diese härteste Strafe, die, nach ausdrücklicher Erklärung der Bibel, Gott in seinem Zorn auf den Menschen gelegt — ist Gewalttat und Krieg unter die Menschen gekommen. Erst jetzt schlug Kain den Abel, erst jetzt stritten Abraham und Lot um die Weidegründe. Erst jetzt — also durch den Teufel — wurden Richter unentbehrlich und Krieger. Gott hat sie zugelassen, nun ja, wie der Arzt mit Seufzen den Gelähmten nach der Krücke greifen sieht. Durch den Teufel ist die Sünde, und durch die Sünde sind Recht und Staat gekommen in die Welt, und mit dem Teufel zugleich werden Recht und Staat und Richter und Imperator und deine lieben ›Helden‹ untergehen am Jüngsten Tage in strafenden Flammen. Im Himmel — im vollkommenen Zustand — werden die Seligen wieder so wenig des Rechtes, des sündhaften Staates bedürfen als weiland im Paradies. Fluch daher, wie über die Sünde selbst, so über Recht und Staat, ihre Nachkrankheiten! Ja, die Heiden, deren höchstes Gut das Vaterland, deren Licht die versündigte, verteufelte Vernunft, deren Heimat diese Erde; die mögen auf Recht und Staat und Heldentum das Schwergewicht all ihres Strebens legen. Aber gerade dies ist sündhaft, ist durch und durch sündhaft! Denn das Diesseits zieht vom Jenseits, das Fechten zieht vom Beten, das Richten vom Büßen ab. Des Christen Heimat ist nicht auf dieser Welt. Die Erde ist sein Kerker; er flieht, er haßt, er verachtet diese Weltlichkeit, die vom Fluch der Sünde, vom Teufel durchdrungen ist. Er wünscht sehnlich ihren baldigen Untergang herbei mit allem Pomp und Stolz von Staat und Recht, mit Richterstab und Heldenschwert! ›Eigentum?‹ Des Menschen Sohn hatte nichts, wohin er konnte sein Haupt legen! ›Strafrecht?‹ Christus lehrt, wer dir den Mantel raubt, dem gib das Wams dazu, wer dir die linke Wange schlug, dem biete die rechte zum Schlage dar. ›Richtertum?‹ ›Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet.‹ Kein Christ darf einen Christen vor Gericht verklagen! Auf den Verbrecher soll den ersten Stein nur der Schuldlose werfen: also weder Richter noch Henker will Christus! All das sind Ausgeburten der durch den Sündenfall verdunkelten Vernunft. Ich wiederhole: Der Christ, der im Jenseits seine Heimat hat, darf, soll, kann kein Herz haben für die vergängliche, dem Untergang geweihte, versündete Welt und ihren Staat. Möge der bald mit dem Teufel zugleich in Flammen untergehen: es ist seine gerechte langverwirkte Strafe.« Hier machte der Erzürnte eine lange Rederast. Er suchte offenbar nach einem Übergang und fand ihn nicht.
In Julian tobte der leidenschaftliche Widerspruch, aber das warnende Auge des Lysias hielt ihn in unwilligem Schweigen gebannt.
»Einstweilen aber«, fuhr endlich der Bischof fort, »solang das Reich Gottes, das himmlische, nicht gekommen ist, solang die Kirche auf Erden den als ein Übel von Gott einstweilen noch geduldeten Staat neben sich ertragen muß, einstweilen muß doch schon — in aller Demut! — dafür gesorgt sein, daß das Oberhaupt der Kirche nicht jenen sündhaften Weltlingen in Ohnmacht zu Füßen liegt. Es muß wenigstens der Anfang geschaffen werden auch einer weltlichen Herrschaft der Kirche, die erste Stufe muß gelegt werden zu einem stolzen Bau, auf dessen Spitze der römische Bischof dereinst die oberste Gewalt, auch die weltliche Herrschaft, üben wird auf der ganzen Erde.«
Hoch auf horchte Julianus. Der Papst bemerkte seinen fragenden Blick. »Ja, auch auf Erden! Was ich binde oder löse, soll auch auf Erden schon gebunden sein oder gelöst. Wie kann ich binden und lösen — auch auf Erden! — ohne irdische Macht? Jeder heidnische Centurio des Imperators hat mehr Befehlsgewalt in den Straßen Roms denn der Nachfolger Petri. Das muß anders werden.«
Einen raschen, warnenden Blick warf Lysias auf den jungen Mönch. »Ich staune doch!« sprach dieser. »Mit welcher Demut hast du, erhabener Vater, noch bei dem letzten Eintritt des Imperators — man schrieb es uns in das Kloster — dich den Knecht ...«
»Ei, es ward mir schwer genug, das Haupt der Kirche, die da heilig ist, zu beugen vor dem unheiligen Haupte des unheiligen Staates. Aber noch — noch kann ich meine Ansprüche nicht den Laien zu erkennen geben; denn noch kann ich sie nicht beweisen. Und um den Beweis zu beschaffen, deshalb hab ich dich, o Presbyter, die Schärfe deines im Urkundenwesen und im weltlichen Recht vielbewanderten Geistes berufen. Der gottselige Abt Konon hat dich mir auf das wärmste empfohlen. Und deshalb auch hab ich diesen noch Unreifen zugelassen zu unserer Unterredung, auf deinen brieflichen Wunsch; du rühmtest, er sei geschickt im Schreibwerk und mit der Sprache der Rechtskundigen im Kloster wohlvertraut gemacht worden. Wohlan, hier mag der Anfänger seine Erstlingsleistung schaffen: in dem Dienst der Kirche.«
Mit äußerster Spannung hefteten sich die dunklen Augen Julians an die schmalen, scharf geschnittenen Lippen des Bischofs; er brachte kein Wort hervor.
An des Sprachlosen Statt sprach Lysias: »Er wird es sich zu höchster Ehre rechnen, auch im Unscheinbarsten dir, Heiliger Vater, zu dienen. Vergib sein seltsam Schweigen; die Ehrfurcht, die tiefe Scheu vor deiner hohen Würde bindet ihm die Zunge. Wohlan, sprich es aus: Was soll ich, was soll der Jüngling für dich tun?« — »Eine Urkunde schreiben.« — »Gern. Welcher Art?« — »Eine Schenkungsurkunde. In aller Form Rechtens, hört ihr? Scharf, genau, mit Einfügung aller Klauseln, die ein solches Rechtsgeschäft unanfechtbar machen für jedermann.« — »Das soll geschehen. Allein, weshalb wählst du hierfür nicht ...?« — »Einen weltlichen Rechtskundigen?« lächelte der Bischof, »aus guten Gründen! Es handelt sich um eine Schenkung des frommen Imperators Constantin, dem Gott nun im Himmel seine Verdienste um die Kirche in ewiger Seligkeit vergilt.«
Julian schoß eine Blutwelle in das Antlitz.
»Ihr werdet eine Urkunde aufsetzen, in welcher der Imperator zum Dank für die wunderbare Heilung von dem Aussatz meinem Vorgänger, dem wundertätigen Sankt Silvester, und dem römischen Stuhl für ewige Zeiten zu eigen schenkte die Stadt Rom und das Weichbild von Rom im Umfang von soundso viel Miliarien (... das werd ich noch nachtragen ...!), mit allen Herrschaftsrechten der imperatorischen Gewalt; also mit dem Recht, eigne Truppen zu halten, Krieg zu führen, Verträge zu schließen, Frieden zu machen, Gerichtsbarkeit in Straf- und in bürgerlichen Sachen, Verwaltungshoheit, Münz-, Zoll- und Steuerrechte, Weg- und Brückenrecht; kurz, alle Hoheitsrechte, wie sie jetzt der Augustus übt.«
Ohne die Willensabsicht des Bischofs irgend zu verstehen, starrte Julian ihn an. Sogar Lysius faßte nicht gleich den Inhalt dieses Auftrags. »Ich staune! Solch unberechenbar weites Zugeständnis hat der Imperator der Kirche ...?«
»Ja, der Aussatz ist ein schweres Leiden und nur durch ein Wunder heilbar!« — »Und aufsetzen? Abschreiben meinst du wohl, Heiliger Vater?« Unwillig erwiderte dieser: »Schwerfälliger! Wozu abschreiben? Das könnte ich doch selbst.« — »Ich verstehe nicht ganz ...« — »Verfassen sollst du die Schenkung. Der Imperator trug sich, ich weiß es — oder ich will lieber sagen: ich vermute es — mit ähnlichen Gedanken. Mein Vorgänger Silvester drang in ihn mit solchen Bitten. Der Tod Constantins kam der Erfüllung zuvor. Wohlan! Verbessern wir sehend den blinden Zufall zu frühen Sterbens! Ergänzen wir, was der Imperator wollte, wollen sollte, wollen mußte, zum Heil seiner Seele und der Kirche. Ihr verfaßt den Rechtsinhalt der Schenkung. Seine Unterschrift ..., die werde ich besorgen; ich kann sie machen, nachmachen ... so gut ... wie er selbst ... Aber was ist dem Knaben ...?«
»Nichts! Nur eine Ohnmacht!« sprach Lysias, den Sinkenden in seinen Armen auffangend. Der stöhnte noch einmal leise. Dann vergingen ihm vollends die Sinne.
Als der Jüngling die Augen wieder aufschlug, sah er sich in einem ihm unbekannten Gemach. »Wo bin ich?« fragte er Lysias, dessen Blick gespannt auf dem bleichen Antlitz ruhte.
»In Sicherheit vor den Menschen und nun — den Göttern sei Dank! — auch in Sicherheit vor dem Tode. Du rangest in diesen Tagen und Nächten schwer um dein Leben mit den Mächten der Finsternis. Aber die guten Götter des Lichtes und des Gedeihens haben mein Flehen erhört. Nachdem du heute — es ist der dritte Tag — das Bewußtsein voll wiedergefunden, ist die Krankheit gebrochen; es war ein Rückfall in das hitzige Fieber, das dich bei der Entlarvung der Mönche ergriffen hatte, erneut durch eine ähnliche Erregung. Du bist abermals genesen. Aber nun ist deines Bleibens nicht mehr in Rom. Du mußt fort — heute noch. Fliehen!«
»Fliehen! Warum? Vor wem?« — »Unseliger! Hast du vergessen, was geschehen? Dort in der Krypta!« — »O nein!« entgegnete der Bleiche, sich schaudernd aufrichtend. »Der Papst! Die Urkunde — die Fälschung, die er forderte ...« — »Still! Nicht so laut! Wer weiß, ob seine Lauscher nicht sogar bis hierher ...« — »Was ist das für ein seltsamer Raum? Unter der Erde, wie es scheint. Nur ein schmaler Lichtstreif fällt von oben durch mächtige Gewölbequadern. Und welche Bilder sind rings eingehauen in die Wand! Sonnen! Viele Sonnen! Ein ägyptischer Krieger, nein, ein Gott mit einem Sonnenschild. Und dort ... das ist Phöbus Apollo! Wo bin ich?«
»In dem geheimen Gewölbe des Apollotempels nahe der Brücke Hadrians.« — »Wie? Unter den zähesten Heiden? Ich staune.«
»Du wirst bald noch stärker staunen. Versuche, ob du das Lager verlassen kannst. Siehst du! Es geht! So wird dich ein Maultier bei Einbruch der Dunkelheit davontragen, ehe deine Verfolger ...« — »Aber wer verfolgt mich?« — »Der Heilige Vater. Er hat Verdacht geschöpft, du seiest doch noch nicht ganz reif gewesen für seine Pläne. Er ließ dich an deinem Krankenlager im Haus unseres Gastfreundes, wohin ich dich brachte, scharf überwachen. Mit Mühe gelang mir's, nachdem ich durch vertraute alte Freunde dich hierher geflüchtet, seine Späher glauben zu machen, du seiest — in einem Fieberanfall — mir entsprungen. Ich verabschiedete mich bei dem Heiligen Vater unter dem Vorwand, dich zu suchen. Du seist mir für jene Urkundenverfassung unentbehrlich.« — »Was kann er wollen? Doch nicht mich morden?« — »Das ist nicht nötig. Aber auf immerdar für jedes Menschenauge verschwinden lassen in einem der vielen Klöster, über die er unbedingter gebeut als der Imperator über seine Kastelle. Schon mancher ist so ... verloschen, spurlos. Du aber sollst nicht, du Stern der Hoffnung für mich und für das Römerreich, ja für die Götter selbst, erlöschen in der Nacht eines Zellenkerkers.« — »Nein! Jetzt will ich leben — wirken! Ich will ihnen zeigen, diesen Priestern ohne Vaterland, ohne Staat ...« — »Rege dich nicht auf. Spare deine Kräfte. Du wirst sie brauchen. Denn dein Weg ist weit.«
»Wohin ...?« — »In die Freiheit.« — »Aber ... der Imperator? Wird er nicht alsbald erfahren, daß ich nicht wieder in das Kloster ...?«
»Bei dem Imperator, in dem ganzen Palast ist wieder einmal einer jener plötzlichen, rätselhaften Umstände eingetreten, die nicht eben selten sind. Wieder einmal ist zurückgedrängt der Einfluß seiner bösesten Geister: der Eunuchen und des Präpositus des Schlafgemachs, des elenden Eusebius, des bittersten Feindes deines Hauses. Der Imperator selbst hat befohlen, in vollem Wechsel der Gesinnung oder doch der Maßregeln — niemand begreift die Ursache —, daß du das Kloster vertauschen sollest mit der Stadt Macellum in Kleinasien.« — »Also bin ich frei!« jubelte der Jüngling. Dieser Gedanke schien ihm neue Kräfte zu geben; er sprang auf.
»Nicht nach des Tyrannen Meinung! Die Stadt ist eine Feste, und du wirst in ihren Mauern bewacht sein wie bisher in dem Klostergarten. Aber du sollst einen Lehrer erhalten: für weltliche Dinge.« — »O welche Freude!« — »Selbstverständlich einen eifrigen Christen. Aber getrost. Ich darf ihn dir auswählen; mir überließ das ... nun, sagen wir, ein Ratgeber des Imperators.« — »Und du wählst?« — »Mich selbst. Allmählich bist du reif geworden, mehr zu vernehmen von meinem Gotte, ja nun darf ich es aussprechen: von meinen Göttern.« — »O mein Vater! Ich folge dir, wohin du führst.« — »Nur noch kurze Zeit! Alsbald wirst du mich führen. Mich und die Menschheit: zum Siege, zum Lichte, zum Siege des Lichts und aller großen Götter.«
Sobald es völlig dunkel geworden, holte Lysias, der sich in die Stadt begeben hatte, den noch Wankenden ab aus seinem Versteck; beide warfen über die Mönchskutten lange Soldatenmäntel, die der Presbyter mitgebracht hatte. Durch menschenleere Gassen und Gäßlein führte der Ortskundige an das Pränestinische Tor im Osten der Stadt.
Der ägyptische Söldner, der hier Wache stand, senkte ehrerbietigst den Speer, als ihm Lysias ein Wort zuflüsterte, und ließ sie vorübergleiten.
Wenige Schritte vor der Umwallung lag seitwärts, rechts von der breiten Via Gabiana, ein ansehnliches Grabmal in einem kleinen Haine von Pinien: Die Obelisken zu beiden Seiten, die Sphinx als Wächterin davor, der Ibis als häufigstes Symbol wiesen auf das Land des Nils.
Lysias schlug in die Hand; da tönten leise Schritte aus dem Wäldchen. Ein Neger in der Tracht des Morgenlandes führte ein Roß und ein Maultier auf die Straße, half schweigend den beiden aufsteigen und verschwand, nachdem er ehrfürchtig vor Lysias die Arme über der Brust gekreuzt hatte. Der trieb beide Tiere zu raschem Ritt, bis sie die Stadt eine gute Strecke hinter sich hatten. Kein Wort sprachen sie. Mit stillem Staunen sah der Jüngling auf den von solchen Geheimnissen umgebenen Meister. Nun zog der die Zügel und hielt: »Hier wollen wir kurze Rast halten, mein Sohn«, mahnte er. »Steig ab und setze dich neben mich hier auf den Rasen und lehne den Rücken an diesen Meilenstein. Du bist noch recht schwach! Da, trinke von diesem Wein, du bedarfst der Stärkung. Ich binde die Tiere an jenen Ölbaum.«
Julian sah wie träumend um sich her, dann empor gen Himmel, wo ungezählte Sterne prachtvoll leuchteten. Alles deuchte ihm so rätselvoll.
Es war eine milde, warme Septembernacht; der Mond stieg eben im Osten aus dem niederen Buschwald empor und übergoß die weite Ebene mit seinem feierlichen Licht. Alles still, nur zuweilen hoch in den Lüften eines ziehenden Wandervogels Ruf. Der Jüngling saß regungslos, wie ein Verzauberter.
»Schläfst du, mein armer Knabe?« fragte Lysias, sich nun neben ihm niederlassend. »Nein, Meister. Ich wache und staune; und kann kein Ende finden des Staunens. Was hab ich erlebt, wie bin ich verwandelt seit wenigen Monden! Wie Schuppen gleitet es von meinen Augen. Aber am meisten staune ich über dich, du Mann der Wunder, der Geheimnisse. Sprich, bist du ein Zauberer, einer jener Magier deiner Heimat, dort am heiligen unerforschten Nil? Du hast bisher alle meine Fragen über dich, über die unfaßlichen Widersprüche in dir abgewiesen, hast mich stets auf die Zukunft verwiesen. Diese Zukunft, wann endlich wird sie Gegenwart?«
Der Gefragte antwortete nicht gleich; er zog aus der Brusttasche eine längliche Rolle, die mit Sternen, mit den Himmelszeichen, mit krausen, wirren Schnörkeln, mit Linien in verschiedenen Farben dicht überdeckt war. Sinnend blickte er hinein, sah dann, leise rechnend, auf gen Himmel, folgte mit dem Finger auf dem Papyrus mehreren Strichen und hob nun erst an: »Ja, mein Sohn, jetzt kam die geweihte Stunde der Enthüllungen. Günstig stehen alle Sterne, alle Zeichen winken Heil; sieh, diese goldenen Striche enthalten dein Horoskop.« — »Wie kommst du dazu, o Meister. Wer hat ...?« — »Ein Freund, ein Lehrer, wenn du willst, wenigstens in Sternkunde, der zugleich ein treuer Freund deiner Eltern war, hat mir die Stellung der Gestirne im Augenblick deiner Geburt anvertraut, sobald ich ihm schrieb, daß ich dich in jenem Kloster gefunden. Denn du warst ja dort aller Welt verborgen. Nur jener blödgläubige Johannes — auch ein Bekannter deiner Eltern — hatte dich vor mir entdeckt.« — »Und wer ist jener Freund meiner armen Eltern, der sich um den eingesperrten Waisenknaben kümmerte?«
»Das bleibt geheim. Er will, daß sein Name nie genannt wird. Auf dem unverbrüchlichen Geheimnis beruht seine Macht.« — »Seine Macht? Welche Macht?« — »Die Macht, dir zu nützen, dich zu schützen. Ihm offenbar verdankst du den plötzlichen Umschlag ...« — »Also lebt er am Hofe?« — »Frage nicht weiter. Aus deinem Horoskop nun, o geliebter Sohn, ergab sich mir, was mich im tiefsten Kern erschütterte: daß dein Geschick und das meine, das meiner ... meiner Familie unauflöslich miteinander verflochten sind.« — »Das hat sich schon bewährt, mein Lehrer und Erretter«, sprach Julian, dankbar seine Hand ergreifend und an die Lippen ziehend.
»Aber mehr noch: Aus deinem Horoskop geht zweifellos hervor, daß du, ein Liebling der großen Götter, wie nur etwa noch Alexander oder Cäsar ...« — »Alexander oder Cäsar«, wiederholte Julian in Bestürzung, weit die Augen aufreißend und in die Sterne schauend. »Berufen bist zu allergrößten Taten; ja zu der größten, die getan werden kann, sagen die Sterne.
Welche aber ist die größte aller möglichen Taten?
Das konnte, mußte ich leicht mir selber sagen! Nachdem die Lehre jenes jüdischen Schwärmers die alten Götter aus ihrer Herrschaft vertrieben hat: Was ist die größte Tat? Du wirst die Christenkirche stürzen und die Olympier rächen und erneuern.«
Da sprang Julian auf: »Aber ich glaube ja nicht an die Olympier.« — »Glaubst du noch an Christus?« — »Nein! Oder ja, ja doch! Nein! Ich ... ich weiß es nicht. Mir schwindelt.« Er sank wieder gegen den Meilenstein. »Ich kann nicht mehr denken.«
»Du sollst jetzt nicht denken. Das heißt: nicht über diese schwersten Dinge. Du sollst, du mußt erst bei mir denken lernen.« — »O, mit welcher Heißgier werde ich jedes deiner Worte einschlürfen! Du bringst mir ...« — »Die Freiheit. Die Schönheit. Die Wahrheit.« — »Aber verehrter, großer Meister — du selbst —, wer bist du? Welches Rätsel, welche Widersprüche schließest du ein? Ich lerne dich kennen in jenem Kloster als Priester, als Johannes übergeordnet, als Vertrauten des Abtes, der als ein kirchlicher Eiferer gilt, als Vertrauten sogar des Papstes, und zugleich bist du es, der mir die Augen öffnet, der mir den bisher so felsenfesten Glauben unterwühlt, der du die alten Götter verehrst. Und du hast Freunde am Hof! Du hast in Rom verborgene Freunde. Des Apollo-, des Osiristempels geheime Gewölbe sind dir zugänglich, der Ägypter am Tor beugt sich vor dir, stumme Neger dienen dir. Wer bist du, Lysias?«
»Ptolemäos heiße ich mit meinem wahren Namen. Das heilige Land des Nils ist meine Heimat. Väterlicherseits stamme ich ab von jenem großen Ptolemäos, der Alexanders Feldherr und Nachfolger in Ägypten war; aber die Mutter unseres Stammes ist eine Tochter der Pharaonen gewesen, und alle meine Ahnen sind Söhne und Priester des Sonnengottes und des Zeus Ammon, als dessen Sproß auch Alexander selbst sich fühlte. So haben meine Vorfahren seit unvordenklichen Tagen in Ägypten in königlichen, in priesterlichen, in halbgöttlichen Ehren gewaltet. Rom hat nach der Eroberung des Landes nur die weltliche Macht erworben und sie zum Heile, zur Wohlfahrt unseres Landes verwendet. Gar viel römisch Blut, Töchter der edelsten Geschlechter, haben sich dem Mannesstamm unseres Hauses zugemischt; so bin ich nicht minder Römer als Grieche und Ägypter. Die Größe Roms war auch unsere Größe; unsere priesterliche Herrschaft ward von Rom nie angetastet, vielmehr wurden Osiris und Isis und der unbesiegte Sonnengott am Tiber bald gefeiert wie am Nil. Als Oberpriester des ägyptischen Sonnengottes waren meine Ahnen, ja noch mein Vater, neben dem Statthalter Roms, oft auch vor ihm in der Verehrung des Volkes, die Ersten Männer des Landes! Da — da kam das Gräßliche. Das unertragbar Grausame! Kaum hatte Constantin die Kirchenlehre der Schranken entledigt und ihr sich parteiisch zugeneigt, da mißbrauchten die Bischöfe, die Priester, die Mönche die ihnen gewährte Freiheit zur furchtbarsten Unterdrückung des alten Gottesdienstes. Das Blut der Heiden floß in Strömen, unsere Tempel, unsere heiligen Haine, die Bilder der Götter wurden zerstört, verbrannt, zerschlagen, die Tempelschätze geraubt, den Kirchen zugewendet.
In einem solchen rasenden Ausbruch der christlichen Wut zu Memphis ward mein Vater, der götterweise Bokcharis, als Oberpriester des gesamten Götterdienstes am Nil am meisten von ihnen gehaßt — da er um keinen Preis die Taufe nehmen und nicht die verborgnen Tempelschätze ausliefern wollte — auf das grausamste gefoltert; dann, da er beharrlich blieb, ermordet; ebenso meine älteren Brüder. Unseres Geschlechtes uralte Paläste wurden niedergerissen, ausgeplündert, all unser Vermögen geraubt. Mich, den Zehnjährigen, rettete Tefnach — ein entfernter Verwandter — nur dadurch, daß er versprach, wie er selbst, unter Todesdrohung, die Taufe genommen, nun so mich zum eifrigsten Christen zu erziehen, zum Priester weihen zu lassen. Und die strenge Überwachung des Bischofs zu Alexandria sorgte dafür, daß dies alles geschah — äußerlich. Aber mein Erzieher — ich danke es dir, o Verklärter! — erzog mich im geheimen in dem glühendsten Hasse gegen die Christen, die Mörder meines Vaters, die Räuber unseres Vermögens, die Verderber unserer Götter, die Schänder unserer Heiligtümer. Er weihte mich in alle Geheimlehren, in alle Weisheit und Wissenschaft Ägyptens ein. Wisse: Alle heimlichen Verehrer der alten Götter standen und stehen in verborgenem innigen Zusammenhang. Er war das Haupt dieses geheimen Bundes, dessen Glieder über alle drei Erdteile verstreut sind; und als er starb, schwor ich, als sein Nachfolger, in seine erkaltende Hand: Ich werde nicht ruhen und rasten, bis ich an den tief gehaßten Christen tausendfältige Rache, wilde, heiße, unersättliche Rache genommen und die alten Götter Ägyptens, Griechenlands und Roms wieder eingesetzt habe auf die goldenen Stühle ihrer Weltherrschaft!
Ich habe geschworen, und ich werde es halten: Rache, Rache, fürchterliche Rache!
Und an Stelle der Bischöfe soll in Ägypten vom Kanopos bis Meroë wieder herrschen sein ehrwürdigstes, den Göttern entstammendes Priestergeschlecht: ich selbst und ... mein Haus — und du, geliebter Sohn, den, einen Sproß des verhaßten Hauses der Constantier, die Sterne, nein, die Götter selbst, mir zugeführt haben, neben mir zu kämpfen, zu siegen, zu rächen und zu herrschen im Morgenland und Abendland. Sieh, da schoß am Himmel hin ein Stern, die Götter winken Gewährung. Auf! In den Sattel! Deinem Ziel entgegen!«
Jahre waren verstrichen seit jener eiligen Flucht aus Rom.
In Macellum, der alten, von dem Flusse Sarus umspülten Festung der Provinz Kappadokien, in dem Säulengang des Palatiums — es war ein entgötterter Tempel des Ares — wandelten in vertrautem Gespräch Lysias und Julian; statt der Mönchskutten trugen sie weltliche Gewandung. Der Jüngling war merklich verändert. Er war der Mannheit erheblich entgegengereift. Die Spuren der wiederholten, todesgefährlichen Krankheitsanfälle waren geschwunden, blieb die Gestalt auch zeitlebens eine schmächtige, fast allzu zarte. Das Krankhafte in dem Ausdruck des Gesichtes war jetzt gewichen. Zwar ein suchendes Sehnen lag in den dunkeln schwärmerischen Augen; aber dies Sehnen schien, wenn ein Schmerz, ein süßer, ein geliebter Schmerz zu sein.
Dieser Zug, dieser Ausdruck war neu auf dem Antlitz des Jünglings und so stark ausgeprägt, daß er auch einem minder scharfen Beobachter als Lysias aufgefallen wäre. Dieser begann denn, alsbald nachdem sein prüfender Blick auf Julian geruht hatte: »Aus der Lyra deiner Seele, geliebter Sohn, zittert ein neuer Ton. Eine Saite — eine neue Saite — ist darin aufgezogen ...« — »O Meister!« erwiderte Julianus. Es sollte eine Verneinung bedeuten, aber dies mißlang. Verlegen wandte er das Gesicht zur Seite, er errötete. Gar auffallend war in diesen sonst so bleichen Wangen das plötzliche, lebhafte Einschießen der Blutwellen.
»Du schweigst?« — »Ich staune!« rief Julian. »Oft schon hat mich deine Sehergabe in ehrfurchtsvolle Scheu versetzt. Aber das ist doch das Wunderbarste! Wie — wodurch — vermagst du in meiner Seele zu lesen? Erleuchtet dich wirklich ein Strahl unserer Götter?« Lysias lächelte seltsam, ein wenig unheimlich: »Vielleicht wäre es ersprießlich für mich — mehr noch für dich! —, dich in solchem Glauben zu bestärken; du würdest mir dann immer folgen, blindlings folgen.« — »Das werde ich ohnehin, mein großer Meister.«
»Wer weiß! Wodurch ich in deine Seele zu schauen vermag? Einmal, weil ich, seit bald einem halben Jahrhundert im Kampfe mit den Herrschern der Welt, in gar vieler Menschen Brust zu lesen gelernt habe; vor allem aber, weil ich dich liebe, o Julianus, mit begeisterter Hoffnung auf Rächung und Rettung der Götter. Sieh, diese Liebe ist so zwingend, daß ich auch jetzt wieder, von weiter Ferne, aus Ägypten, zurückgekehrt, sofort zu dir eilte, noch bevor ich in mein eigen Haus eintrat. Dein neues Geheimnis ist mir kein Geheimnis: Du liebst, o Julianus, liebst zum erstenmal.«
»Und für ewig!« rief der Jüngling schwärmerisch. »Auch wenn der unbesiegte Sonnengott meine Seele aus der Asche dieses Leibes, in anderer Hülle, in eine höhere Sphäre auf den goldenen Stern meiner Läuterung entrückt haben wird. Alles an Julian mag er wandeln durch verklärendes Licht, nicht dies Gefühl.« — »Teurer Schwärmer! Also: Du sahst in diesen Wochen meiner Abwesenheit wiederholt ein Mädchen ...« — »Eine Göttin!« — »Sie zog dich an; ihre zarte Schönheit, gerade weil sie dich zu meiden schien.« — »Wahr, alles wahr. Täglich, wenn ich in die Bäder des Aurelianus ging, traf ich an der gleichen Stelle, unter dem Platanenhügel, eine schön geschmückte Sänfte, die, getragen von vier gleich gewandeten Sklaven, abbog nach dem Frauenbad der Amphitrite. Die Fenster waren durch Lattengitter geschlossen. Du weißt, man sieht dann von innen heraus, nicht aber hinein. Eines Tages strauchelte einer der vorderen Sklaven, er ließ die Tragstange los, die Sänfte drohte seitwärts umzuschlagen. Ich sprang herbei, riß sie empor und stützte die Last, bis jener wieder zugriff; dabei war das Gitter in die untere Öffnung herabgeglitten, und ich sah in der Sänfte ...« — »Ein wunderschönes Mädchen.« — »Dunkle, große, seelenvolle Augen ...!« — »Dunkles, reichflutendes Haar, marmorweiße Züge ...« — »Oh, spotte nicht! Denn — durch Zufall — trifft dein Erraten zu. Sie dankte anmutvoll; wie lieblich klang die sanfte Stimme! Ich ... ich erglühte, und doch durchzog mich leise kalter Schauer. Ich wagte nicht, nach ihrem Namen zu fragen: süße Scheu hielt mich ab. In den nächsten Tagen ..., welche Wonne durchrieselte mich; ward, sobald ich in die Nähe der Platanen kam, der Gitterladen herabgelassen, wir wechselten — im Vorüberwandeln — wenige hastige Worte. Der Freigelassene, der die Sklaven führte, schien die Zwiesprache nicht gern zu sehen ...« — »Ein Freigelassener?« unterbrach Lysias verwundert. »Und wie heißt ... hast du den Namen nicht erfahren?« — »Jawohl! Helena! ›Herrin Helena‹ redete sie das Gefolge an.« Lysias nickte stumm. »Nun, und das Ende?« — »Das Ende war ihr plötzliches Verschwinden. Sie hat die Stadt verlassen.« — »Du irrst«, lächelte Lysias ruhig. — »Leider weiß ich es gewiß. Ich hatte mir ein Herz gefaßt ... ich hatte beschlossen, den nächsten Morgen sie selbst — nicht die Sklaven, das widerstrebte mir — zu befragen, um ihre Herkunft, ihre Eltern. Zu rechter Zeit war ich an Ort und Stelle. Alsbald erschien auch die Sänfte, aber nicht nach dem Bade ward sie getragen! Unter unsern Platanen glitt das Gitter herab, eine weiße Hand winkte mir grüßend, ach den Abschiedsgruß! Rechtsab bogen die Sklaven, nach dem Flusse zu; in den Hafen eilten sie. Vor meinen Augen bestieg die Unbekannte ein dort harrendes Schifflein. Das zog die Segel auf und war draußen in der blauen Ferne verschwunden, noch bevor ich den Marmordamm des Flußufers erreicht hatte.« — »Unmöglich! Ganz unmöglich! Vergib! Ich muß in mein Haus! Sofort.« Und verwirrt, bestürzt, wie der Jüngling den fest in sich Geschlossenen nie gesehen, eilte Lysias aus dem Gemach. Zu Julians schmerzlichem Erstaunen ließ ihm der geliebte Lehrer gleich darauf sagen, obwohl gerade erst zurückgekehrt, rufe ihn ein wichtiges Geschäft sofort wieder ab in eine ferne Stadt von Asien, wo Glaubenskämpfe auszubrechen drohten. Vergeblich eilte der Jüngling, Abschied zu nehmen, in die Wohnung des Geheimnisvollen: der war schon aufgebrochen mit seinem ganzen Haushalt.
Wenige Tage nach des Lysias plötzlicher Abreise nahte sich dem Nordtore von Macellum ein stattlicher Zug; glänzend gerüstete Reiter sprengten voraus. Die purpurfarbnen Helmbüsche bezeugten, daß sie der kaiserlichen Leibwache, den Domestici, angehörten. Darauf folgte eine festgeschlossene Sänfte von eigenartiger Gestalt und dunkler Färbung, umwogt von zahlreichen buntgekleideten Sklaven, die sich in dem Tragen der Last ablösten, während den Schluß des Aufzuges abermals berittene kaiserliche Leibwächter in größerer Zahl bildeten.
Die Ankömmlinge hielten in dem Säulenhof des Palatiums. Ein junger Mann steckte neugierig den Kopf aus der Sänfte. Er versuchte auszusteigen, jedoch der Befehlshaber der Wachen schob ihm die Hand von dem Griff der Türe zurück. »Geduld! Ich weiß noch nicht, ob ich dich hier herauslassen darf. Der Eunuch des Imperators trug dessen versiegeltes Schreiben zu dem Präses von Kappadokien! Schon kommt er aus dem Palatium zurück. Nun, was soll hier geschehen?«
Der glänzend gekleidete Palasteunuch erwiderte: »Du darfst ihn hier aussteigen und sich in dem geschlossenen Hof ergehen lassen ... mit ... mit dem andern, den der Präses selbst herbeiholt. Aber — bei Todesstrafe für uns alle! — keinen Schritt aus dem Tore dieses Hauses. Siehe, sie kommen.«
Aus dem Inneren des Hauses traten in das Atrium zwei Männer. Wachsam blieb der ältere stehen. »Wohlan, Julianus, du magst an jene Sänfte gehn.« Staunend, mißtrauisch unterbrach Julian: »Ist es eine Sänfte? Ich dachte ... ein Sarkophag! Ganz schwarz — und über der Türe, grell gemalt, ein weißes Kreuz! Tote bringt man so.«
»Oder Gefangene«, lächelte der Präses. »Aber diesmal ist der Insasse weder das eine noch das andre. Der Imperator in der unergründlichen Güte seines Herzens ...« — »Ja, sie ist unergründlich! Sogar unerfindlich!« spottete Julian leise für sich. — »Hat verstattet, daß du den Reisenden ...« — »Er reist wohl in den Hades?« — »Sprechen darfst, während die Reichspost dem Zuge frische Pferde zuführt. Ich lasse euch allein. Denn ich will nicht hören, was ihr sprecht. Am Ende müßte ich es verantworten!« Er trat zurück in das Haus.
Als Julian vor der Sänfte stand, öffnete der Eunuch deren Tür. Da sprang mit hastiger Bewegung ein Jüngling heraus, wenige Jahre älter denn Julian, und warf sich diesem in die Arme. »Julianus! Mein Bruder!« rief er jetzt. »Denn du mußt es sein! Man sagte mir, du würdest hier gefangengehalten.«
»So bist du Gallus, mein Bruder? Du lebst!«
»Wie du siehst! Und du ...« — »Unsere Mutter, ach die schöne Mutter, lebt sie?« — »Ich weiß es nicht.« — »Unsre Schwester ... Juliana —?« — »Sie lebt. Wenigstens noch vor kurzem ...« — »Wo lebt sie?« — »Ich weiß nicht. Aber vor wenigen Monaten erhielt ich einen Gruß von ihr.« — »Durch wen?« — »Ich weiß nicht, durch eine vornehme Jungfrau, die weder den eignen Namen noch irgend andres sonst sagen wollte ... oder durfte! Sie redete mich an — sie war sehr hold — und sprach: ›Ich soll dich und deinen Bruder Julianus grüßen von eurer Schwester Juliana. Sie liebt euch zärtlich. Ich wohnte lange mit ihr in dem gleichen Hause — oder in dem gleichen Gefängnis‹, lächelte sie.« — »Im Gefängnis!« seufzte Julian. — »So rief auch ich, ergrimmend.« — »Sprich nicht von Grimm gegen Constantius!« mahnte Julian, sich erschrocken umblickend, »wenn du leben willst.«
Aber der Bruder fuhr trotzig fort. »Oh, ich hoffe noch ganz anders zu sprechen! Und länger zu leben als ...! Nun, die schöne Fremde sah meinen Schmerz und beschwichtigte lächelnd: ‹Das Gefängnis war nur ein Kloster.‹« — »Schlimmer als ein Kerker!« knirschte Julian. Nun traf die Reihe des Staunens den andern Bruder. »Was? Wie sprichst du über Klöster?« — »Still! Schweig! Erzähle von Juliana — von dir — wie lebtet ihr all diese Jahre?« — »Von der Schwester weiß ich im übrigen so wenig wie du! Die Fremde sagte nur noch, sie sei eine Zeitlang, zur Strafe, in das gleiche Kloster verwiesen gewesen, in welchem Juliana schon lange gelebt habe. Wahrscheinlich all diese Jahre seit unserer Trennung.« — »Ich bin schon dankbar, daß sie noch lebt.«
»Ich nicht! Wem dankbar? Etwa dem blutigen Tyrannen ...?« — »Schweig, bei Phöbos Apollo! Oder sprich leiser.«
»O dürft ich es ihm in die Ohren schreien, wie ich ihn hasse! Sollen wir ihm danken, daß er nicht auch ein Mädchen gemordet hat? Er, der alle Männer des großen Constantinischen Hauses bis auf uns beide ausgerottet? Sie verschont er; bedroht sie doch nicht seinen Thron. Und was haben wir alle andres verbrochen, als daß wir seine nächsten Verwandten sind? Hat er Juliana doch auch so schwer getroffen, als er konnte, ohne sie zu töten. Er hat ihr das Leben nur geschenkt unter der Bedingung der Ehelosigkeit. Er zittert, wie vor uns, vor ihrem möglichen Gemahl.« — »Ehelosigkeit!« wiederholte sinnend Julian. »Bis vor kurzem hielt ich sie nicht für ein Unheil.« Er errötete und brach ab. »Und die Arme, Schutzlose. Sie versprach alles, was man, unter Drohungen gegen sie und uns beide, für den Fall der Weigerung, von ihr verlangte. Solch abgezwungen Gelübde ist freilich nichtig ...« — »Ich weiß doch nicht«, meinte Julian. »Die Schwester wird sich daran gebunden glauben.« — »Das wollt ich ihr schon ausreden.« — »Aber du selbst, lieber Bruder, wo, wie hast du all die Jahre gelebt?« — »In Castra nigra, einem alten Burgnest fern am Halys, in strengster Überwachung, abgesperrt von aller Welt. Nur durch Zufall, oder vielmehr durch treue Freundschaft gegen unser Haus — erfuhr ich vor einigen Jahren, daß du lebest und ein gar frommer, schwärmerischer Christ seist.« — »Ich war es! Aber durch wen vernahmst du von mir?« — »Erinnerst du dich wohl an einen Mönch, einen Büßer, Johannes, der zuweilen auf seiner unablässigen Pilgerfahrt zwischen Rom und Jerusalem im Haus unserer Eltern zu Nikomedia gastete und rastete?«
»Gewiß! War er doch zugegen in jener blutigen Nacht. Er, zusammen mit einem kleinen buckeligen Arzt — dessen Namen hab ich vergessen! —, hat die Mutter, hat uns drei Kinder gerettet. War er doch in den Jahren, die ich in Jonien verlebte, bevor ich in das heilige Kloster — das verfluchte! — gebracht wurde, der Lehrer meiner Knabenzeit. Ach, mit Schmerz würde er erkennen, wie weit sich seither der Schüler von seinem Lehrer entfernt hat! Ich sah ihn zuletzt, vor Jahren, zu Pfingsten ...« — Das sagte er mir, als er, der Treue, in unermüdlichem Forschen und Suchen entdeckt hatte, daß auch ich noch lebe und in welchem Versteck. Und er erzählte mir viel von dir und deinem edeln, frommen Geist. Wie strahlten dabei die sanften Augen vor Stolz auf dich! Du würdest noch einmal eine Säule der Kirche, meinte er. Und vielleicht lebe auch unsere schöne Mutter noch. So glaube ein geheimer Freund unseres Hauses am Hofe.« — »Der muß freilich sehr geheim sein«, lächelte Julianus bitter. »So geheim, daß man gar nichts von seiner Freundschaft spürt ...« — »Du irrst! Johannes beteuert, daß damals der Mutter, der Schwester, unser beider Leben gerettet worden. Viel mehr als ihm selbst sei das jenem Ungenannten zu danken.« — »An dieser Selbstverleugnung erkenne ich Johannes.« — »Und dieser geheime Beschützer — nie dürfe er mir ihn nennen! — habe ihm unsern Aufenthalt verraten, auch anvertraut, daß aus den eingezogenen Gütern unserer Mutter in Ionien jährlich ein, freilich geringer, Betrag auf Befehl des Imperators abgeführt werde in eine ihm unbekannte Stadt Galatiens, zu Gunsten einer Witwe. Johannes hält es nicht für unwahrscheinlich, das sei unsere Mutter.« — »Was sollte den Imperator zu solcher Gnade bewogen haben?« Gallus zuckte die Achseln: »Johannes wußte nicht! Vielleicht doch eine Regung des Gewissens oder ein Aberglaube; der Tyrann soll ja so furchtsam sein.«
»Oh, unsere Mutter, die geliebte, die heiß geliebte! Noch seh ich sie vor mir stehen, die schönste der Frauen. Ach, ihre Augen! Diese wunderbaren Augen! Wie drang ihr sanfter Blick in die Seele! Ob sie noch leuchten in ihrem weichen Glanz? Und wie gelang es damals wohl Johannes und jenem andern — ich meine, es war ein Arzt, der Bucklige? — uns alle zu retten? Johannes schüttelte den Kopf, befragte ich ihn.« — »Auch mir schwieg er beharrlich hierüber.« — »Der andere tat alles!« erwiderte er ablehnend. »Aber sieh, die Pferde sind gewechselt. Da schreitet schon mein Kerkermeister heran. Wir müssen scheiden.«
»Ach, auf wie lange, geliebter Bruder?« — »Vielleicht auf immerdar!« — »Soll ich dich nur gefunden haben, dich wieder zu verlieren? Nein, ich lasse dich nicht!« Und zärtlich hielt Julian den Bruder umschlossen.
»Scheidet!« sprach der Centurio, näher tretend. »Ich habe strengste Befehle.« — »Aber sag uns wenigstens«, rief Julian tief bewegt, »wohin führst du meinen Bruder?« — »Ich darf es jetzt sagen; zum Imperator selbst.« — »Zum Tod also!« rief Gallus.
Der Centurio zuckte die Achseln, aber der ernste Ausdruck seiner Mienen verriet, daß er keinen Zweifel hege; er schob seinen Gefangenen in die vor ihm niedergesetzte Sänfte. »Leb wohl, Bruder!« rief Julianus ihm nach. Vor des Jammernden Augen ward die Türe der Sänfte zugeschlagen; fort ging in raschestem Lauf der hastende Zug.
Julian, aus der Türe des Hauses tretend, verfolgte ihn mit den Schritten, dann mit den Augen, solange er vermochte, bis das Gewölk weißen Kalkstaubes auf der Legionenstraße alles verhüllte.
Nun versank er in schmerzlich trauerndes Sinnen; er ließ sich auf eine Steinbank neben einem der Grabmäler nieder, wie sie auf beiden Seiten der Straße zahlreich ragten; eine dunkle Zypresse neigte über ihm die Wipfel im Abendwind. Lange saß er so und brütete und grübelte, weshalb die Götter — so dachte und sprach der Schüler des Lysias nun! — die Verfolgung der Unschuld durch das Böse zulassen? Warum siegt das Schlechte, warum leidet das Gute? Er fand keine Antwort.
Da weckte ihn aus seinen Träumen der Hufschlag eilender Rosse, die von der Stadt her nahten.
Ein Häuflein von Reitern, ähnlich dem der Entführer des Bruders, hielt vor dem Palatium. Julian sah es durch das offene Tor. Der Führer sprang ab, verschwand in dem Hofraum und erschien alsbald wieder, geleitet von dem Präses. Die beiden schritten, aus dem Tor auf die Straße eilend, auf Julian zu, der sich von der Bank erhoben hatte und, Ernstes ahnend, ihnen entgegenging. »Dies ist der, den du suchest«, sprach der Präses. »Wie?« staunte unwillig der Centurio, der, ganz gerüstet, in seinen Waffen klirrte. »Du läßt den Gefangenen so weit auf der Straße sich entfernen?«
»Sorge nicht! Ein Späher war ihm gefolgt. Dort hinter dem Grabmal zur Rechten kauert er. Auch sperrt die Straße weiter unten ein scharf bewachtes Brückentor. Er konnte nicht entrinnen.« — »Weh mir, vermochte ich nicht, ihn zu bringen!« Nun trat er auf den Jüngling zu und legte gebieterisch die gepanzerte Rechte auf seine Schulter.
»Augenblicklich, o Julianus, hast du mir zu folgen. Nein, nicht erst in das Palatium zurück! Wie du gehst und stehst, so lautet der Befehl.« — »Wessen?« — »Des Imperators selbst.« — »Wohin?« — »Das wirst du bald erkennen! Aber komm, ich muß deine Ergreifung melden.« Und er zog ihn am Arme mit sich fort in die Stadt hinein, wo in der Mitte der Reiter ein Ungewaffneter auf prächtig gezäumtem Rosse saß, in goldstrotzenden, reichgestickten Gewanden.
Wie der Mann sich vorbeugte mit seltsamem Grinsen, erschrak Julian ob der abstoßenden Häßlichkeit des gelben, gedunsen feisten Gesichtes, dessen Wangen schlaff herabhingen wie Fettlappen; unheimlich blinzelten die kleinen hellen Augen.
»Hier ist mein Gefangener, o Illustris«, meldete der Centurio mit kriegerischem Gruße. »So?« raunte der Vornehme mit dünner Stimme. »Du also bist Julian, der Sohn des Verbrechers Julius?« — »Des Opfers von Verbrechern, willst du sagen. Und wer bist du?« So zornig lautete die Frage; der Illustris fuhr zusammen im Sattel. »Ich?« sprach er dann giftig. »Ich bin — merke dir den Namen! — Eusebius, der Vorsteher des geheiligten Cubiculums.« — »Ah, der Obereunuch! Der Vollstrecker! Verzeihung! Der Einbläser der Blutbefehle des Augustus! Man sagt, der Imperator sei nicht ganz ohne Einfluß bei dir, Eusebius.« — »Schweig doch!« warnte wohlwollend der Präses, hinzutretend. »Vergib ihm, o Illustris. Der Knabe kann einen Witz nicht verhalten, und müßte er daran sterben.«
Tod bedeutete der böse Blick, den Eusebius auf den Kecken warf. »Dazu«, zischte er aus den Zähnen, »war diese Bosheit gar nicht mehr nötig.«
»Wohin — wohin schickst du mich?« — »Ich schicke dich deinem Bruder nach!« — »Und was haben wir verbrochen?« — »Das frag im Jenseits den Imperator, sobald er dort eintrifft, was spät geschehen möge. Oder noch auf Erden. Die Eingeweide von — nun, gewisse Eingeweide, die haben vor euch beiden schlimmen Brüdern gewarnt.« — »Dann darf ich wohl nicht zu Pferd ...? Richtig, da steht sie ja schon in der Mitte der Reiter, die Sänfte, ganz schwarz, über der Tür ein Silberkreuz, einem Sarge täuschend ähnlich. Genug! Gallus, ich folge dir!«
Des Todes jeden Augenblick gewärtig, lag der Gefangene in den Kissen der Sänfte, stumm, ohne Klage, ergeben in sein Geschick.
Das rührte ganz allmählich das Herz des rotbärtigen Centurio, dem Eusebius, der gefürchtete Blutmensch, von dem Brückentor von Macellum ab eine andere Richtung einschlagend, die Ausführung des imperatorischen Auftrags überwiesen hatte.
»Bei Tius und Donar«, sagte er zu seinem neben ihm reitenden Stammgenossen, »mich erbarmt es um den Buben! Schad um das junge Blut. Er ist heldentapfer. Sieben Tage schleppen wir ihn nun herum. Er weiß es längst, daß es zum sichern Tode geht, und er fürchtet sich wirklich nicht. Lieber laufe ich sieben Stunden Sturm gegen ein persisches Felsennest unter einem Hagel von Pfeilen, als daß ich sieben Tage jeden Augenblick für meinen letzten halte. Es ist eine ausgesuchte Grausamkeit.« Und er schüttelte die zottigen rotgelben Haare unter seinem Helm, den ein braunes Bärenhaupt überragte mit dem als Mantel auf die Schultern herabhängenden Fell. — »Still, Berung«, mahnte der andre. »Wir sind hier nicht daheim im sichern Neckarwalde. Des Imperators Späher horchen überall.« — »Meinetwegen, Vetter Eburwin. Ich habe nur meinen Arm, nicht meine Gedanken in Sold gegeben. Und dem Imperator möcht ich einmal ein paar von diesen Gedanken sagen! Nun, jetzt hat er's bald überstanden. Schon sind dort, trotz dem Abenddunkel, die Türme der Feste Vetera sichtbar; dort: da soll ich ihn vor den Richter stellen, der soll die Tatsache untersuchen und ... nun, Eusebius hat diesen Richter ausgesucht! Man hat noch nie erlebt, daß ein von Eusebius Angeklagter seinen Richter lebend verlassen hat.« — »Anklage!« meinte Eburwin. »Möchte wissen, worauf sie geht? Der bleiche, zarte Träumer sieht nicht aus wie ein Verbrecher.«
»Sein Verbrechen ist seine Geburt. Sein Bruder soll ja schon mit dem Beil enthauptet sein zu Tyana. So erzählte mir gestern ein Bote der Reichspost, der uns kreuzte. Aber halt, wir stehen bereits vor den Wällen des Kastells. Siehe da, man erwartet uns schon. Fackeln nahen aus dem finstern Eisentor. Der dort in der Mitte, mit den senatorischen Abzeichen, das ist gewiß der Richter. Schau, die Amtsdiener neben ihm schleppen schwere Fesseln. Und dort, der baumlange Neger, wirklich, der trägt schon auf der Schulter das Richtbeil. Rasch ist die Rechtspflege des Imperators, das muß man sagen! Und der arme Junge, der nicht ahnt, lebend im Sarge, in seiner geschlossenen Truhe, wie nah ihm das Ende! Er soll's doch vorher wissen. Ich mag nicht, daß er mir vor seinen Feinden feig zusammenbricht vor Schrecken.«
Er trieb seinen mächtigen Gaul dicht an die Sänfte, hob deren Gitter auf und flüsterte hinein: »Nun, mein junger Held ohne Helm und ohne Schwert, nun gilt's, dich zusammenzunehmen. Beiß die Zähne übereinander und furche die Brauen. Das hilft immer ein wenig, den Schmerz zu verhalten. Ich glaube — aber, fasse dich jetzt! — du bist nun bald erlöst. Schau hin, du wirst jene Fackeln nicht mehr zu Ende brennen sehen.« — »Dank, Germane!« erwiderte der Jüngling mit ruhiger fester Stimme. »Sprich, glaubst du an einen Gott?« — »Das will ich meinen! An viele herrliche Götter glaube ich!« — »So auch ich. Aber der oberste ist der Gott des Lichts, der auch meines Lebens Licht angezündet hat. Klaglos, dankbar geb ich ihm sein Geschenk zurück, verlangt er's wieder. Nicht der Imperator, Phöbos Apollon hat es mir gegeben — und nicht der Imperator, Phöbos Apollon ruft mich ab zu höherem Licht. Ich folg ihm gern.«
»Der stirbt so wacker, Eburwin, als dürfte er nach Walhall fahren. Da kommt der Richter. Geschwader! Rechts schwenkt ab! ... So! Halt!«
Die Fackeln näherten sich nun, in der Mitte der Richter, der Sänfte, deren vier Träger ihre Last auf die Straße niedergleiten ließen. Schon schritt der Richter mit finstrer Miene an die Türe, sie zu öffnen, als plötzlich von der Stadt her lautes Rufen erscholl und der donnernde Hufschlag eines einzelnen Reiters, der über die eiserne Zugbrücke herausjagte.
»Platz! Platz! Gebt Raum für einen Eilboten des Imperators! Haltet ein mit der Hinrichtung! Beide Brüder sind frei. Gallus ist zum Cäsar des Morgenlandes ernannt. Richter, gib den Gefangenen frei! Julianus darf — nach seinem früher geäußerten Wunsche — die hohe Schule zu Athen besuchen. Beide Brüder sollen sich der höchsten Gunst versichert halten.« So rief der Reiter von seinem schweißbedeckten Roß herab, eine Urkunde in der Hand vorweisend.
Der Richter nahm das Schreiben entgegen, erkannte das imperatorische Siegel, küßte es ehrerbietig, durchflog den Inhalt, bückte sich tief vor der mittlerweile geöffneten Türe der Sänfte und bat: »Möge es meinem allergnädigsten Herrn, dem Vetter des göttlichen Constantius, dem Bruder des Cäsar Gallus, gefallen, für heute Nacht in meinem schlichten Haus abzusteigen und es durch die Spur seiner Fußtritte für ewige Zeiten zu verherrlichen! Ich bin dein Sklave, o Herr! Tritt in die Freiheit über meinen Nacken hin.«
Und er kniete nieder, das Haupt vorbeugend. Julian sprang — an ihm vorbei — hinaus. »Wie heißest du, Germane?« fragte er zu dem Hengst des roten Riesen hinauf. — »Berung heiß ich, Beros Sohn!« — »Ich danke dir, Berung. Gib mir die Hand. Siehst du, Phöbos Apollo, mein Gott, an den ich glaube, hat mich gerettet.« — »Nein! Das hat dir Wodan, der waltende Wunschgott, getan!« — »Nein, mein Sohn«, rief eine weiche Stimme, »dich hat gerettet in seiner Gnade Christus der Herr!« Und der Bote ließ sich halb ohnmächtig von dem Sattel in Julians Arme gleiten.
»Wie?« staunte der. »Du, Johannes, du der Bote des Imperators? Welch ein Wunder!« — »Ja, mein geliebter Sohn. Christus der Herr, er tut noch Wunder für die Seinen. Er, er allein hat dich gerettet vor dem sichern, nahen Tode! Vergiß es nie im Leben.«
Und bewußtlos sank der Alte auf die Erde nieder vor Julian.
Jahr und Tag waren verstrichen.
Da wandelte zu Heliopolis in Ägypten in seinem Arbeitsgemach Lysias langsam auf und nieder, ganz vertieft in ein langes Schreiben Julians, das also lautete: »Seinem geliebten Lehrer und Befreier Lysias der dankverpflichtete Schüler Julian.«
»Dankverpflichtet. Wie kühl! Wie abgemessen! Also nicht: ›Dankbegeistert.‹ Wie der Schuldner widerwillig des Gläubigers gedenkt.«
»Zwar ist es noch nicht gar zu lange her, daß ich dir hier, in dem Athen unseres göttlichen Platon, an den Ufern des Ilissos wandelnd, im Schatten der Platanen meine ›Geschicke‹, was mehr ist, meine Gedanken — die ›geschickten‹ wie die ›ungeschickten‹ (ist das nicht hübsch? Wie nennt man diese Wendung?) mitgeteilt habe, da du, meinem Rufe folgend, als Lehrer eines nur wenig mehr Gelehrigen, hierher gekommen warst. Allein ich fühle: nur unvollständig — ich weiß nicht, weshalb? — konnte ich mich damals dir erschließen. Oder vielleicht besser: wann ich mich erschließen wollte, ergriffst du den Schlüssel und schlossest mir Mund und Seele, selbst den suchenden Blick des Auges zu. Es steht ein Ungreifbares, Unsichtbares zwischen uns. Das will ich vertreiben. Denn es wäre schwarzer Undank, käme ich ferner und ferner ab von dir — von dir, dem ich alles schulde: die Freiheit, das Licht, das Höchste: Phöbos Apollo selbst.
Aber freilich, gerade er ist es, Phöbos Apollo, der, wie es scheint, uns scheidet. Denn anders als dir erscheint er mir, seitdem ich, gelöst von der Obergewalt deines reiferen Geistes und von anderen Lehrern belehrt ...«
»Aha, das ist's, das ist's«, knirschte Lysias, den Papyrus in der Faust zerknitternd. »Verdrängt haben sie mich aus seinem Gemüt, diese glaubenlosen Sophisten und Rhetoren! Aber ich will sie wieder haben, diese Seele. Nicht für mich wahrlich, für die großen Götter, die nicht zu ergrübelnden. Ich muß ihn wiedergewinnen, mit jedem Mittel. Und ihr wißt es, Phöbos Apollo und Vater Zeus und Athene, nicht bloß um meiner Herrschaft willen, auch nicht nur für das Glück des geliebten Kindes führe ich diesen Kampf. Aber mein muß er bleiben — oder ach! wieder werden —, Julianus, der Beherrscher der Welt, der sternenverkündete Wiederhersteller der Götter und meiner Herrschgewalt am Nil. Und auch was für mein Kind die Sterne gelobt: ›Julian und Helena, das Doppelgestirn der Herrschaft und der Liebe!‹ — wahr muß es werden: oder die Sterne hätten gelogen. Und dann wären auch die Götter Lüge — ebenso wie die Wunder des verhaßten Jungfrauensohnes — unertragbar zu denken!«
Er stand nun an dem Fenster, das in den Garten blickte. Leise Klänge einer Lyra drangen zuweilen aus einer halboffenen, um den Springquell gebauten Marmorgrotte. »Armes Kind«, seufzte er.
»Als ich plötzlich von der schon betretenen Schwelle des Hades zurückgerissen ward durch den von dir so ungerecht gehaßten Johannes« — (»noch immer hängt er an dem Schwachkopf!«) »und mich hierher versetzt sah in diese von Göttern und allen Musen geheiligte Stadt, da badete meine Seele in Entzücken. Eitel wie ich leider bin — (»zu meinem Glück, so dachte ich früher«, seufzte der Leser, »aber nun beherrschen ihn andere — nicht mehr ich! — durch diese Schwäche) —, schmeichelte es mir wohl auch, daß dieses liebenswürdige Völklein der Athener — es sind die erfreulichsten der Menschen! — seine Freude an dem Sproß des Herrscherhauses hatte und hat, der so eifrig ihren Lehrern lauschte und lauscht. Sie loben meine Leutseligkeit: ist es mir doch Herzensbedürfnis, jedem Menschen, dem ich begegne, Freundliches zu erweisen: Sie ehren mich auf den Straßen, in den Bädern mit frohem Zuruf — oh, ihr Götter — vernimmt das Constantius (und was vernimmt es nicht, sein ungeheures Ohr?), kann ein einz'ger solcher Zuruf mir das Leben kosten! Und die Gefahr, angegeben, verklagt zu werden bei Hof, umgibt mich hier stets und überall: einer meiner Mitschüler, Gregor (er soll aus Nazianz stammen und ist die giftigste Kröte von einem Menschen, die mir im Leben vorgekommen!), schrieb neulich schon an unsern gemeinschaftlichen Lehrer Aidesius: ›Welch Unheil erzieht sich der Imperator an diesem Menschen, der in kindischer Eitelkeit mit dem Philosophenmantel prunkt und sehr wenig zu glauben scheint!‹ (Wie dankbar bin ich dir auch dafür, daß du mich diese altägyptische Geheimschrift gelehrt hast, in der ich sogar über Constantius die Wahrheit schreiben kann, ohne alsbald daran zu sterben!)
Allein jene Freude der Eitelkeit ist ein Kleines gegen die berauschende Geisteswonne, in der ich schwimme, seit ich nicht nur die Fesseln der traurigen Lehre des Galiläers von mir gestreift, das ist dein Verdienst (das mich für immer zu deinem Dankesschuldner macht), seitdem ich an des Zerstörten Stelle ein voll befriedigendes Neues gefunden. Und sieh, das ist, was ich an dir, an deiner Lehre vermißte: zerstören konntest du, nichts auferbauen.«
»So?« rief Lysias zornig! »Undankbarer!«
»Denn was du botest (o vergib) ... es waren doch nur die alten Götter« — (»gibt es Herrlicheres? grollte Lysias) — »des kindlichen, gedankenlosen Volksglaubens, nur ein ganz klein wenig von den grobsinnlichsten Fabeln gereinigt. Aber alle Olympier, so, wie sie die Dichter gesungen, nur ein wenig gesäubert von Ehebruch und Vatermord, sollte ich verehren! Und auch dein Phöbos Apollo, immer blieb er noch der Sohn des Zeus und der Latona, der Tochter eines Titanen, und dein Zeus soll bald in Schwanengestalt, bald als Stier gebuhlt haben. Wenn ich das glauben soll, warum nicht auch, daß der Esel Bileams einen Vortrag gehalten habe? (Ich habe hier in Athen manchen Vortrag von Professoren gehört, der mir jene Eselsgeschichte ganz glaubhaft scheinen läßt.)«
»Der Unselige! Er wagt es in frechem Witzeln den wüsten Aberglauben der Hebräer dem Glauben an unsere Götter zu vergleichen!«
»Das ist wohl der letzte Grund, der uns bei deinem so heiß von mir erbetenen Besuch hier nicht zu rechtem Einklang gelangen ließ. Aber seither (etwa acht Monde sind verstrichen) habe ich ganz gewaltige Fortschritte gemacht: leider führt mich jeder Schritt — ich sage wahrlich nicht: über dich empor — wohl aber weit, weit hinweg von dir. Höre nur! Ich habe — mit des Imperators Verstattung — nicht nur Byzanz besucht und die dortigen Lehrschulen der Sophisten Nikokles, Himerius, Proäresius und des Philosophen Chrysanthius, nein — höre nur und frohlocke mit mir! — selbst Nikomedia ...«
»Wie? O wehe mir! Die Stadt des Maximus, der alle großen Götter in eitel Symbole verflüchtigt! Ach, ihr Götter und Lysias und Helena; sollen wir ihn denn ganz verloren haben?«
»Du kannst dir vorstellen, welch schmerzliche Gefühle in mir aufstiegen, da ich die Stadt, die Straße, das Haus wiedersah, wo meine Eltern, all die Unsern ausgemordet wurden. Gram, Grimm und Groll erwachten aufs neue in mir. Aber bald ward all dies, ja alles Irdische verdrängt durch ›Einen Namen‹, durch ›Einen Mann‹: durch Maximus, den weisen, den großen Lehrer, den Kenner — was sage ich! — den Vertrauten der Götter, der wahren, nicht der Fabelwesen Homers und deines Glaubens. ›Maximus‹ ist wahrlich ›der Größte‹: ja, oft scheint er mir kein Sterblicher zu sein! Nein, ein unsterblicher Gott an Weisheit in Menschengestalt!
Zwar sollte ich ihn und seinen Freund Libanius nicht hören dürfen in ihren Vorträgen! Constantius hatte es ausdrücklich verboten. Allein, ich sparte mir gar manchen Solidus ab von meinem Taschengeld für Speise und Trank (es war keine Entbehrung: denn mit dem wenigsten an Nahrung komme ich aus, mager wie die Zikade, die Günstlingin der Götter): dafür gewann ich einen Schnellschreiber, daß er mir jedes Wort, das der Meister sprach, nachschrieb und spornstreichs überbrachte. So ward dem Imperator gegeben, was des Imperators, ganz nach des Galiläers Gebot. Und dann war mir ja nicht verboten, außer den Lehrstunden mit ihm zu verkehren. O mein Lysias! Welche Welt erschloß sich mir da! Eine neue herrliche, unausdenkbar große! Seine Weisheit verhält sich (zürne nicht!) zu deinem wenig geläuterten Glauben an den Zeus, der ein Schwan, und an den Apis, der ein Stier, wie etwa du dich vor Jahren zu meinem Wahnglauben an die Wunder des Moses und des Gekreuzigten verhieltest.«
»O hört es nicht, ihr großen Götter!« zürnte Lysias.
»Aber schreiben kann ich dir das alles; tagelang, wochen-, mondelang müssen wir darüber verhandeln. Es genüge einstweilen, zu sagen, daß Maximus, dann der greise, ehrwürdige Aidesius von Pergamus mich in die eleusinischen Geheimnisse einweihten, die du mir vorenthieltest, weil sie dem alten Glauben an die Götter, wie du ihn lehrst, allerdings nicht entsprechen. Denn manches lösen sie in Sinnbilder auf, was du beharrlich als wirklich geschehen festhältst. Aber mich ziehen diese symbolischen mystischen Deutungen unwiderstehlich an. Klar, lichterhellt ist mir nun die Welt, sind mir die Götter und die Geschicke der Menschen. Ich schwimme, ich bade, ich tauche unter in der Seligkeit der Erkenntnis. O warum bin ich ein machtloser Untertan, ob dessen Nacken stets das Beil des Argwohns schwebt, warum bin ich nicht Imperator, diese Erkenntnis vom Thron herab den Römern zu verkünden an Stelle der hebräischen, und (o vergib mir!) deiner wenig höheren olympischen Fabeln! Nicht zwingen wollt ich sie; höchstens ein wenig — ganz sänftiglich! — drücken auf den rechten Weg; mit gelinder, ganz gelinder, mit gängelnder Gewalt, mit der des Spottes zumal. Vielleicht würden mir anfangs auch die Verehrer der alten Götter nicht eben leicht folgen können: aber es siegt das Licht, es siegt Phöbus Apollo, der unbesiegte Sonnengott (der jedoch nicht wie der deine, o teurer Meister, im Ehebruch erzeugt und auf dem schwimmenden Inselchen Delos geboren ist).«
In finsterem Groll ließ der Priester das Schreiben sinken. »O verzeiht ihm, Vater Zeus und Latona und du selber, Phöbos Apollo. Er verhöhnt euch, er, der euch rächen sollte!« Dann las er weiter. »Außer Maximus, dem ich fortan allein als meinem Lehrer folgen werde, lernte ich, wie bemerkt, Libanius kennen, den ausgezeichneten Rhetor; auch ihn hat mir der Imperator versperren wollen; auch zu seiner Weisheit drang ich durch einen Regen von Gold, wie dein Zeus zu der schönen Danae gelangte. (Sage, glaubst du das nun alles wirklich? Schon eher glaube ich sein Abenteuer mit Europa als Stier: stiermäßige Vorzüge sollen ja manchen Weibern lockend scheinen, sagt man. Ich weiß freilich davon nichts.)
Auch Libanius verdanke ich gar viel des Großen, Herrlichen. Er lobt mich stark und das gefällt mir stark. (Diese Wiederholung des Eigenschaftswortes ist nicht Nachlässigkeit, ist Absicht: Ich meine, das macht sich hübsch, nicht? [Bemerkst du auch die vielen Zwischensätze? Das ist jetzt feinster Stil in Nikomedia. Ich suche auch darin Maximus und Libanius nachzueifern.]) Aber glaube nicht, o Lysias (in Wahrheit mein ›Lysias‹, d. h. mein ›Erlöser‹), daß ich nur in Büchern, im Grübeln gelebt habe all diese Monde.
Mein Leib, meine Gesundheit, meine Kraft sind merklich erstarkt; sie drängen von selbst zu allen Übungen des Gymnasiums, zu der Palästra, zur Erlernung aller Waffenkünste. Du solltest mich den Germanenspeer mit dem Schwerte beiseite schlagen, den Perserpfeil mit dem kleinen Reiterschild auffangen sehen! Die Gymnasiarchen sagen, ich sei tollkühn; aber ich bin es nicht: denn ich weiß, über mir hält Phöbos Apollo den Strahlenschild, der aller Feinde Augen blendet. Und unglaublich, meinen sie, sei, was mein zarter Körper an Behendigkeit, an Ausdauer leiste. Aber es ist leicht zu erklären: geringe Speise genügt mir; pfui über den, der sich den Wanst mit mehr Speise belastet, als er ganz unerläßlich bedarf! Ich huldige nicht dem Bacchus, obwohl ich edlen Wein zu würdigen weiß, und mit Ekel, mit Abscheu wende ich mich ab von dem Dienst der Aphrodite, wie ihn die Jugendgenossen treiben. Nein, würde mir je das Glück der Ehe; rein, wie meine jungfräuliche Braut, würde ich das rosenbekränzte Lager besteigen und nie ein ander Weib berühren. Aber ach! Die Göttin, die mir damals zu Macellum flüchtig erschien, sie hat sich niemals wieder gezeigt, und nur ihr Gemahl werd ich, keiner andern.«
»Das wollen wir sehen!« rief Lysias zornig, von der Ruhebank aufspringend. »Die Sterne sind andrer Meinung, du, abgefallen von den Göttern und von mir. Aber wer war jene Unselige, die all meine Pläne vereitelte. Die gegen die Sterne sich vermaß? Das tut man nicht ungestraft!«
»Und doch ist mir hier im götterbegnadeten Athen auch der Reiz des Weiblichen wieder genaht.«
»Was? Wie? Eine zweite Nebenbuhlerin?«
»In den Vorträgen, die wir nach Aufgaben unserer Lehrer in der Rhetorenschule zu halten hatten, erschienen bei hohen Festen — so zur Feier der Thronbesteigung des Imperators — auch vornehme Frauen und Mädchen; viele Schöne sah ich. Eine besonders, deren kluges Auge oft so feinverstehend auf mir zu ruhen schien. Sie war reich geschmückt; ich erfuhr ihren Namen nicht. Aber sie kam nur, wann ich den Vortrag hatte. Endlich fand ich hier am Ilissos auch zum erstenmal im Leben der Freundschaft unvergleichlich Gut.«
Bittrer Groll zuckte um des Lysias Mund.
»Denn dich, o Meister, entrücken das Alter, die überlegene Reife und mein Dank hoch oberhalb des gleichen Bodens, auf dem Freunde stehen müssen. Aber hier in den Ringkampfspielen des Gymnasiums lernte ich einen Jüngling kennen, wenig älter als ich, aus altedlem römischem Hause, der hat in schöner, warmaufwallender Freundschaft mein ganzes Herz gewonnen. Es wird dich besonders freuen, daß er, ebenso wie vor ihm sein Vater, der Comes Varronianus, sein ganzes Haus, die Taufe und die Lehre des Galiläers schroff ablehnt, stolz der Abstammung von Ares gedenkend. Er ist stärker und gewandter als ich, so daß ich meine ganze Kraft zusammennehmen muß, in dem Fünfkampf ihm nicht zu erliegen; erlieg ich ihm doch zuweilen, dankt er's seiner überlegenen Ruhe und meinem flackerigen Ungestüm. Er dämpft meine Eitelkeit sehr heilsam durch solche Siege und meine Hitze durch seine kühle Ruhe. Dazu aber kommt ein Großes: Ein Krieger, aus kriegsberühmtem Haus — Jovianus heißt er —, bekämpft er mit Recht und mit dem Feuereifer mehr noch seines Beispiels als seiner Rede meine einseitige Vertiefung in Philosophie und frommes Ergrübeln der Götter; wie er mich zum Waffenkampf heranzieht und mich zwingt, hier mein Alleräußerstes an Kraftanstrengung zu leisten, so nötigt er mich auch in die große Heldengeschichte unseres Reiches hinein. Es regt sich in mir ein kriegerischer Sinn! Die Geschichte der römischen Kriege (ebensoviel Siege, bis die Adler dem Labarum weichen mußten!), ganz besonders aber Bücher über Feldherrnkunst lesen, erforschen wir abends und nachts bei der Lampe, bis die Sterne bleichen; die Siege Cäsars über Gallier und Germanen, die Siege Trajans über Perser, Daker und Geten, Marc Aurels über die Barbaren am Ister, und jetzt die Feldherrnkünste Frontius arbeiten wir durch, daß uns die jungen Stirnen brennen. Ach, wer auch einmal im Ernst dem Speer des Germanen, dem Pfeil des Parthers trotzen dürfte! Heißer als die Rose der Liebe, die ich nicht kenne, verlange ich den Lorbeer des Helden; auch ihn werd ich nie kennenlernen. Wie beneide ich meinen Bruder Gallus! Nicht darum, daß er nun hoch und herrlich in Antiochia als Cäsar, als Beherrscher des Morgenlandes, schalten und walten darf. Der Imperator hatte ihn (wie mich!) wirklich damals hinrichten lassen wollen; man sagt, geängstigt durch Weissagungen von Gefahren, die ihm von seinen Vettern drohten. Eusebius, der Oberste der Eunuchen, von jeher ein Feind unseres Hauses, soll ihm das durch einen Chaldäer aus den Eingeweiden geschlachteter Germanen haben weissagen lassen. Auf einmal erfolgte abermals — (wie zur Zeit unseres Aufenthaltes in Rom) — ein Umschlag. Eusebius ward in den Hintergrund gedrängt, man weiß nicht, durch wen oder wie, auch Johannes konnte oder durfte es mir nicht erklären; der Imperator ließ jenen Weissager selbst schlachten und seine Eingeweide den Hunden vorwerfen, und nun ward Gallus plötzlich statt um einen Kopf kürzer um eines Kopfes Höhe länger (ist das nicht hübsch gesagt?) und zum Cäsar gemacht mit dem Auftrag, den Orient zu verwalten. Freiwillig und aus Güte handelte Constantius freilich nicht, sondern gezwungen von der Notwendigkeit, seine ganze Sorge dem Abendlande zuzuwenden, das ihm ein Anmaßer zum großen Teil entrissen hatte. Nun, da dieser Feind vernichtet ist, mag es den Imperator vielleicht schon wieder lebhaft reuen, einen Vetter verschont und erhöht zu haben. Aber nicht diese Erhöhung neid ich dem geliebten Bruder, o nein! Nur das Schwert, das er gegen Parther und Perser schwingen darf, diese alten Erzfeinde des Römerreiches, die ich für viel gefährlicher und hassenswerter erachte als Jazygen am Ister und Germanen am Rhein (von denen ich freilich erst jetzt aus Cäsar, Livius und Tacitus einiges lerne!). Ich begreife Gallus nicht, der so lange säumt, die Perser zurückzutreiben aus den Grenzlanden, die sie dem schwachen, zagen Constantius abgetrotzt. Oh, ein Perserkrieg! Im Perserkriege fechten dürfen, siegen, fallen; das wäre fast noch herrlicher, als den Lehren meines großen Maximus zu lauschen!
Während ich dies schreibe, dringen beunruhigende Gerüchte über Gallus an mein Ohr. Jovian, der Vielgetreue, hörte in den Bädern der Hygiäa erzählen, ein Schiffer habe im Piräus die Nachricht verbreitet, in Asien sei ein Aufstand ausgebrochen, Blut sei geflossen auf den Straßen von Antiochia; aber ob eine Empörung gegen den Imperator oder gegen Gallus, das war nicht zu ermitteln.
Zum Schlusse bitte ich dich herzlich: vergib mir, wenn irgendein Wort in diesem Brief dich gekränkt haben sollte, du weißt, das lag mir fern. Würd ich doch mein Herzblut für dich vergießen, für meinen Befreier aus dem Geistesgefängnis, aus den Fesseln des Galiläers. Aber stillstehen auf dem Wege nach der Erkenntnis, das kann ich nicht, auch nicht dir zuliebe! Hast du selbst doch mich gelehrt: »Die einzige Sünde ist, sich vor dem Licht verschließen, nicht nach dem Lichte trachten.« Lieb ist mir Platon, lieb Lysias, aber lieber die Wahrheit. Ich schließe mit dem Wunsch: Komm; komm bald hierher nach Athen in meine Arme und suche und finde deinen Julian, in vielem verändert, aber nicht in der dankbaren Liebe zu Lysias, seinem Erlöser.«
Mit zornig gefurchten Brauen ließ der Leser das Blatt sinken und setzte sich auf die Ruhebank.
»Weh, weh um meine Hoffnungen! Weh um meine Macht, mein Priestertum und um meine Götter! Nun entreißt mir mein Werkzeug jener mystische Schwärmer, mir, dem Reiche, den Göttern selbst. Aber nein!« Hier erhob er sich ungestüm wieder von dem Sitze. »Ich will, ich darf nicht verzagen und verzichten. Laß sehen, ob ich diese Seele wie Christus und Johannes so nicht auch jenem Träumer entreiße. Aber nun muß gehandelt werden. Jetzt, Helena, hilf — hilf den Göttern, dem Vater und vor allem dir selbst.«
Und er rief einen Freigelassenen herbei und befahl: »Ich bitte meine Tochter — sie weilt in der Marmorgrotte —, hierher in die Bibliothek zu kommen.«
Alsbald erschien ein anmutiges junges Mädchen in ganz weißer Gewandung; sie trug eine goldene Lyra im linken Arm, das dunkelbraune Haar, die sanften dunklen Augen hoben sich in schöner Wirkung ab von der blendend weißen Farbe des Nackens und der Stirne; ihr einziger Schmuck war eine um das Haar gewundene Efeuranke und eine goldene Spange, die auf der linken Schulter das langfaltige Gewand zusammenhielt. Lieblich tönte ihre Stimme und ein wenig traurig, als sie sprach: »Du hast befohlen, mein hoher Vater.«
»Mein Kind, ernste, lebensentscheidende Dinge haben wir zu verhandeln in dieser Stunde. Lies diesen Brief. Er ist ...« — »Ich kenne die Schriftzüge. Er ist von ihm — von Julian.« — »Lies in Ruhe, ungestört, allein. Ich gehe einstweilen in das Heiligtum. Ich bete zu den Göttern um Erleuchtung, um Offenbarung.«
Als der Priester nach geraumer Zeit wieder eintrat, war seine Haltung fest: Die Ruhe, die der gefaßte Entschluß mit sich bringt, war über ihn gekommen. Aber die Jungfrau fand er in Tränen. Vergeblich versuchte sie, die Augen vor seinem Blicke zu bergen; er setzte sich zu ihr auf das Ruhebett und hob mit sanfter Gewalt das blasse schmale Gesichtchen in die Höhe. »Weine nicht, verzage nicht, du von Kind an den Göttern Geweihte, du, des obersten Gottes Priesterin. Jetzt gilt es, den Mut, die Kraft bewähren, welche die Himmlischen ihren treuesten Dienern verleihen. Hoffe, Helena!« — »O mein Vater«, erwiderte die sanfte Stimme, »was ist da noch zu hoffen? Er hat dich verlassen, er hat deine Götter verlassen. Und daß er mich, die er nie gesehen, nie lieben wird, das stand mir schon fest, als er damals zu Macellum, wie du mir erzählst, für jene Unbekannte erglühte. Ich beschwor dich schon damals, jede Hoffnung, jeden Gedanken aufzugeben, der mich ins Spiel brächte. Du meintest damals, zwar für den Augenblick soll er mich nun gar nicht, wie du geplant hattest, kennenlernen, solange noch jenes Bild ihm teuer sei, ihn so ganz beherrsche. Allein, du sagtest, wenn er jene nicht wieder sieht, wenn Jahr und Tag darüber hingegangen, dann wird sein wundes, liebesbedürftiges Herz einer neuen, einer hoffnungsfrohen Neigung offenstehen. Ich schwieg, ich gehorchte dir — wie immer —, aber ich hoffte nicht mehr. Dieser Brief bezeugt es; er hat die Erstgeliebte nicht vergessen; und ob es deine Wünsche kreuzt, mich beglückt es, daß er so edel, so zart und so treu ist, wie ich ihn mir — nach deinem so oft wiederholten Lobe — gedacht. Du hast schon dem Kinde diesen Jüngling so gerühmt, hast mich so unabänderlich seine Braut genannt, daß ich Törin leise anfing, ihn zu lieben, noch bevor ich ihn je gesehen. Und als ich ihn nun in Macellum, wohin du mich entboten, damit er mich kennen und lieben lerne, täglich sah von unserem Haus aus, ihm unbemerkt, da hast du freilich erreicht, daß ich ihn wirklich liebte; aber er mich? Nie! Vater, hoher, weiser Vater — gesteh es endlich dir selbst: Du hast dich oder vielmehr die Sterne haben dich getäuscht.«
»Unmöglich! Dann lügen die Sterne, die Götter selbst, dann wäre nicht nur das tiefste Geheimnis meiner Lehre, dann wäre der ganze Glaube an die Götter und die Sterne eitel Selbsttäuschung. Vernimm: Einer meiner Freunde — ich darf ihn nicht nennen, seine Macht, sein Einfluß beruht darauf, daß niemand ihn nennt, weder tadelnd noch lobend —, der größte Sternkundige der Zeit, hat gleich nach deiner Geburt festgestellt, daß dein Geschick geheimnisvoll verknüpft sei mit dem Julians, dessen Geburtsstern er am gleichen Tage sechs Jahre vorher befragt. Julian und Helena werden ein Doppelgestirn des Glückes und der Herrschaft sein: Julian wird die höchsten Taten, ja die höchste Tat im Römerreich verrichten. Das aber kann nur eins bedeuten: Er wird die Herrschaft der Götter erneuern, sie rächen an den mir tief, heiß, grimmig verhaßten Christen. Und alles, was ich selbst, was die Magier, die Sterndeuter Ägyptens, Chaldäas, Persiens, die ich befragte nach Julians Horoskop, erforscht haben, alles bestätigt diese Weissagung. Dies gab meinem fast entmutigten Hoffen, Streben, Trachten neue Kraft. Man hatte mich gezwungen, Christenpriester zu werden ...«
»Ach, mein Vater, zur Lüge gezwungen! Ich hab es nie begriffen, daß du dich dazu zwingen ließest. Es muß eine furchtbare Qual sein.«
»Es ist Mittel zum Zwecke der Rache, der Herrschaft. Es war das beste, das einzige Mittel. Nur so konnte ich die Pläne, die Anschläge der Kirchenparteien kennenlernen; oft und oft habe ich sie vereitelt, bald die eine, bald die andere, bald Athanisier, bald Arianer unterstützend. So wirkte ich über zwei Jahrzehnte, bald im Morgen-, bald im Abendlande, vor den Augen der Imperatoren und der Bischöfe ein eifriger Christ. Die Aufsicht über mehrere Klöster und Kirchenschulen und Einsiedler und Büßer — wie über jenen dumpfsinnigen Musterchristen Johannes! — wurden mir übertragen; ich lernte ihre Stärke und ihre Schwächen, ihre fanatischen Tugenden wie ihre Laster, ihre Heuchelei, ihre Herrschgier kennen. Während ich im Abendlande ketzerische Christenpriester zur Anzeige brachte, versenkte ich mich im Morgenland in den alten Schulen und Priesterschaften des Zeus Ammon, des Apollo Helios, des Mithras, des Osiris, immer tiefer, immer begeisterter in den Glauben der Väter. Es gelang mir — durch Hilfe meines unnennbaren Freundes am Hofe —, das Kloster zu entdecken, in dem der Knabe gefangengehalten und geistig gemordet ward, dem die ›höchste Tat‹, das heißt also die Herstellung der Götter, und — deine Hand von den Sternen bestimmt ist. Nachdem ich ihn aus dem Kloster und aus dem Kirchenglauben befreit hatte, wollte ich dort zu Macellum das Band knüpfen, das euch vereinen sollte. Heimlich ließ ich dich kommen; durch Zufall — nicht durch meine Veranstaltung, durch meine Zuführung —, solltet ihr euch kennenlernen. Ich trug dir auf, während meiner notgedrungenen Abreise zum Abte Konon, der Verdacht geschöpft hatte und mit Anklage bei Constantius, beim Papste drohte, jene Bäder der Amphitrite zu besuchen, gerade zu der Stunde, in der ich den Jüngling gegenüber in dem Männerbade wußte. Du sähest ihn auch ein paarmal: das genügte ...«
Die schönen Wangen erröteten: »Es genügte ... für mich! Ja, ich gewann ihn lieb, den schlanken, blassen, verträumt blickenden Schwärmer mit den sehnenden Augen unter den langen dunklen Wimpern. Und ich wußte ja — du hattest es jahrelang gelehrt —, daß er mein von den Sternen vorbestimmter Bräutigam sei. Aber«, lächelte sie wehmütig, »die Sterne haben, scheint es, nur voraus gewußt, daß ich ihn liebgewinnen würde, ohne ihn je gesprochen zu haben. Er dagegen blieb frei; er hat mich nie gesehen. Denn wenige Tage nachdem ich ihn aus verschlossener Sänfte erschaut, entdeckte er jene Unbekannte; nur für sie hatte er seither Augen. Und als du zurückkamst, da ...«
»Da führte ich dich sogleich weit fort aus der Stadt. Nachdem ich — aus seinem Mund — erfahren, daß eine andre Helena, wie hatte mich dieser Name doch in dem Glauben bestärkt, mein Plan sei gelungen, daß eine andre Helena, welche die Götter verderben mögen ...«
»O mein Vater! Er liebt sie!«
»Eben deswegen! Daß ein anderes Mädchenbild nun seine Seele mit der ganzen Macht erster Liebe erfülle, da erkannte ich, jede Aussicht für dich war verloren, lernte er in diesem Augenblick dich kennen. Deshalb mußtest du ihm — damals — sofort und für lange entrückt werden. Aber seitdem ist lange Zeit verstrichen, und keine erste Liebe bleibt die letzte.«
»Er liebt sie noch immer.«
»So glaubt er! Allein, laß doch sehen, ob jenes Traumbild standhält, sieht er nun dich. Du bist sehr schön, bist viel schöner geworden, als du damals warst! Und jedenfalls, es ist hohe Zeit, daß meine Gewalt über ihn wieder erstarke. Allzulange haben mich dringende Sorgen in Armenien, in Corduene, zu Samara, ferngehalten, wo ich die entmutigten Götterfreunde, die von den Bischöfen und den Beamten des Constantius hart verfolgten, wieder emporraffen, versammeln, im Ausharren bekräftigen mußte. Jetzt aber; er selbst lädt mich ja zum zweitenmal nach Athen. Wohlan: Ich folge seinem Rufe, aber nicht allein. Jetzt soll er dich sehen, dich kennenlernen, du holdes Geschöpf. Ich meine, es braucht nicht erst den Zwang der Sterne, nur den sanften Reiz deiner Augen, ihn dir unlösbar zu verbinden ... Horch! Was ist das? Laute Stimmen im Atrium. Ein eilender Schritt naht ...«
Da ward der Vorhang des Gemaches zurückgeschlagen, ein staubbedeckter Bote stürmte herein. »Vergib, o Herr, diesen Ungestüm. Allein mein Gebieter Julian befahl ..., die ..., dir allein ...« — »Sprich nur, dies ist meine Tochter.« — »Ich soll dich warnen! Dir melden: Verwische, verleugne jede Spur des Zusammenhangs mit Julian! Vor allem: Komm nicht nach Athen, du findest ihn nicht mehr dort.« — »Wo ist Julian?« — »Ach, Herr, ich weiß nicht! In Gefangenschaft! Vielleicht schon tot!« — »Ruhig, Helena, mein Kind! Warum? Weshalb?« — »So weiß man hier noch von nichts? Der Cäsar Gallus, des Herren Bruder, hat sich zu Antiochia wider den Imperator empört, er ist überwältigt oder überlistet; gefangen ward er zu Constantius geschleppt. Dieser hält Julian für mitschuldig der Empörung, und ach, vor meinen Augen ward der teure Herr unter der Anklage des Hochverrats verhaftet, um vor den Imperator — nach Mailand — geführt zu werden. Kaum konnte er mir noch den Auftrag an dich zuraunen. Ach, er ist verloren, wie Gallus, der bereits auf Befehl des Imperators erdrosselt ist.«
Mit einem erstickten Wehgeschrei sank Helena auf das Ruhebett.
In nächtiger Stunde stand in dem hohen, turmähnlichen Solarium des Palastes zu Mailand in goldübersäten Purpurgewanden ein kleiner, unansehnlicher Mann.
Unruhig hastete er in dem schmalen Gelaß hin und her, die unsteten Augen bald empor zu den Sternen des wolkenlosen Himmels der Herbstnacht gerichtet, bald versenkt in die seltsam verschnörkelten Zeichen der Himmelskarten und der sterndeuterischen Papyrus, die, von einer duftausströmenden Ampel beleuchtet, auf dem Zitrustisch ausgebreitet lagen. Nun schob er ärgerlich eine dieser Rollen zurück, mit unsicherer Bewegung der zitternden Hand, so daß sie über den Rand des runden Tisches auf den Mosaikestrich glitt. Unwillig stieß er sie mit dem Fuß zur Seite. »Ach, was tun?« seufzte der Einsame. »Woran glauben? Wem glauben? — Außer den heiligen Büchern selbstverständlich«, fügte er rasch mit einem scheuen Blick der matten kleinen Augen nach oben bei. — »Aber die heiligen Bücher, wie wenig doch reden und raten sie von den Dingen dieser Welt! Wie soll ein Mann danach regieren? ›Liebet eure Feinde, vergeltet Böses mit Gutem! Sagt immer die Wahrheit!‹ O Sohn Gottes (und vielleicht wesenseins mit Gott, denn man kann doch nicht wissen!), du hattest leicht so sprechen! Du hattest nicht — außer ungezählten Barbaren an den Grenzen — ungezählte Verschwörer und heimliche Empörer in deinem eignen Haus, unter deinen Verwandten unschädlich zu machen.
O ja, es mag schon etwas geben, was den Mann in allen Zweifeln fortreißt — von selbst — zum richtigen Entschluß: Die wilde Kampf gier des Alemannen, der fromme Glaube des Büßers, die Vaterlandsbegeisterung des Römers: — nicht meines Römers mehr —, des Römers längst vergangner Zeiten! Aber ich? Ich Armer! Nichts auf der Welt reißt mich fort. Das ist mein Unglück! Wär's auch einmal zu einer plumpen Torheit; andre Herrscher haben sie auch begangen und dann gutgemacht durch eine Klugheit oder vielleicht auch nur durch neue, besser glückende Torheit; das wohl öfter als durch höhere Einsicht. Aber ich! Ach, ich glaube an keinen mehr. Und am allerwenigsten — an mich selber.«
»Habe nie einen Freund«, riet der große Vater, »du könntest seinem Einfluß folgen.«
»Nun hab ich keinen Freund; ängstlich erstickte ich jedes Vertrauen, auch das knospende in meine Gemahlin. Keinen Freund, aber siebzig, hundert Günstlinge! Die steigen und fallen; absichtlich wechsle ich rasch, auf daß keiner Einfluß gewinne. Ach, haben sie nicht alle Einfluß? Siebzig Schmeichler statt eines Freundes; was ist schlimmer?
Und wie mit den Menschen, steht's mit den Sternen, den Sternbüchern, den Träumen, den Traumbüchern: alle widerstreiten einander! Ach, wer an sich selbst glauben könnte! Nur an sich, ganz an sich! Er brauchte wohl sonst an niemanden zu glauben. Aber solche Menschen gibt's wohl nicht. Ihnen würde die Welt gehören. — Da schoß ein Stern! Was bedeutet das? In dieser Stunde? In dieser Richtung, hart an dem Jupiter vorbei? — Oh, es ist ja Sünde, sagt der Bischof, der arianische, von Alexandria, auf Sterne und Träume zu achten. Aber verkündete nicht der Stern den Weisen aus dem Morgenland des Heilands Geburt? Und deuteten nicht von jeher Propheten und Heilige Zeichen am Himmel und auf der Erde? Nur richtig deuten, das ist die Sache!
O wenn ich doch nur mich selber fragen könnte, statt die Priester, die Höflinge, die Sterne zu befragen. Aber poche ich an meine Brust, so klingt es hohl. Da ist nichts drin. Kein Zwang! Zum Guten nicht und nicht zum Bösen. Nur die Furcht, die immer wache Furcht, ein andrer, nicht klüger, nur wilder, heißer als ich — ein Mann, der handeln muß —, könnte aus Torheit und aus Glück mir Diadem und Leben rauben. Was soll ich tun? Diese Frage ist die Qual meines Daseins.«
Er stieß in seinem unsichern Umhereilen an einen niedrigen Armstuhl, auf dem ein Purpurmantel lag. Stuhl und Mantel fielen. Hastig riß er den Mantel in die Höhe. »Böses Zeichen! Böses Zeichen! — Gerade jetzt, da ich die Entscheidung treffen soll! — Wen fragen? Wem vertrauen? — Dem Bischof dieser Stadt? Ah, er lernt durch meine Beichte schon allzuviel von meinen geheimsten Gedanken, und da ich ihm manches verschweige, ist seine Freisprechung ohnehin gar nicht gültig. Er will, ich soll öffentlich den Arianismus verwerfen! Wie kann ich denn das, da ich heimlich an ihn glaube? Mein amtlicher Sterndeuter Abras, mein Chaldäer? Ei, er weissagt immer Glück, weil das gefällt. Trifft dann Unglück ein — wie gewöhnlich —, hat er immer eine pfiffige Ausrede. Pfiffig! Das kann ich nicht leiden — an andern! Selbst bin ich's gern, wär's gern noch mehr«, und die kleinen Augen blinzelten. »Aber die Pfiffigkeit hilft nicht. Die Pfiffigkeit der Weltgeschichte ist überlegen: sie führt den Pfiffigen zum Gegenteil seiner Pläne. Ich wollte pfiffig die Katholiken demütigen in Athanasius, und Athanasius demütigt mich! — Wer ist nicht pfiffig? Wer ist klug und dabei gut ...? Ich — wahrlich nicht! Gut bin ich schon gar nicht, möchte es gar nicht sein: denn Güte ist Dummheit. Klug? — Ich möchte es so gerne sein! Aber, ich bin viel zu pfiffig, einfach klug zu sein. Klug und gut? — wer ist das? Ohne Zweifel Eusebia, meine Gemahlin. Auch schön ist sie. Und jung. Und warm. Und höchst liebenswürdig. Leider kann ich von all diesen vier Tugenden keinen Gebrauch machen! — Wie sehnt sie sich nach einem Kinde! Ich ... weniger. Töchter sind fast unnütz: ihre Männer sind ehrgeizig. Und Söhne! Hinrichten ließ der große Vater den Sohn, welcher der tüchtigste war von uns Söhnen allen. Vielleicht gerade deshalb!
Aber ich grüble und grüble, und die Zeit verrinnt! Und der Sterndeuter hat doch gesagt, daß unter der heutigen Stellung der Gestirne der Entschluß am günstigsten ausfallen werde. Also — noch heute nacht!
Wen fragen? Vor allen würde ich befragen: den schlimmsten, schärfsten, giftigsten — Eusebius. Er muß es mit mir gut meinen, so bösartig er ist gegen alle Menschen; denn er hat so viele Feinde, er weiß: Nicht eine Stunde länger lassen sie ihn leben, sobald ich Leben oder Macht verliere. Aber ich kann ihn nicht fragen, er ist mir jetzt unerreichbar. Dann die gütevollste: das heißt Eusebia, und den Klügsten oder doch Sternkundigsten: Philippus, zugleich der einzige Arzt, dem ich vertraue. Aber Vorsicht! Widerstreiten sich Eusebia und Philippus, dann ... nichts! Stimmen sie zusammen — so verschieden geartet; sie so weltunklug, er so weltklug —, so soll mir — ohne daß sie's ahnen! — dies das Zeichen des Richtigen sein.
Vergebt, o Vater Christi und du o Christus (vielleicht selbst mit Gott eins!), auch du, heiliger Geist —, daß ich nach Zeichen suche, aber ihr oder eure Priesterschaft erlaubt es ja doch selbst, daß man in zufällig aufgeschlagenen Bibelsprüchen die Zukunft erforscht. Ist es aber doch eine Sünde, nun, so beicht ich sie ja und mach sie gut; die arianische Basilika zu Ravenna bedarf eines neuen Altars. Ich gelob ihn, falls ihr darauf besteht! — obwohl die Einnahmen knapp geworden! — oder ich will ihn — später — geloben.
Ach!« seufzte er, haltmachend vor einem runden Metallspiegel, der in das Getäfel von veilchenfarben geflecktem synnadischen Marmor eingelassen war, »nun hab ich mich heiß und müde gedacht. ›Empfange nie einen Menschen, auch deine Nächsten nicht‹, mahnte der Vater, ›in abgespannter Haltung. Sie müssen stets auch äußerlich verspüren, daß du der Gewaltigere bist.‹ Ha, ihm ward das leicht — mit seinen sechs Fuß Höhe und seiner breiten Heldenbrust.«
Unzufrieden betrachtete er sein Bild in dem Spiegel. »Ich sehe nicht aus, daß sich andere vor mir fürchten. Ich sehe immer aus, als fürchte ich die andern. Und leider ist das wahr. Ich habe mich in Schweiß gegangen, gegrübelt. Aber jetzt, jetzt nimm dich zusammen, Constantius, Sohn des großen Constantin. Ach, wehe den Söhnen großer Väter.«
Und er strich sich mit einem duftenden dunkelroten Seidentuch, das er aus der Brusttasche des weißen, purpurgesäumten goldgestickten Hausgewands zog, die feuchten Tropfen von der flachen Stirn, fuhr sich mit der Hand durch die spärlichen sandfarbenen Haare, zog den Silbergürtel fester an und richtete sich aus der gebückten, vorgebeugten Haltung mit Anstrengung auf; dann erst schlug er den Vorhang des Eingangs zurück.
Auf der Schwelle lag, den Rücken an den Marmorpfosten gelehnt, die Beine lang ausgestreckt, ein riesiger, vollgerüsteter Krieger, den Speer senkrecht in der Faust. Das rote Blondhaar, das ihm dicht aus der Sturmhaube mit dem Bärenhaupte hervorquoll, das blitzende blaue Auge bekundeten die Abstammung des Leibwächters, der sich nun, klirrend in seinen Waffen, erhob.
»Geh, Berung, bedeute dem Ostiarius im zweiten Vorsaal, er möge die Befohlenen hereinführen. Sind sie erschienen, so lege dich außer Hörweite. Oder ... du verstehst nicht griechisch?« Der Riese schüttelte das gewaltige Haupt. »So bleibe, wo du lagst!« Er ließ den Vorhang wieder fallen; so sah er nicht die mißmutige, verächtliche Miene, mit welcher der Germane ihm nachgeblickt hatte. »Bei Donar und Tius, ist mein Vertragsjahr abgelaufen, nicht einen Tag länger bleib ich«, brummte er, wie er, seinen Auftrag zu erfüllen, dem Vorsaal zuschritt. »Leid tut mir's, daß ich — gegen Vater Beros Warnung — je in diese Dienste trat. Der erzählte, Weiber und Kinder hätte er einmal morden sollen, tat's aber nicht. Und dieser Imperator ... der fürchtet sich ja! Tag und Nacht fürchtet er sich. Ich diene keinem Feigling. Und niemals mehr Arbeit mit dem Speer, nur Gefangene geleiten oder auf dieser Schwelle wachen, wie ein Hofhund. Wundert mich, er legt mich nicht an eine Kette. Mich ekelt's an.«
Einstweilen war der Augustus in seinem Gemach vor eine große schwarze Tafel von Ebenholz getreten, die auf einer Staffelei lehnte; sie war mit Sternzeichen und mit Zahlen übersät, in Farben verschiedenartiger Kreide. Grübelnd verfolgte er mit dem Auge, dann mit dem Zeigefinger der Rechten eine vielfach verschlungene Linie, die in hellem Gelb gehalten war; seltsam, unheimliches Lächeln zuckte um die schmalen Lippen, als er vor sich hin sprach: »Nun, Vetterlein, wollen wir sehen. Du ahnest in deinen philosophischen Grübeleien nicht, daß an dem Ausgang dieser Stunde dein Leben hängt. Denn erweist du dich nicht als mein Werkzeug, so wirst du gebrochen; eine Waffe gegen mich sollst du nicht werden. Ich zerschmettere alles, was gegen mich ist. Du bist morgen Cäsar oder — nichts! Ah, da sind sie!«
Er wandte sich; in das Gemach schritt seine jugendschöne Gemahlin, eine schlanke, anmutvolle Gestalt in einfachem, rosenfarbenem Gewand. Das edle, nur allzubleiche Gesicht, der gütevolle Blick der lichtblauen Augen trug einen Zug von verhaltenem stummem Leid.
Ihr folgte ein kleiner Mann mit grauem Haar. Sein langer weißer Bart wallte auf ein dunkelbraunes Gewand; der Ausdruck des auffallend schönen Antlitzes war in hohem Maße vergeistigt; und durchdringend, in die Seele bohrend wie ein Blitz, traf der Blick dieser hellgrauen Augen, wann er die langen Wimpern, die er meist gesenkt trug, plötzlich aufschlug. Um den feingeschnittenen Mund spielte oft ein Lächeln, das, halb wehmütig, halb gutmütig spottend, auf hohe geistige Überlegenheit und reichste Welterfahrung schließen ließ. Wer den Mann zuerst sah, mußte beklagen, daß ein so hochbedeutender Kopf auf einem verkrüppelten Rumpfe ruhte, denn ein häßlicher Höcker entstellte den zwerghaften Leib.
Ehrfürchtig begrüßten beide den Herrscher.
»Es ist gleich Mitternacht«, begann der, »ich stellte die Sanduhr, als der Sklave die elfte Stunde ausrief. Verzeih, Eusebia, daß ich dich so spät in der Nacht noch ..., aber die Sterne und ihr Gang sind nun einmal bei Tage nicht verfolgbar. Setze dich dort, nein, da hin, unter die Ampel. (›Ich will jede Bewegung in ihrem Antlitz sehen«, sprach er zu sich selbst.) »Und du, Philippus, sieh nach, rechne, ob es an der Zeit ist.«
Der Kleine trat an die schwarze Tafel, rechnete ein wenig und sprach, sich verbeugend: »Es ist an der Zeit, hohe Zeit sogar.«
»Hei, du weißt gar nicht«, lachte Constantius heiser, »wie sehr du da die Wahrheit sagst! Vernehmt also — dort liegen die Berichte aus Vienne, aus Autun, aus Reims: Fast ganz Gallien ist verloren, ist in der Gewalt der Barbaren.«
»Das wolle Gott nicht«, rief die Imperatrix, lebhaft aufspringend. Der Bucklige aber nickte stumm vor sich hin. »Gott hat es leider schon gewollt«, grinste der Augustus. »Gott wohl weniger«, entgegnete der Sternkundige, »als du selbst.« — »Ich? Was wagst du zu sagen?« fuhr in Constantius an. »Die Wahrheit, wie immer, wenn ich sie weiß. Wer hat die Alemannen selbst ins Land gerufen, jenen ungestümen König Chnodomar, den germanischen Herkules, wie unsere verzagenden Kohorten ihn nennen? Wer hat ihm ...? — »Ich«, erwiderte der Imperator unwillig. »Du vergißt: Es galt, dem Tyrannen Magnentius und dessen Bruder Decentius Gallien zu entreißen. Da riet Eusebius ...« — »Die Barbaren ins Land zu rufen! Vergebens warnte hier diese vieledle Frau, umsonst sagte ich voraus — dazu bedurfte es nicht erst der Sterne —, sie würden wohl kommen, aber nicht mehr gehen. Du folgtest dem Eunuchen, weil ...« — »Weil dem Eunuchen Constantius am höchsten gilt; dir, ja selbst meiner Gemahlin hier — der Staat!« — »Ich dachte«, schloß Philippus mit einem blitzenden Blick seiner durchdringenden Augen, »auch dem Imperator gilt der Staat mehr als der Imperator. Vergib den Irrtum, o Herr! Ich werd ihn nie wieder begehen.« Ärgerlich biß der die schmale Unterlippe, wie er es pflegte, wenn er keine Erwiderung fand. »Da — hört nur«, begann er wieder — »oder lest, lest selbst.« Er schritt auf den mit Briefen bedeckten Rundtisch zu und reichte den beiden eine Anzahl von längeren Schreiben und viele kurze »Noticiä«.
Die bleichen Wangen der schönen Frau erblaßten noch mehr, als sie las.
»Wie?« seufzte Philippus? »Was seh ich? Fünfundvierzig Städte Galliens in den Händen der Alemannen und Franken! Straßburg, Speier, Worms, Trier, Tongern! Entsetzlich! Nun, zum Glück ist doch noch unser das alte, das stärkste Bollwerk unserer Macht am Rhein: Köln.« — »O nein, auch Köln ...« Wider Willen war dem Imperator dies Wort entfahren. »Was? Wie!« riefen Eusebia und der Arzt wie aus einem Munde, beide sprangen auf. »Auch Köln verloren?« — »Dann ist alles, ist Gallien ganz dahin!« klagte Philippus. »Nein, nein, nicht doch!« entgegnete Constantius ärgerlich. »Ich ... ich habe mich nur versprochen ...« Und hastig zerriß er in ganz kleine Stücklein eine kurze Papyrusrolle, die er vorher aufgerollt und der Augusta hatte reichen wollen. »Dank den Sternen!« sprach Philippus. »Es ist auch so schon schlimm genug. Aber war auch Köln gefallen, dann fand sich kein Feldherr im ganzen Reich, der es unternommen hätte, den Rhein wieder zu erobern. Köln bedeutet ein Heer von vielen Legionen und ...« Gereizt, verdrießlich fiel Constantius ein. »Genug, genug von Köln ...! Nun also! Was tun? Was tun? Entweder ich breche selbst auf nach Gallien noch diese Nacht ...« — »Wohl, welch männlicher Entschluß!« rief Eusebia mit einem erfreuten Blick auf den Gemahl. »Ganz unmöglich!« fiel der Arzt ein. »Deine Gesundheit, o Herr! Dein kostbares Leben!« — »Es ist wahr«, meinte Constantius, plötzlich leise hüstelnd. »Es ist unersetzbar.« — »Wenigstens für ihn«, dachte der andere. »Oder«, fuhr der Imperator fort, »ich entsende einen Vertreter. Aber wen?« — »Einen bewährten Feldherrn, den besten, den du hast!« rief die Imperatrix. »So?« höhnte Constantius giftig. »Daß er sich nach Besiegung der Barbaren alsbald auch gegen mich als den besten bewährt? Nein, nein! Ich danke! Ich habe genug an der Empörung des Magnentius. Das war ja ein recht bewährter Feldherr! Welche Mühe hatten wir, den Schurken zu vernichten!« — »Hm«, nickte der Alte. »Aber einen Nichtfeldherrn kannst du auch nicht senden. Sonst ...« — »Sonst steigen die Germanen nächstens zu uns über die Alpen!« — »Es müßte auch ein Staatsmann sein; denn es gilt nicht nur zu schlagen in Gallien, auch zu regieren.« — »Ein Staatsmann! Ja, der den Staat retten kann, aber nicht den Staat retten will für sich ...« — »Vielmehr für dich.« — »Für den Staat selbst, denk ich«, sprach Eusebia ruhig. »Das ist ja wohl dasselbe, hoff ich«, meinte Constantius mit einem unzufriedenen Blick auf seine Gemahlin. »Da ist der tapfere Malarien«, fuhr diese eifrig fort.
»Ein Germane! Daß er am Ende gemeinsame Sache macht mit seinen Stammgenossen?« — »So wähle«, riet Philippus, »den erfahrenen Ursicinus.« — »Ein Fremder!« meinte der Imperator. »Es wäre gut, müßte es kein Fremder sein! Das grausame Geschick hat gewollt, daß des Constantinus großes Haus — fast — ausgestorben ist.« — »Das Geschick!« dachte Philippus. »Er hat es ausgemordet. Welche Umwege er einschlägt, uns auf den Namen zu führen, der ihm vorschwebt! Wir sollen ihn zuerst nennen; aber wir werden uns hüten.«
»Fast«, wiederholte der Imperator lauernd. Er hielt inne. Aber umsonst, seine beiden Hörer beharrten im Schweigen. Sie vermieden es auch, sich anzusehen, denn jene kleinen listigen Augen blitzten unablässig zwischen ihnen hin und her. »Nun läg es ja nahe«, fuhr er ausholend fort, unwillig über solche Zurückhaltung, »nun läg es ja nahe, zu denken eben ... an den einzigen, der nunmehr noch ... Was gibt es?« Er schrak zusammen und tastete nach dem Dolch, den er unter der seidenen Tunika verborgen trug. »Wer wagt es, mich zu stören?«
Der alemannische Leibwächter meldete: »Der Präpositus sacri cubiculi bittet ... Du habest befohlen, sobald er eingetroffen ...« — »Jawohl, jawohl! Herein mit ihm! — Zur rechten Stunde.« Wie nun Constantius sich dem Eintretenden entgegenwandte, suchten sich und fanden sich die Augen der Imperatrix und des Arztes. Eusebia seufzte tief, Philippus legte blitzschnell den linken Zeigefinger an den Mund.
»Da bist du endlich, Eusebius. Laß nur die Proskynese! Beginne deinen Bericht. Du weißt, man darf keine Geheimnisse haben vor Gattin und Arzt«, lächelte er verschmitzt. Der oberste der Eunuchen — die aufgedunsene, fettliche Gestalt schlotterte in den weiten, lose hängenden Gewändern, verneigte sich tief vor der schönen Frau und warf dann einen giftigen Blick auf Philippus. »Deine Befehle, o Herr, sind genau und erfolgreich erfüllt. Wie immer, wenn du deinen Sklaven Eusebius mit solchen betraust. Du befahlst auch, ich solle mich sofort nach meiner Rückkehr melden, deshalb allein wag ich es, hier zu stehen. Eben stieg ich aus der Sänfte.« (»Gerade recht komme ich freilich noch, scheint mir«, dachte er bei sich. »Hoffentlich noch ›gerade recht‹.«)
»Berichte mir nun genau. Die beiden — auch ich — wissen bisher nur durch deine schriftliche Meldung ... das Gelingen; aber nichts Näheres. Rede!« — »Leider«, begann der Präpositus, »kann ich nicht reden, ohne anzuklagen.« — »Das ist stets so bei dir«, lächelte Constantius. »Ohne Ratgeber anzuklagen, denen du, o Herr, immer wieder mehr folgtest als deinem treuesten Sklaven, obwohl ihr Rat sich wiederholt als verderblich erwiesen hat. Darf ich dich erinnern, wie du — vor Jahren — plötzlich Befehl gabst, deinen Vetter Julian künftig nicht, wie du ehedem beschlossen hattest, in jenem Kloster zum Mönch zu erziehen, sondern ihn durch Unterricht in weltlichem Wissen für den Staatsdienst vorzubereiten?« — »Gewiß. Hatt ich es zu bereuen?« Eusebius zuckte die Achseln: »Warte das Ende ab. Wer war es doch, der dir damals jenen Rat erteilte? Dieser Philippus da!« — »Nicht ich; durch mich die Sterne«, warf dieser ein. »Wahrlich«, fuhr Eusebius fort, »beineidenswert ein Mann, der zugleich den Sternen am Himmel und zugleich den Eingeweiden des Imperators ihre Geheimnisse ablauscht.« — »Höre«, schalt Constantius, »diesen Spott solltest du sparen. Das Höckermännlein da hat mich wiederholt von toddrohender Krankheit geheilt, hat durch seine Gegengifte aus meinen Eingeweiden das Gift entfernt, das...« — »Nie darin war! Oder durch die Fürbitten der Priester des Herrn und all deiner Untertanen bei Gott schon unschädlich gemacht war.« Da sprach Philippus — und das überlegene Lächeln des feingeschnittenen Mundes stand ihm schön: »Oh, Eusebius, schlägst du meine Arzneien so gering und die Fürbitten so hoch an?« — »Gewiß.« — »Wohlan! So mache ich dir einen Vorschlag. Du und deine molossische Dogge, ihr nehmt beide vierzig Unzen Schierling; deinem Hunde gebe ich sofort Gegengift, für dich leistet sofort der Imperator, der ja zuhöchst in Gottes Gnade steht, und leisten alle Bischöfe des Reiches Fürbitte und versprechen dein Gewicht in Gold der heiligen Kirche, dann wollen wir sehen, welcher Patient den andern überlebt.«
Betroffen schwieg Eusebius; der Imperator aber konnte ein höhnisches Lächeln nicht ganz unterdrücken, als er verweisend sprach: »Ei, ei, Philippe! Man sagt, die Jünger Galens sind schlechte Jünger Christi.«
»Mag sein! Aber ich habe meinen Meister nie verraten, wie der oberste der Jünger den seinen; ich muß nicht erröten, kräht der Hahn.«
Jedoch Eusebius fuhr fort: »Und erinnere dich weiter. Endlich war es mir gelungen, dich zu überzeugen, daß jene Befreiung Julians aus dem Kloster ein Fehler gewesen; meine Späher hatten uns hinterbracht, daß Julian heimlich Rom besucht hat, daß jener Priester Lysias nicht ganz unverdächtig scheint.«
»Lysias!« rief Philippus. »Niemand liebt heißer das Römerreich.«
»Daß Julians Bruder Gallus drohende Reden von Rache gegen dich ausgestoßen hat. Du hattest Befehl gegeben, beide Brüder zu verhaften, beide vor dich zu führen, das heißt ...« — »Das heißt: schon auf der Reise zu ermorden«, ergänzte Philippus.
»Was aber geschah? Plötzlich — ein Mönch Johannes tauchte wieder einmal im Palatium auf — sehr verdächtig, weil ein Freund jenes Hauses...« — »Dann ist der Imperator der verdächtigste Mann im Reiche«, warf der Arzt ein, »denn er ist beider Brüder Vetter und hatte in erster Ehe beider Brüder Schwester sich vermählt.« — »Ein vertrauter Jugendfreund dieses Philippus da! Was geschieht? Sie flüstern zusammen; Philippus befragt die Sterne ...« — »Auf mein Geheiß!« nickte der Augustus. »Und das Ergebnis seiner Sternenweisheit ist: Du begnadigst die Schuldigen, du entläßt den jüngeren, reich beschenkt ...« — »Aus einem winzigen Teile des eingezogenen Vermögens seiner Eltern!« schaltete Philippus ein. »... in volle Freiheit ...« — »Das heißt, stets von deinen Spähern überwacht«, ergänzte der Alte.
»Nach Athen. — Dort zieht der Jüngling alsbald die Augen des Volkes auf sich ...« — »Durch seinen Fleiß, seine Bescheidenheit, sein leutseliges Wesen.« — »Jawohl«, wollte die Augusta eifrig rufen, aber ein warnender Blick des Arztes hielt sie noch rechtzeitig zurück. »Er besucht Byzanz, er verkehrt in Nikomedia mit Feinden der heiligen Kirche, mit argen Spöttern, mit kecken Sophisten. Einstweilen aber ... der andere Bruder, sieben Jahre älter, offen, ungestüm; ihn machst du vollends zum Cäsar und räumst ihm die Verwaltung des Morgenlandes ein.« — »Konnte ich etwa zugleich«, fuhr ihn der Imperator heftig an, »diesen verfluchten Magnentius in Aquilea bekämpfen und zugleich in Antiochia die Perser im Auge behalten? He, konnt ich das?« — »Und wählst zu deinem Vertreter von allen Sterblichen den Gefährlichsten. Wahrlich, glänzend hat sich die Weisheit des Sternguckers bewährt, der diesen Rat erteilt hat, während deine Ungnade mich auf Monate von deinem Hof verbannte.«
»Auf deine wunderschöne Villa in den Sabinerbergen«, meinte Constantius. »Kein hartes Exil! Sie ist prachtvoller eingerichtet als dieser mein Palast. Tauschen wir, Präposite?«
»Alles, was ich habe, ist ohnehin dein, o Herr. — Aber bald verrät sich der unbändige Trotz, der rachedurstige Haß des neuen Cäsars: Er verfolgt deine treuesten Beamten, er läßt die dir ergebensten Heerführer hinrichten, und als du endlich auf die Anklagen deiner Treuen hin von deiner Seite vertraute Männer entsendest, den Frevler zur Rechenschaft zu ziehen, da ruft der Tyrann seine Leibwachen unter die Waffen, ruft den Pöbel von Antiochia zum offenen Widerstand auf, deine beiden Sendboten werden ergriffen, unter hundert Wunden durch die Straßen der Stadt geschleift und endlich in die Fluten des Orontes geworfen. Nun droht dir der Abfall des ganzen Morgenlandes. Gallus, ein neuer, ein gefährlicherer Magnentius, rüstet den Bürgerkrieg. Da — endlich — erinnerst du dich deines getreusten Sklaven und entsendest mich nach Antiochia, mich allein, ohne Geld, ohne Waffen, ohne Heer; denn du hattest keines ...«
»Ich möchte dich wohl ein Reitergeschwader befehligen sehen, o Eusebius«, warf der Bucklige ein. »Deine Beine, die sich von selbst unter dem Bauche des Gaules zusammenschließen, würden deinen Sitz festigen.«
»Allein also reise ich in die Höhle des Untiers, das heißt nach Antiochia. Und wirklich gelingt es mir, den Anmaßer ohne Kampf zu überwinden. Ich bewege ihn, unter Zusicherung deiner Verzeihung und Huld ...« — »Wieviel Meineide hat dich das — unter Brüdern — gekostet?« fragte Philippus. »Hast du ihm wirklich geschworen?« forschte Constantius mit scheuem Blick. »Der Bischof von Antiochia lieh mir selbst zu diesem Eid einen Nagel vom Kreuze Christi und entband mich im voraus von der Sünde!«
Da atmete der Herrscher tief beruhigt auf.
»So beredete ich den Toren, seine schon aufgebotenen Scharen zu entlassen und mit mir zu reisen. Anfangs zwar führte er noch eine so starke Bedeckung durch seine Anhänger mit, daß ich mehr sein Gefangener war als er der meine. In Byzanz hielt er noch als Cäsar des Morgenlandes die Zirkusspiele ab. Aber allmählich gelang es mir, ihn immer sicherer zu machen ... immer mehrere seiner Gewaffneten ließ er unterwegs zurück ...
Hätten ihn nicht alle Götter verlassen — (wollte sagen: alle Heiligen!) —, er hätte merken müssen, wie er, gleich einem großen Fisch in einer Spitzreuse, immer mehr in die Enge geriet, immer mehr die Möglichkeit des Rückzugs, der freien Entschließung verlor. Kam er doch bei jedem Schritt immer weiter fort von den Grundlagen seiner Macht und immer tiefer in das Gebiet deiner Herrschaft. In Adrianopel teilte ich ihm deinen eben eingelaufenen Befehl mit ...« — »Ich habe gar keinen dorthin geschickt.« — »Vergib, ich erriet deinen Willen! — daß er hier sein ganzes Gefolge zurückzulassen habe.« — »Und der Tor gehorchte?« fragte Philippus. »Ich übergab ihm des Imperators eignen Siegelring als Pfand der Sicherheit. In nur wenigen Wagen der Reichspost, ohne alle Krieger des Gallus, fuhren wir von Adrianopel weiter. Ich setzte mich nun zu ihm in das zweisitzige Gespann — sein Entkommen zu verhüten — gegen seinen Einspruch. Nun merkte er nachgerade, daß ich nicht sein Ehrengeleiter, daß ich sein Bewacher war. Er ward nun bald wütend, bald niedergeschlagen. Oftmals rief er: ›Oh, Julianus, räche mich!‹ Endlich, zu Petovio in Pannonien, fand ich es sicher genug, auch den Schein des Ehrengeleits abzuwerfen; hier stand ja Barbatio ...« — »Der Schurke«, murmelte Philippus.
»Dein treuer Diener mit starker Schar sarmatischer Söldner. Ihm übergab ich noch am Abend unserer Ankunft den Gefangenen; die Abzeichen der Cäsarenwürde rissen ihm die wilden Sarmaten vom Leibe, wir brachten ihn dann noch nach Pola in Istrien, wo ich als Ankläger und Richter auftrat ...«
»Nicht auch gleich als Henker?« fragte Philippus.
»All das ist bei Hochverrat dasselbe, naseweiser Arzt! Die Hände auf den Rücken gebunden ward er von mir angeklagt, gerichtet, verurteilt und vor meinen Augen von den Sarmaten erdrosselt in weniger als einer Viertelstunde.«
Eusebia erschauerte. »Mörder!« hauchte sie vor sich hin. »Ich fürchte mich vor ihm.« — »Ich bin zufrieden mit dir, Präpositus. Von dieser Stunde an bist du Patricius.« — »Und gegen dieses Gift weiß ich kein Gegengift«, seufzte der Arzt halblaut. Aber Eusebius hatte es verstanden. »Warte, Giftmischer«, flüsterte er ihm rasch zu. »O Herr, welche Gnade«, rief er laut, sich auf das Antlitz niederwerfend. Schwer ward es dem Dickgedunsenen, sich wieder zu erheben. »Aber mein Werk ist erst halb getan. Laß mich den Lohn voll verdienen. Noch lebt der jüngere Bruder ...« — »Wie?« rief die Frau, einen warnenden Blick des Sterndeuters nicht beachtend vor heftiger Erregung — »willst du den Schuldlosen morden wie den Schuldigen?« Mißtrauisch sah Constantius auf seine Gattin: »Schuldlos? Woher weißt du das?«
Sie erschrak, sie fuhr zusammen, heißes Rot schoß in die bleichen Wangen.
Aber Philippus kam ihr zu Hilfe. »Frage, o Herr, lieber den jüngsten Patricius deines Reiches, woher er die Schuld des Jünglings kennt? Worin sie besteht, außer darin, daß er der Lieblingsbruder deiner verstorbenen Gemahlin war? Und erkennst du denn immer noch nicht, daß dieser Höfling planmäßig darauf ausgeht — seit der ersten Nacht deiner Herrschaft, jener Nacht in Nikomedia, in welcher blutiger Maientau fiel, wie das geängstigte Volk flüstert —, alle deine von der Natur, vom Blut oder sagen wir von Gott dir gegebenen Stützen — die Glieder deines Hauses — zu vernichten, auf daß du, deiner von der Natur gegebenen Helfer beraubt, solch Widernatürlicher bedarfst wie der oberste der Eunuchen ist? Ja, blicke nur Tod und Verderben, Patricius. Zum Basilisken, der durch den Blick tötet, kann dich doch sogar der Imperator nicht machen.« — »Hui«, lächelte der, »du bist sehr kühn, Mann der Sterne. Ich für meinen Teil möchte es nicht wagen, meinen Günstling so zu reizen.« — »Was soll der fürchten, Herr, der den Tod nicht fürchtet? Glaubst du, es ist ein besonderes Vergnügen, als dein Untertan und obendrein noch als dein Arzt und als dein Sterndeuter zu leben? Nicht den Sternen, deinem Unstern folgst du — diesem da.« Constantius lachte. Aber Eusebius meinte grimmig: »So mach doch dem ein Ende! Du kennst ja der Gifte so viele. Stirb! Oder höre wenigstens auf, Arzt und Sterndeuter des Herrn zu sein.« — »Nein, o Patricissimus. Ich habe dem großen Constantinus versprochen — zwar ohne Eid auf alte Nägel —, über diesen seinen Sohn, bald nach dessen Geburt, zu wachen, mit allen Kräften meines Geistes für seine Gesundheit und sein Heil zu sorgen. Und ich halte das. Weil ich's versprochen. Und weil ich es liebe, dieses arme, rasch sinkende Reich der Römer. Nicht aus Liebe zu Constantius, denn er ist nicht liebenswürdig, außer«, fügte er bei, »für Eusebia.«
Diese errötete wieder und schlug die Augen nieder.
Der Imperator aber lachte abermals: »Hört, ihr beiden, ihr solltet euch gegenseitig aushelfen: Eusebius hat zuviel der Lobes-Süßigkeit, Philippus zuviel der Grobheit-Bitterkeit für mich! Aber genug nun von beiden. Eusebius, Gallien ist in Barbarenhand.«
»Ich erfuhr es unterwegs.«
»Schau, schau, er ist durch seine Kundschafter trefflich bedient, wo immer er weilt. Besser als ich! Wen soll ich senden, es wieder zu erobern?« — »Barbatio, den Magister Militum für Illyricum.« — »Den Schlächter von Petrovia«, rief die Imperatrix. »Und deinen Neffen, o Patricius«, fügte Philippus bei. Constantius hatte die Stirne gerunzelt: »Nein, das schlage dir aus dem Sinn, Unersättlicher. Du machtest deine Verwandten gern zu Halbgöttern, wenn du könntest. Wen soll ich senden, gütige Augusta?«
Da erhob sich diese von dem Sitz, und dem Gemahl voll ins Auge sehend, sprach sie, diesmal ohne zu erröten: »Julianus, deinen letzten Vetter.«
»Ha«, fuhr Eusebius auf, wie von einem Pfeil getroffen. »Den Bruder des Gallus, den Rächer?«
»Wird dir bange, Mörder?« fragte der Herrscher, plötzlich ganz verwandelt. »Er ist hochbegabt«, fuhr Eusebia lebhaft fort, »tugendhaft, unbefleckt von jedem Laster, ja frei auch von den bloßen Torheiten der Jugend ...« — »Kennst du ihn?« forschte Constantius. »Er gilt dafür«, fiel Philippus ein. »Ihn kennen! Wie konnte man ihn kennenlernen, da du ihn immer eingesperrt hieltst, erst im Kloster, dann in jener alten Burg? Als dein einziger noch lebender Verwandter hat er ein Recht auf deine Beachtung. Und du hast einiges gutzumachen, sollt ich meinen, an seinem Geschlecht.«
Unwillig erwiderte Constantius: »Mein Arzt, mein Sterndeuter bist du, nicht mein Beichtiger.« — »Ich staune«, rief Eusebius, »wie man so verblendet sein kann! Wer ... wer empfiehlt diesen unheimlich tugendhaften Jüngling? Wer?« — »Die Sterne«, antwortete Philippus feierlich. »Längst schon, in der Stunde, ja im Augenblick seiner Geburt habe ich ihm das Horoskop gestellt.« — »Woher konntest du diesen Augenblick wissen?« fragte Eusebia erstaunt.
»Ich war ein Freund seiner Mutter, der spurlos Verschwundenen«, seufzte er mit einem Blick des Vorwurfs und der Forschung auf den Augustus; aber der wandte rasch die Augen ab.
»Ich weilte an ihrem Lager, als sie den Knaben gebar, wie später in jener Mordnacht, da sie ihn — für immer, wie es scheint — verlor; ihn, den andern Knaben, die Tochter, den Gemahl! Sowie das Kind das Licht der Welt erblickt hatte, eilte ich auf meinen Sternenturm. Schon damals sah ich große Geschicke für ihn voraus. Seither hab ich oft und oft über ihn die Sterne befragt. Sie versicherten mir, daß er noch lebe in all den Jahren, da der Imperator mir verboten hatte, ihn nach Julian und den Seinen zu befragen! Und heute, jetzt in dieser Stunde, da der Jüngling sein vierundzwanzigstes Lebensjahr vollendet, der wichtigsten Verbindung seiner Sterne, heute, jetzt befrag ich sie in Gegenwart des Herrschers. Dazu hat er mich herbeibeschieden.«
»Immer noch solch Vertrauen, nach der Erfahrung mit Gallus!« grollte Eusebius.
»Schweig!« herrschte ihn Constantius an. »Die Menschen — auch die Patrizier — lügen und betrügen; meine Gemahlin, Philippus und seine Sterne haben mich noch nie getäuscht. Alles ist noch eingetroffen, was er vorhergesagt hat.« — »Ja, er ist ein ungewöhnlich kluger Kopf«, meinte der Eunuch. »Philippus war es, dessen Aussprüche mich wiederholt bestimmten, die Verfolgung des Knaben einzustellen.« — »Aber in Gallus hat er sich doch geirrt.« — »Nein, _ich^ irrte mich. Philippus riet nur, einen meiner beiden Vettern zum Cäsar zu erheben, er nannte nicht Gallus; der Erfolg hat gelehrt: Ich griff fehl. Philippus hat in den Sternen gelesen: Julians Geschick, sein Glück und Glanz sind auf das engste mit meinem, mit des Römerreiches Glück und Glanz verknüpft, er ist dazu bestimmt, mir noch näher verbunden zu werden, als Geburt und meine erste Ehe ihn mit mir verbunden haben. Hohe, tapfere Feldherrnschaft und kluge Staatskunst schlummern in dem träumerischen Grübler und Schwärmer, so sagen die Sterne.«
»Ja«, fiel Philippus mit Feuer ein, »noch mehr: Die Sterne sagen, dieser Jüngling wird dem Römerreich verlorene Provinzen wiedergewinnen, er wird jenseits eines breiten Stroms in Barbarenlanden halb unbekannte Völker unterwerfen, er wird die größte Tat vollbringen. Er wird ...«
Die Imperatrix suchte seinen Eifer mit einem mahnenden Blick zu dämpfen, denn sie bemerkte, wie ihres Gatten Züge sich verfinsterten, wie er drohend den Lobredner beobachtete, wie er die Unterlippe biß; aber der Seher achtete es nicht. Er war an die schwarze Tafel getreten und verfolgte mit dem Zeigefinger eifrig die vielfach geschlungene gelbe Linie. »Er wird«, fuhr er fort, »nach dem Imperator, neben dem Imperator — nach einer großen, schweren Gefahr — der mächtigste Mann werden. Wenn er als Cäsar ausgesandt wird, dann ...«
Da trat der Herrscher hastig zu Eusebius und raunte diesem zu: »Der törichte Sternseher! Er ahnt nicht, daß er mich mit jedem dieser Worte abmahnt. Julian ist unterwegs hierher.« — »Nein, das wolle Gott nicht!« rief Eusebius entsetzt. — »Sorge, daß er nicht lebend das Palatium verläßt. Seine Mutter ist heimlich aus Aquilea, seine Schwester heimlich aus Syrakus hierhergebracht, sie weilen in dem Palast der Gärten vor der Stadt; ich wollte volle Versöhnung. Aber nun ..., nach dieser Weissagung! Sowie sein Haupt gefallen, werden beide wieder, getrennt, in ihre Verbannungen zurückgesandt.«
Ein Siegeslächeln ging über die Züge des Patricius, wie er sich tief verbeugte. »Nur in die Sterne selbst muß ich noch einmal sehen«, fuhr Philippus fort und stieg hastig die Staffeln hinan zu dem Gerüst, das dicht an die Öffnung in der Saaldecke reichte.
Gespannt achteten auf ihn sechs Augen; er blickte scharf, schweigend nach oben.
Plötzlich schrie er laut auf: »O weh, wehe mir! Was hab ich getan? Nein, mein Imperator, tue nicht, tue ja nicht, was ich riet. Ich Unseliger!« Und er sank, in Schmerzen stöhnend, auf das Knie.
»Rede! Ich befehl es!« gebot Constantius, rasch die Stufen hinaneilend und ihn an der Schulter rüttelnd. »Gestehe, was hast du gesehen?« — »Ach! Wenn er nach Gallien geht ..., ein früher Tod ...! Er wird Gallien zurückgewinnen ... aber der Cäsar Julian kehrt nie ... nie aus Gallien zurück. Du wirst ihn nie mehr wiedersehen.« — »Wirklich? Wirklich und wahrhaftig?« fragte der Herrscher, gierig ihm ins Antlitz starrend. »So gewiß da oben die Sterne stehen!« — »Wirklich?« frohlockte der Augustus. »Der Cäsar kehrt aus Gallien nie zurück? Wohlan! Vernehmt es, aber schweigt noch davon: Es ist mein Wille — unabänderlich: Julian ist zum Cäsar ernannt. Julian wird nach Gallien entsendet.«
Der weite Garten des Palatiums zu Mailand, an dem rechten Ufer des Flüßleins Olona anmutig hingelehnt, wäre schöner gewesen, hätte nicht die schon in der ersten Zeit der Imperatoren zur Herrschaft gelangte Überfeinerung und übertriebene Künstelei von der Natur allzuwenig übriggelassen.
Bäume und Gebüsche waren mit der Schere in allerlei unmögliche Formen verunstaltet; neben die geometrischen und astrologischen Figuren dieser mißhandelten Gewächse waren in den letzten Jahrzehnten allerlei christliche Zeichen getreten: das Kreuz, die Dornenkrone, das Lamm, die Taube, der Fisch. Die Wege waren mit einem Sande bestreut, der alle Farben, nur nicht die des Sandes zeigte.
Trotz der spätherbstlichen Jahreszeit — es war zu Anfang des Novembers — erhielten die vorherrschenden immergrünen Gewächse noch einen Schein des Sommers.
In dem dem Palatium gegenüberliegenden Hintergrunde des Gartens wölbte sich eine Grotte über eine Quelle.
Die Quelle war künstlich — durch Wasserleitung aus dem Flüßchen herbeigeführt —, und die Grotte war künstlich, aus allerlei buntem Gestein, das nirgends in der Welt zusammen vorkam, zu grellster Farbenwirkung zusammengesetzt. Den Weg zu der Grotte umhegten auf beiden Seiten Buchshecken, die von der Schere der Kunst am leichtesten und am schonungslosesten mißhandelt wurden.
Den Gang wandelten auf und nieder zwei jugendliche Frauengestalten, ein Weib und ein Mädchen; beide schön, aber beide nicht den Eindruck blühender Gesundheit ausstrahlend. An der Imperatrix Arm hing ein Mädchen, wenig jünger und noch zarter als die schmächtige Frau. Tränen füllten die Augen der Jungfrau, wie sie zu der etwas Höhergewachsenen emporsah.
»Wie gütig du bist, o Eusebia. Wie dankt dir meine wogende Seele! Ach, nach so vielen Wechselfällen, hin- und hergeworfen von dem Wellenspiel, dem unheimlichen, dieses Hofes, fand ich in dir das einzige Herz, das die arme Schwester des Imperators liebt, dem sie vertrauen darf.« — »Ein hartes Wort, du Empörerin, gegen deinen Bruder, meinen Gemahl!« Die Frau lächelte dazu, aber es war kein glückliches Lächeln. Das Mädchen blieb stehen: »O Teure, Constantius ... kann nur sich selbst lieben; könnte er andre lieben, er müßte doch vor allem dich lieben. Aber ...«
»Er liebt mich nicht«, sprach die Augusta, ruhig weiterschreitend. »Vielleicht hätte er unser Kind geliebt, falls uns der Himmel eins geschenkt hätte. Aber wer weiß!« fuhr sie fort, traurig, wie mit sich selbst redend. »Ein Mädchen hätte er gehaßt, weil es kein Erbe, den Sohn, weil er ein Erbe, ein Nachfolger, vielleicht ein Liebling des Volkes gewesen wäre. Sieh, du Kleine, gerade weil ich selbst nie das Glück der Liebe, der Ehe genossen, deshalb erfreut es mich so tief, dir, geliebte Schwester, zum Glück der Liebe zu verhelfen.« — »Wie gut du bist!« Sie bogen nun in die Grotte ein und ließen sich auf die halbrunde Bank im Hintergrund des Steingewölbes nieder.
»Sieh, Helena«, fuhr die Herrscherin fort, zärtlich das dunkelbraune Haar von der Jungfrau Schläfe hinter das feine Ohr streichend, »Herzensschwester, sind wir doch beinahe — aber zum Glück nur beinahe — Schwestern geworden in ... in ... der Neigung zu einem Manne.« — »Wie? Oh, Eusebia!« rief das Mädchen und sprang auf. Aber mit trübem Lächeln zog die junge Frau sie wieder zu sich hernieder und schlang beschwichtigend den Arm um ihre Schultern. »Beruhige dich! Es hat keine Gefahr.« — »O doch! Wenn er ahnt, daß du ihn liebst, du Vielschöne!« — »Aber ich liebe ihn ja gar nicht. Und er? Er weiß wohl nicht, daß ich lebe, am wenigsten, daß ich seine Base und seine Beherrscherin bin. Vor mehr als einem Jahre war's. Lange bevor dein Bruder oder vielmehr seine Günstlinge, oder sagen wir seine Staatskunst, ihn bewogen hatten, mich Arme auf seinen Thron zu befehlen, als Nachfolgerin seiner ersten Gattin, der Schwester Julians, die schon vor dem Tod des großen Constantin gestorben war. Damals erwachte in mir — ich lebte harmlos in meinem Vaterhause zu Korinth — allmählich der Drang, mehr von der Hellenen Dichtung und Weltweisheit zu erfahren, als unter der strengen Aufsicht des Bischofs, meines Großohms, in unserem Hause von den Mädchenlehrern gelehrt werden durfte; die wußten vielleicht auch nicht mehr, als sie lehrten. Mein geliebter Vater ..., er tat alles, was er mir an den Augen absehen konnte ...«
»Diesen schönen Augen!«
»Er, seine Zärtlichkeit, bemühte sich, mir die früh verlorene Mutter zu ersetzen. Gern erfüllte er mir auch diesen Wunsch und brachte mich nach Athen, wo wir viele Monate in dem Haus eines Verwandten, eines Lehrers an der Hochschule, lebten. Ich sog eifrig und beglückt ein, was mir an Schönheit und an Wissen geboten ward. Der Vater sah das mit Freuden, und eines Tages nahm er mich mit in die Stoa Hadrians, wo die berühmtesten Philosophen Vorträge halten, zuweilen auch für Frauen und Mädchen. Aber hier sprachen nicht nur die Lehrer. Sie gaben oft auch ihren hervorragendsten Schülern Streitfragen zur Besprechung auf. Die jungen Leute mußten dann in Rede und Gegenrede ihre Meinungen vertreten. Laß mich nur gestehen: Ich verstand im Anfang nicht allzuviel! Zumal nicht aus der Alten Munde. Vielleicht, weil ich auf die nicht genug achtgab! Aber einer ihrer jungen Schüler«, sie stockte und errötete leicht, »er war nicht eigentlich schön; andere neben ihm sahen viel stattlicher aus; aber der eine hatte so tiefe Augen! Und seine Stimme war so seelenvoll! Auch was er vertrat, gefiel mir gut, soweit ich es verstand. Kurz, ich gewann ihn lieb; um seiner Augen, seiner Stimme, seiner edlen, feinen Weise, um seiner Begeisterung willen. Ich fehlte nie, wann er sprach. Oft senkte ich die Wimpern, nur seiner Stimme zu lauschen. Und oft versenkte ich den Blick in seine dunkeln Augen, ohne dann — leider! — auf seine gelehrten Worte zu achten. Viele Monde währte das. Da starb mein geliebter Vater, und plötzlich ward mir geboten, Gemahlin des Imperators zu werden! Denn unser Geschlecht ist das vornehmste, reichste, angesehenste im Peloponnes, wo die Constantier noch nicht gar tiefe Wurzeln geschlagen haben. Ich mußte gehorchen. Ich verließ Athen. Den Jüngling sah ich niemals wieder. Er hieß ... Julian.«
»Ah!«
»Beruhige dich, wiederhole ich! Es war nichts als ein Wohlgefallen, ein Wohlgefallen nur der Seele, nie ein Wunsch; und auch Constantius ahnt nicht ...«
»O Gott, es wäre Julians Tod!«
»Und als du unschuldvolles, ahnungsloses Kind — du kennst nicht die Welt und nicht die Hölle, das heißt diesen Hof —, als du mir nun in rührendem Vertrauen erzähltest, wie dich das Bild jenes Unbekannten aus dem Haine von Macellum nie mehr verlassen will, da erkundete ich und brachte es, durch Hilfe des treuen Philippus und noch eines Freundes, bald heraus; dein Unbekannter sei mein ... Bekannter, sei des Imperators Vetter, Julian. Da gelobte ich mir — auch er, meintest du, ja recht gewiß behauptest du's, habe auf dich geblickt mit Augen der Liebe —, diese beiden jungen, hilflosen, von der furchtbaren Macht dieses Hofes abhängigen Menschen sollen glücklich werden. Glücklich machen, o Helena, ist auch eine Art glücklich sein.«
»Für Engel und für Heilige«, flüsterte die Jungfrau und küßte der Freundin schmale, unruhig zuckende Hand.
»Und wirklich gelang es mir, ein wenig Schutzengel zu spielen für Julian und für dich. Dir vereitelte ich eine dichte Reihe von Verheiratungen«, lächelte sie, »die dir drohten.« — »Dank! Dank! Freilich«, lachte das Mädchen, »trug mir meine Weigerung ein paarmal den Zorn des Bruders ein. Wiederholt glaubte er meinen Willen zwingen zu können, indem er mich zur Strafe von dem Hofe, den du damals noch nicht schmücktest, verbannte in ferne Burgen, in Klöster. Und auch Ihn hast du beschützt!« — »Nicht ich allein hätte das vermocht. Aber er hat zwei Freunde, die ihn schon früher, auch jetzt, vor mir — und ohne mich — wiederholt beschirmt haben und die mir ihn vor kurzem retten halfen, als nach der Empörung des Gallus das Schwert des Verderbens an einem Haar über seinem Nacken hing. Constantius hatte befohlen, ihn von Athen hinweg in einer jener geschlossenen schwarzen Sänften abzuholen; du weißt, man pflegt sie nur mit dem Sarkophag zu vertauschen. Zum Glück Julians konnte dein Bruder diesmal nicht Eusebius aussenden mit diesem Auftrag. Der hatte noch mit Gallus zu tun. Einstweilen war am Hof die Nachricht eingetroffen, daß eine Provinz — Gallien — schwer von den Barbaren bedrängt sei. Der Imperator schwankte hin und her. Er wußte nicht, wen dorthin schicken. Da faßten ich und ein andrer — einer der beiden Freunde Julians — den kühnen Gedanken ... Ich darf noch nicht mehr verraten, aber der Jüngling wird hier in dem Palast etwas ganz andres finden als den ihm zugedachten Tod; zum Beispiel: dich, du holdes Kind.«
»Dank, Dank! Aber sage mir — wenn du darfst — Du hast ihn doch nur so kurze Zeit gesehen, gesprochen ...« — »Gesprochen? Nie!« — »Woher hast du so Eindringendes über ihn erfahren?«
»Ich sagte dir ja: er hat zwei Freunde.« — »Hier am Hof?« — »Ja, einen. Und noch einen in der Ferne.« — »Am Hof. Ich ahne: den Edelsten, Weisesten ...! Und noch einen in der Ferne. Einen der Mächtigen in den Provinzen?« — »O nein! Es ist der Unscheinbarsten einer im Reiche. Ein Büßermönch. Der hat mir viel von Julian erzählt, er kennt ihn von Jugend auf. Und er liebt ihn wie ein Vater. Und mein trefflicher mutiger Vater hat den ihm befreundeten Mönch beschützt, als der Mönch — und noch einer — in jener blutigen Nacht zu Nikomedia«, sie schauderte leise, »die wenigen Überlebenden aus Julians Hause gerettet hatte ... Der Mönch ist ein Jugendfreund des Arztes, des Sternweisen. Was aber ihn von Anfang an mit solcher Liebe an Julian wie an Gallus knüpfte, ich weiß es nicht zu erklären. Hier liegen dunkle Geheimnisse. Einmal, als ich ihn geradezu darum befragte, geriet der arme Johannes in gewaltigste Erregung, Tränen brachen ihm aus den müden Augen, und er beschwor mich, niemals darauf zurückzukommen. Aber du — fast möcht ich dich beneiden — du weißt ja viel, viel mehr von Julian als ich; durch seine Schwester, mit welcher du im Kloster in Kleinasien, in dem sie verbannt, abgeschlossen, vergessen von der Welt lebte, mondelang eine Art von leichter Ungehorsams-Haft teiltest.«
»Ja, es war eine gute Zeit; herzlich lieb gewann ich die schöne sinnige Juliana. Nur ist sie so viel frommeren Sinnes denn ich. Bewundernd sah ich auf zu ihrem glühenden Glauben. Und ich ahnte damals wahrlich nicht, daß ich den von ihr so warm geliebten Bruder — und doch waren sie beide Kinder, da sie auseinandergerissen wurden — ja daß ich bald ihre beiden Brüder — durch Zufall — sehen würde. Zuerst traf ich auf Gallus. Ich konnte ihn erfreuen durch die Nachricht, daß die Schwester lebe. Dann sah ich Julian selbst in Macellum, wo ich einige Wochen rastete auf der Rückreise an den Hof, nachdem der Bruder mir den jüngsten Ungehorsam gegen ihn und das neueste ›Nein‹, für einen persischen Prinzen, verziehen hatte. Die Sänfteträger, meine Sklaven, kannten ihn und nannten mir meinen halbgefangenen Vetter. Ach, Eusebia, er ist nicht schön — du sagst es — aber dies Auge! Und diese Stirn! Und der Adel, die Reinheit der Seele in diesem Antlitz! Wer ihn einmal gesehen; nie kann er diese Züge vergessen.« — »Du hast recht«, hauchte die blasse Frau, leis, aber tief erseufzend. — »Wie wird sich Juliana freuen, darf ich sie hier begrüßen! Denn du sagtest, sie komme hierher. O wie schön wird uns zu dritt dann das Zusammenleben erblühn! Welche Jahre der Freuden liegen vor uns!« — »Wer weiß«, sprach die junge Frau. »Ich glaube nicht ...« — »Wie meinst du das?«
»Ich meine, wir sollen ... oder doch ich soll nicht auf lange Zukunft hinausblicken. Nicht allen Menschen ist ein langes Leben zu wünschen. Aber«, hob sie nun an, sich zur Heiterkeit anstrengend, »auch sonst ... wer weiß! Vielleicht freuen wir uns zu früh. Denn wir machen ja die Rechnung ohne den Wirt.« — »Du fürchtest ... mein Bruder? Er könnte schwanken. Seine Gnade könnte ...?« — »Auch das vielleicht. Allein es ist noch ein anderes ... Er ...« Sie hielt inne und sann ernstlich nach. — »Was ist, o teure Freundin? Was hehlst du mir?« — »Ich darf dir ... zur Stunde ... noch nicht alles sagen. Der Imperator behielt mich heute Nacht zu geheimer Zwiesprach zurück, nachdem er die beiden Männer entlassen. Er vertraute mir noch andere Pläne an ...« Sie verstummte. Sie prüfte das Antlitz des jungen Mädchens. »Wie ahnungslos!« dachte sie. »Darf ich sie mit einer Hoffnung zu den Sternen heben, die dann, versagend, sie plötzlich stürzen läßt?«
»Was sinnest du so Ernstes, Eusebia?«
»Mein Kind«, sprach diese, ihr über das dunkle Haar streichend, »glaubst du ... du sprachst von Blicken der Liebe Julians ... aber glaubst du ...? Mehr als ein Jahr verstrich, seitdem ... er trat dann in die Welt hinein; er hat seither wohl gar manche andere gesehen ...« — »O Eusebia!« rief das Mädchen tief erschrocken. »Oder wenn nun der Imperator« — hier achtete sie scharf auf die Wirkung ihrer Worte — »als Bedingung der Begnadigung ihm auferlegt, die Tochter irgendeines vornehmen Hauses heimzuführen? Glaubst du, daß ...? Was soll er dann tun?« — »Sie zur Gattin nehmen und mich vergessen! Mich ewigem Sehnen überlassen!« rief Helena und warf sich, laut aufschluchzend, an der Freundin Brust.
Beschwichtigend streichelte die junge Frau ihr die Wange. »Stille! Fasse dich, törichtes Kind. Ich zweifle ja nicht an seiner Beständigkeit ...« — »So innig liebt sie ihn?« sprach sie zu sich selbst. »Nun, desto glücklicher wird sie ihn machen. Schäme dich, Eusebia.«
Die Freundinnen wurden nun aufgestört durch nahende Schritte.
Alsbald traten in die Grotte Hand in Hand Philippus und Johannes, der Büßermönch. Nach ehrfurchtsvoller Begrüßung der Frauen begann der Arzt: »Du hast mir befohlen, Augusta, dir alles zu berichten, was ich über das Eintreffen unseres Schützlings erfahren kann. Er ist nun in Bälde zu erwarten. Ein Eilbote, vorausgesandt von Julians bisherigem Wächter, meldete soeben deinem Gemahl, daß der Gefangene, als solcher gilt er noch immer, vor Sonnenuntergang eintreffen wird. Es ist Befehl gegeben, ihn sofort in das Palatium und vor den Imperator zu führen. Gestern noch sollte er dort ...«, er stockte mit einem fragenden Seitenblick auf Helena. »Ohne Sorge«, ermutigte die Frau mit ihrem herzgewinnenden Lächeln. »Die Freundin ist eingeweiht. Sie ist auch seine Freundin. Willkommen, frommer Vater. Was führt dich her?« fragte sie, zu Johannes gewendet. — »Wie schon oft, die Sorge um ihn, um Julian, hohe Herrin. Ich erfuhr zu Rom, wo ich einige Wochen des Büßens, abgeschlossen von der Welt, am Grabe der Apostelfürsten gebetet hatte, von dem Untergang des unseligen Gallus. Ich ahnte, daß dieser Schlag auch den Bruder treffen werde, und ich eilte hierher zu dem altbewährten Rater und Retter, zu Philippus, dem besten Freund des unglücklichen Hauses des Julius.« »Nach dir, o Johannes!« entgegnete dieser. »Ganz verzweifelt pochte der Gute vor einer Stunde an meine Tür. Nun, ich konnte ihn trösten.« Und er klopfte ihm freundlich die Schulter.
»Dank, Dank euch beiden!« sprach Helena, jedem der Männer eine Hand hinreichend. Die Imperatrix erhob sich. »Laßt uns nun ein wenig wandeln; dort unter den schönen Zypressen. Es ist wohl noch manches zu bereden.« Sie winkte den Arzt näher an sich heran und schritt mit ihm den beiden andern voran. »O Philippus!« sprach sie leise, »mein Herz ist schwer und traurig. Wohl haben die Sterne und du ihn vor dem nahen schimpflichen Tode gerettet. Allein wehe um ihn, wenn deine Weissagung sich erfüllt! Zwar hat sie — ich merkte es wohl — sie allein meinen Gemahl umgestimmt. Aber ach, schicken wir ihn nach Gallien, so schicken wir ihn ja, wie du voraussiehst, in frühen Tod.«
»Ja, Herrin«, seufzte Philippus. »Es ist so, es wird so sein. Aber sieh, nach meiner Meinung von der Welt und von dem Wert des Lebens ist diese Entschließung doch das größere Glück für ihn. Nicht nur, weil sie allein ihn dem Henker entriß, auch über die Gefahr des heutigen Tages hinaus. Ein junger Römer, ein Sproß des Herrscherhauses, edel von Sinnesart, schwungvollen Geistes, wie alle berichten, wird er nicht frühen Tod willkommen heißen? Den Heldentod, nachdem er das Römerreich aus schwerer Gefahr gerettet, eine verlorene, eine unentbehrliche Provinz zurückgewonnen, unsterblichen Heldenruhm errungen hat? O Augusta, ich glaube, auch du denkst so und hoffentlich — nein gewiß —, auch er. Wen die Götter lieben, dem senden sie das Glück, in der Schöne der Jugend zu sterben. Als Jüngling stirbt Achilleus, als Jüngling Alexandros. Gönnen wir unserem Schützling das schöne Los. Schönheit, ach Schönheit!« Er blieb stehen und blickte in Begeisterung zu der Frau neben ihm empor. »O Eusebia, du, von den Wogen der Schönheit umflutet, du weißt es nicht, wie schmerzlich sie der Häßliche entbehrt.« »Nun«, lächelte die, »wenn das dir ein Stachel ist, diesen kann ich dir aus der wunden Seele ziehen. Es ist ja wahr, deine Gestalt ist ...« — »Verkrüppelt.« — »Aber, wenn du es denn gerne hörst, du eitler Sternweiser; dein Antlitz ist sehr schön. Ich freue mich an deinem Auge, das selbst einem Sterne gleicht, an deinen edlen Zügen, sooft ich sie betrachte.«
»Du bist mitleidig, Eusebia«, seufzte der Höckerige. »Aber auch dein Mitleid tut wohl. Jetzt, jetzt sind viele Jahrzehnte drüber hingegangen. Ich habe längst entsagt. Aber wie furchtbar litt ich einst unter dieser meiner Entstellung! Denn auch ich war einmal jung, Eusebia, und heiß schlug das Herz in dem verkrüppelten Leibe. Und nun sich sagen müssen: Hätte nicht die Amme dich als Kind auf die Erde stürzen lassen, du könntest, an Geist und Kraft fehlt es dir nicht, mit allen Nebenbuhlern und allen Mitbewerbern kühnlich in die Schranken treten und ringen um ... um den höchsten Preis. So aber, ein elender Krüppel, mußt du zur Seite stehen und zuschauen, hoffnungslos, wie andre Jünglinge das schönste, edelste Geschöpf umwerben. Oh, es war zum Verzweifeln!« Er blieb stehen und atmete schwer. »Armer Freund«, sprach die Frau und legte leise die Hand auf sein graues Haar. »Und wer, wer war das Weib, für das du bis heute solche Wärme des Gefühls bewahrt hast? Lebt es noch?« »Ach, ich weiß es ja nicht«, klagte der Traurige. »So vieles verraten mir die Sterne; aber von ihr schweigen sie mir, wie die Menschen. Sie ist verschwunden, spurlos! Seit achtzehn Jahren! Denn wisse nun, edle Frau — ja du sollst es wissen, du sollst erkennen, daß meine Liebe, meine Sorge für Julian nur der Selbstsucht entsprossen ist — Julianus ist der Sohn meiner heißgeliebten Irene Basilina.«
»Armer Freund! Aber wie, wie ist all das gekommen, wie hat es geendet? Wie griff das in dein Leben ein?« — »In meines und das von andern. Siehst du ihn da, in diesem Gang neben uns, mit Helena wandeln, den Mönch, den Einsiedler, den Büßer Johannes? Auch daß er das Mönchsgewand trägt mit dem Stachelgürtel des Büßers; auch das haben die Sterne durch Irene gefügt.« — »Was werde ich hören?« — »Vor mehr als dreißig Jahren lebten in Rom zwei Brüder aus dem vornehmen Hause der Manlier, Marcus und Cajus. Die Jünglinge waren mir, dem etwa Gleichaltrigen, nahe befreundet, und nahe befreundet auch waren unsere beiden Geschlechter den edlen Fulviern. Die Tochter dieses Hauses war die schöne, die unvergleichliche Irene Basilina; ach ihre Augen! Ihresgleichen gab es nie auf Erden, den Augen der Gazelle vergleichbar in ihrem sanften feuchten Glanz! Wir alle, auch ich, der hoffnungslose Krüppel, wie meine beiden Freunde, ach, wie alle Jünglinge Roms, waren von Liebe ergriffen zu der Wunderbaren. Sie aber hielt alle in gleicher kühler Ferne. Keinen zeichnete sie aus vor den andern.
Eines Abends hatten die Manlier mich und einige andere zu sich gebeten zum Schmause. Auf den Befehl des Marcus, des ungestümen, heißblütigen jüngern Bruders, trugen die Sklaven die Schüsseln auf, obwohl Cajus noch fehlte. Schon hatte der feurige Wein von Sizilien mehrfach gekreist; ungeduldig schalt Marcus auf den Bruder, der noch immer fehlte; argwöhnisch erzählte er, Fulvius, der Vater, habe Cajus — allein, nicht auch ihn — auf mehrere Tage in seine Villa bei Tibur zu Gast geladen, als der Vermißte eintrat, strahlender Miene; er hielt eine goldene Spange in der Hand und rief frohlockend: ›Wünschet mir Glück, Bruder und Freunde! Denket nur: In diesen Tagen, vor meinem Abschied von den Fulviern, trug ich der Herrlichen die Ode vor, die ich auf die Reize der schönen Villa, dies liebliche Gebäude des Anio gedichtet. Die Strophen gefielen der Jungfrau so sehr, daß sie, ihre Mutter um Erlaubnis bittend, diese Spange von ihrem Mantel löste und mir schenkte. Wer ward je so von ihr ausgezeichnet? Ich bin der glücklichste der Menschen.‹
›Aber nicht mehr lang!‹ schrie rasend vor Eifersucht sein Bruder, riß mit Riesenkraft die zentnerschwere bronzene Amphora vom Boden auf, hob sie mit beiden Händen in die Höhe und sprang damit auf den Bruder los, ihm den Schädel zu zerschmettern.«
»Entsetzlich!« — »Der, in seiner Todesangst, raffte vom Seitentisch das spitze lange Messer, mit dem die Sklaven den Braten zerlegt hatten, hielt es zur Abwehr gerade vor sich hin. Blindlings rannte der Wütende hinein. Die Klinge durchbohrte das Herz, die Amphora entfiel den Händen, aufschreiend stürzte er nieder, mit einem gräßlichen Fluche den Bruder verwünschend, den er über und über mit seinem Blute bespritzte. Noch einmal ballte er die Faust gegen ihn, dann starb er. Von Stunde an entsagte der unselige Brudermörder wider Willen der Welt, in der ihm bei seiner reichen Begabung und Bildung, seiner Schönheit, seiner Abkunft aus vornehmem, vielbegütertem Hause jede höchste Stufe ersteigbar war. Der große Constantin hatte ihn — wegen seiner Tapferkeit in dem Gotischen Kriege — ausgezeichnet, ihn in die Schar seiner besten Schola aufgenommen. Ohne Abschied von den verzweifelten Eltern, von mir — von ihr — verschwand er spurlos auf lange, lange Zeit. Bald darauf ward die schöne Irene — ›Schönauge‹, ›Euopis‹, hieß sie in ganz Rom — die Gemahlin des ausgezeichneten Julius, des edlen Bruders des großen Constantin.
Julius, von jeher mein Gönner, bestand nun darauf, daß ich der Arzt, der nächste Freund seines Hauses ward. So sah ich die einst Geliebte — ach, die heute noch Geliebte — gar oft; meine schwache Kunst durfte ihr und den Ihrigen zuweilen nützen. Ich begleitete sie von Rom nach Nikomedia, als Constantin seinem Bruder ein hohes Amt in jener Stadt, in jener Provinz übertrug. Da — kurze Zeit vor dem Thronwechsel — pochte an meine Tür ein Mönch, ein Einsiedler, ein Büßer; ich erkannte ihn nicht. Wer sollte den glänzenden, jugendschönen, heiter weltlich gesinnten Krieger Cajus wiedererkennen in dem niedrigen, von Demut und Reue gebeugten, fast greisenhaften Büßer, der sich Bruder Johannes nannte! Es war eine jammervolle Wandlung — auch des Geistes. Vergessenheit nicht nur ..., nein, Haß und Verachtung hatte der Reuekranke zugewandt aller weltlichen Lust nicht bloß, nein, auch aller weltlichen Wissenschaft und Kunst, aller Freude an Waffenwerk und Staat; all das galt und gilt ihm als sündhaft, bös, teuflisch oder doch als gefährlichste Versuchung. Nur Selbstverleugnung, Reue, Buße, Zerknirschung, Feindesliebe erfüllen ihn. Wahrlich, ich bin nicht ein Freund des jetzt alleinherrschenden Glaubens, und manches auch in Bruder Johannes erscheint mir krank. Aber das ist wahr: An diesem Unseligen hat der Christenglaube Wunder gewirkt; er hätte in Selbstmord, in Wahnsinn geendet, hätte ihn nicht die Lehre von der äußersten Selbstüberwindung, von der allesverzeihenden Feindesliebe, von dem Leben nur für andere, erfüllt und gerettet.
Ich brachte nun den frommen Büßer — nach heftigem Widerstreben — dazu, die Jugendliebe mit mir aufzusuchen, sich ihres Eheglücks, ihrer blühenden Kinder — zwei Knaben und ein Mädchen — zu erfreuen. Ich glaube, er gab mir nach, weil er sich zwingen wollte, sich ihres Glückes mit einem andern zu freuen. Und wie freute er sich, wie hat er sich als rettender Freund bewährt in all diesen Jahren! In jener Mordnacht pflegte er den schwerkranken — wir glaubten, den sterbenden — Gallus. Ganz wie ich, der dazu verpflichtete Arzt, trotzte er den ansteckenden Beulen. Und als nun der Mord des Hausherrn geschehen, als nur durch Zufall die Mutter mit den Kindern verschont geblieben war, da war er es, der diese vier rettete, mit äußerster Gefahr des Lebens. Denn jeder war mit dem Tode bedroht, der sich eines der geächteten Häupter annahm.« — »Aber nicht er allein konnte das. Der Augustus hat mir mitgeteilt: Du vor allem hast ihm damals jene weitere Blutschuld erspart. Ich glaube, er dankt es dir im stillen.« — »Nun ja, ich flüchtete — mit Hilfe deines Vaters —, die Mutter, die bewußtlose, in das Haus meiner Schwester, wie Johannes die drei Kinder in dem Asyl einer Basilika barg. Damit war — nach dem jetzt anerkannten Recht der Kirche — wenigstens das Leben der schuldlosen Kinder gerettet, und drei Tage Zeit waren gewonnen, nach welchen die blutige Mordgier eines Eusebius nicht mehr allein den neuen ›Herrscher‹ beherrschte. Zwar ward die Zuflucht von den Spähern des Eunuchen entdeckt, und nach Ablauf der Schutzfrist von drei Tagen mußte Johannes die Geborgenen herausgeben den heischenden Prätorianern, aber ihr Leben wenigstens war — dem Rechte nach — gesichert. Die drei Geschwister wurden dann auseinandergerissen; keines wußte, jahrelang, ob die andern noch lebten. Auch die Beamten des Staates, des Hofes, wußten deren Versteck nicht; ebensowenig den Verbleib der unglücklichen Mutter, die, während ich in den Palast befohlen ward, den zornigsten Verweis des Imperators entgegenzunehmen und die Einziehung der Hälfte meines Vermögens, von einem Centurio aus den Armen meiner Schwester gerissen worden war und seither verschollen ist. Ob sie wohl noch das Licht der Sterne schauen, die wunderbaren Augen?« Erschüttert hielt er inne, keuchend hob sich ihm die schwer atmende Brust.
Die blasse Frau erfaßte seine beiden Hände: »Philippus, du bist — ach du bist, wie wir alle sein sollten, ob wir an Christus glauben, ob an Jupiter. Aber sage mir, wie konntest du — eine solche Seele — dich erhalten an diesem Hof, wo Eusebius waltet und die Seinen?« — »Dein Gatte glaubte zu entdecken, daß ich ihm als Arzt unentbehrlich sei. Es gelang mir, seine wirklich schwache Gesundheit zu kräftigen, von gefährlichen Krankheiten ihn herzustellen; ich hatte seinem großen Vater, dem Gönner und Wohltäter unseres Hauses, versprochen — er hatte großes Vertrauen in meine Heilkunst —, dem Sohne treu zu dienen. Bald vertraute Constantius nicht nur meiner Kräuterkunde, auch meiner Kenntnis der Lehren, der Weissagungen der Gestirne. Und so blieb ich, weil ich's versprochen habe und weil ich glaube, daß es gut ist für dies geliebte Reich der Römer, daß an diesem Hof ein Mann ist, der stets die Wahrheit redet.«
»Der Imperator erträgt sie nur von dir und mir.«
»Und doch — wie wenig vermag ich über ihn! Meinen Bitten gelang es nie, diese achtzehn Jahre hindurch, über den Aufenthalt der vier Verschwundenen von ihm etwas zu erfahren. Durch andere, durch den Mönch, der unermüdlich in allen drei Erdteilen nach ihnen suchte, durch einen Schüler in der Sternkunde, Lysias, erkundete ich einzelnes. Vergebens bat ich den Herrscher, die noch Lebenden von ihnen zu vereinen, daß sie gemeinsam leichter ihr Schicksal tragen möchten. ›Und gemeinsam wirksame Rachepläne und Verschwörungen einfädeln?‹ Diese Gegenfrage war all mein Bescheid. Ob wohl die Mutter, die Schwester noch lebt?«
»Die Schwester lebte noch vor kurzem. Das erfuhr ich gestern von Helena, die sie in Kleinasien in einem Kloster traf.«
»Dank den Sternen! Aber die Mutter? Ich darf nicht ruhen und rasten, um sie zu sorgen! Nicht nur die alte, nie erloschene Liebe drängt mich dazu; ein feierlicher Eid, den Johannes und ich in jener grausen Stunde an der Leiche des gemordeten Freundes schworen, nie im Leben abzulassen, den vier Unseligen Stab und Stütze zu sein. Aber sieh, Johannes winkt; es ist Zeit für ihn, abermals zu büßen; er muß noch in die Basilika; er rutscht dort auf den Knien um den Altar, ich weiß nicht, wie viele Male. Es ist doch ein wunderbar Gemisch, das drei Jahrhunderte aus den schlichten Worten jenes armen edlen Judenjünglings zusammengebraut haben! Immer, wenn man das Ganze verwerfen, verwünschen möchte, erlebt man — neben Früchten des Wahnsinns — Wunder, gewirkt durch diese Lehre, die uns fast zwingen, an ihre Göttlichkeit zu glauben. Warum auch nicht? Die große Weltseele lebt in uns allen; weshalb soll sie nicht in jenem unvergleichlichen Nazarener in reicherer Fülle und edlerer Reinheit gelebt haben als in uns andern? Platon heißt der Göttliche; warum nicht Christus?«
»O schweige, Philippus. Bitte, verstöre mir nicht die Ruhe der Gedanken! Wecke mir nicht die Zweifel, die ich mit Mühe beschwichtigt habe. Ich bin des Constantius Gemahlin; ach so vieles scheidet unsere Seelen! Laß uns nicht auch im Glauben geschieden sein. Du aber — mir ist —, mir ist, o weiser Freund, du hast allen Glauben verloren!«
»Ja; den an die Götter, die alten und die neuen, und — was noch trauriger zu sagen — auch den an die Menschen, zumal an die Alten!« — »O du Beklagenswerter! Ich könnte nicht leben, wenn ich nicht glaubte! Die Menschen zwar; ach nur an wenige glaube ich noch, seit man mich zwang, die Menschen zu beherrschen! Aber mein Gottesglaube! Sieh, Philippus, unser Haus hat früh der Lehre Christi sich zugewandt, lange bevor diese zur herrschenden erhoben ward. Deshalb halt ich auch an dieser Lehre und an Christi heiligem Bilde fest, mag seine Kirche — ich seh es ja selbst, mit widerstrebenden Augen — verunreinigt sein, seit sie herrscht.« — »Sie kann nur verfolgt sein oder verfolgen, scheint's« — »O sprich nicht so. Ich ...« Da faßte der alte Mann ihre schmale, durchsichtige Hand und sprach: »Du edle, gute Frau! Wohl dir, daß du glaubst, daß du glauben kannst! Dir ward darin das beste, das beneidenswerteste Los. Und nie und nimmer werde ich je den Zweifel wecken in einer Seele, die der volle Friede des Glaubens beseligt; es wäre Frevel. Weiß ich denn, ob meine Weisheit, die mich befriedigt, befriedigen muß — weil ich nichts Besseres habe —, die bittere Weisheit des völligen Entsagens, eine andere Seele nicht zur Verzweiflung treibt?« Er seufzte tief und fuhr mit der Linken über die Stirne, so weiß wie Elfenbein. »Armer Freund!« klagte die Frau, seinen Händedruck erwidernd, »an gar nichts glauben! Es muß dir ja das Herz abstoßen.« — »Doch nicht! Ich glaube ja wirklich an die Sterne; ich glaube, daß sie dem, der reinen Herzens ihre Geheimnisse erforscht, die Wahrheit verkünden.« — »Und das ist alles? Und du glaubst nicht an die hilfreich leitende, allgütige Vorsehung?« — »Kind! — hohe Frau, wollte ich sagen —, lassen wir das!« — »Und du glaubst auch nicht — denn ich ahne wohl, was du insgeheim einwendest: den so häufigen Sieg des Bösen über das Gute auf Erden! — an die ausgleichende Gerechtigkeit nach dem Tode? Du schweigst. Ich beklage sie; aber großartig ist sie, diese Kraft der Entsagung.«
»Nicht doch«, wehrte er ab. »Ich kann mich darin gar nicht messen mit einem andern, und noch dazu mit einem Jüngling, und schlimmer noch: gar mit einem Barbaren.« Er versank ein wenig in Sinnen; dann fuhr er fort: »Denke nur, da war ein junger Germane, als Geisel an den Hof des großen Constantin gesandt, als Knabe von fünfzehn Jahren. Jener gewaltige Herrscher — die Menschen erkannte er, das muß wahr sein — entdeckte reiche Gaben in dem Jungen; er gewann ihn lieb. Er ließ ihn zusammen mit Söhnen der vornehmsten Senatorenhäuser erziehen, in Rom, in Memphis, in Athen, in Byzanz, in Nikomedia; in alle christliche, heidnische und mystische Weisheit einweihen. Wohl achtzehn Jahre lang. Später kam er wieder an den Hof, wo ich ihn genau kennenlernte, bis er vor kurzem — ein reifer Mann — nach Haus entlassen ward. Der ist von allen Männern, die ich je gesehen, der merkwürdigste.« — »Warum?« — »Ja, denke dir nur! Ich glaube doch noch an die Sterne, ohne diesen süßen Trost hielt ich's nicht aus. Dieser Germane aber sprach, als wir nach vielen langen Nächten des dialektischen Ringens voneinander Abschied nahmen: ›So siehst du also, teurer Meister, ich muß auch deines Trosts entraten. Ich glaube auch an die Sterne nicht.‹ — ›Unseliger‹, rief ich, ›an was dann glaubst du?‹ — ›An die Notwendigkeit. An mein Volk. Und an mein Schwert‹, sprach er, gab mir die Hand und ging. Ich hab ihn nie wieder gesehen. Möchte wohl wissen, was aus ihm geworden ist. Ob ihn das Leben nicht gebrochen hat, diesen stolzgemuten Heldensinn, der, ganz stützenlos, nur auf sich selber steht?«
»Gut für deinen jungen Freund, daß er nicht zu andern an diesem Hofe so gesprochen hat. So was kann ich, mag ich gar nicht denken!« — »Ja, dein Gatte sorgt jetzt so eifrig für das ewige Seelenheil seiner Untertanen, daß er darüber ihre verzweifelten Klagen über ihr — freilich nur lebenslängliches — Unheil unter seiner Herrschaft überhört. Und wenn er doch nur endlich einmal wüßte, ob das Christentum die einzige Wahrheit auf katholisch oder auf arianisch ist? Auch mich hat er damit gequält. Aber ich erwiderte grob, meine Sterne und mich möge er in Ruhe lassen; wir verständen nichts von ›o‹ und ›oi‹.« — »Ich gestehe«, lächelte die blasse Frau, »ich auch nicht.« — »Wirst's schon noch lernen müssen, arm Töchterchen — erhabne Augusta, wollt ich sagen. Und zu seinem Unglück neigt dein Herr neuerdings sehr dem arianischen ›oi‹ zu, statt dem alleinseligmachenden katholischen ›o‹. Mir ist's ganz unglaublich gleichgültig, wie du weißt. Aber ...« — »Nun?« — »Da lebt — fern in Alexandria — ein Mann, ich kenne ihn genau, seit zwanzig Jahren, der verteidigt nun einmal aus heiligster Überzeugung das katholische ›o‹. Wenn Constantius mit dem ernsthaft anbindet, er hat schon ein wenig angefangen, dann ist er verloren. Dazu brauche ich nicht in die Sterne zu gucken.« — »Und wie heißt dieser Gewaltige?« — »Athanasius, der ›Unsterbliche‹. Merk dir den Namen. Denn wahrlich: Er wird unsterblich sein. Aber Johannes winkt; ich folge. Leb wohl, gütigste der Frauen.«
Die Sonne neigte nun zum Untergang, rötliches Dämmerlicht flutete über die Ebene des fernen Po und ließ die Türme und Wallmauern von Mailand wie von Purpur übergossen erstrahlen. Da hielt ein kleiner Reiterzug, armenische Söldner waren es, vor dem südöstlichen Tor, der Porta Romana. Während der Anführer mit der Torwache verhandelte, spornte ein Unbewaffneter — nur trug er statt des Reisehutes einen Helm — sein Roß an die halboffne schwarze Sänfte, die in der Mitte des Zuges geführt wurde.
»Wir sind am Ziel, Julian«, rief der Reiter, ein stattlicher Jüngling, der ein paar Jahre älter schien als der Gefangene. »Da vorn begrüßen dich die Zinnen von Mailand.«
»Blutigrot ist ihr Gruß, moriturum salutant!« erwiderte Julian, den Kopf aus dem Fenster der Sänfte vorstreckend. »Zum letzten Male wohl sehe ich ihn scheiden, den schönsten der Götter. Und Abschied nehmen nun auch wir, o mein Jovian. Wie soll ich dir danken für all deine Freundschaft, deine todesmutige Treue! Fast mit Gewalt ertrotztest du's, den Verhafteten aus Athen, mitten aus deinen, aus unsern strategischen Studien herausgerissen, bis hierher begleiten zu dürfen. Weh um deine künftige Laufbahn! Du hast dich den Mächtigen verdächtig gemacht. Aber kehre jetzt wenigstens um; tritt nicht freiwillig in die Höhle des ...«
»Löwen — willst du doch nicht sagen? Wo wäre da der Löwenmut und die Löwengroßmut? Nein, Freund Julian. Der Himmel hat mir nicht den kleinsten Teil deines Geistes gegeben, aber du sollst es erleben, es gibt noch ein treues Herz, es gibt altrömische Freundschaft. Das Tor geht auf. Rasch hinein.«
Damit spornte er sein Pferd und sprengte hinter dem Befehlshaber über die Fallbrücke. Die Sänfte folgte. »Wie heißt es doch in meinem Drama ›Euridike‹«, sprach Julian: »Das Tor des Hades schließt sich rasselnd hinter mir, doch hohe Götter walten in dem Hades auch.«
»Kein übler Vers und auch kein übler Trost.«
Zu derselben Zeit ging der Imperator mit hastigen, ungleichen Schritten in seinem Gemach auf und nieder.
»Jetzt — jetzt muß er herein sein. Jetzt hab ich ihn! Wer weiß, ob es nicht doch klüger wäre, den Rächer für immer unschädlich zu machen. Freilich: Gallien und die Barbaren und Philippus mit seinen Sternen! Jedenfalls entscheide ich mich erst, nachdem ich den Knaben von Angesicht gesehen. Und durch Geiseln will ich seine Treue binden, die seinem Herzen nahestehen. Sie sind doch schon angelangt?«
Er trat auf die Schwelle des Gemaches; hier wachte statt des riesigen Alemannen ein Neger aus der Libyschen Wüste; der hockte auf den Fersen und betete zu einem Götzen, der auf ein Straußenei gemalt war; fast nackt, trug er nur einen scharlachroten Schurz um die Lenden, in dessen Gurt ein langes, geschweiftes Messer stak. Des Constantius Züge verfinsterten sich bei dem Anblick: »Ah, ein schwarzer Hund heut statt eines weißen? Hm, ja! Den Germanen hat Eusebius dem Henker überantwortet.« Er winkte dem Neger; der sprang auf und kreuzte demütig die Arme über der nackten Brust. Der Augustus fragte: »Die beiden Frauen ..., sind sie eingetroffen?« — »Schon heute früh, o großer Herr der Erde.« — »Und getrennt untergebracht?« — »Wie du befahlst, o herrlicher Leu. Die ältere, die aus Aquilea kam, in den Bädern Diokletians; die jüngere, die aus Syrakus, in dem Garten deiner Villa am Lambrus.«
»Gut. Befehle ich, den Mann zu verhaften, den ich jetzt erwarte, werden die beiden Frauen sofort zurückgeführt in ihre Verbannungen. Andernfalls bescheidest du sie hierher in den Palast, aber in die Gemächer meiner Gemahlin. Da ertönt der silberne Hammer im Vorsaal. Mein Vetter kommt. Du untersuchst seine Gewänder; er ist gefährlich — hörst du? Sehr! Nicht das kleinste Messer, nicht eine Nagelfeile duldest du bei ihm. Eile ihm entgegen ...«
Alsbald standen sich der Imperator und sein Gefangener gegenüber.
Julian blieb hart an der Schwelle stehen, Constantius hatte sich auf einen erhöhten Sitz niedergelassen; das Gemach war durch mehrere Flammen duftenden Öles auf Schalen hoher Kandelaber wir durch Tageslicht erhellt. ›Das also ist der Träger der römischen Herrlichkeit‹, war Julians Gedanke, ›er ist ihr nicht gewachsen.‹
Constantius aber dachte: ›Dieser bleiche Knabe — mit den schwärmerischen Augen —, er ist nicht gefährlich.‹ Nach längerem Schweigen begann der Imperator: »Vetter Julian, was erwartest du hier zu finden?« — »Den Tod.« — »Hast du ihn verdient?« — »So wenig wie mein Vater.« — »Und dein Bruder? Hat der nicht den Tod verdient?« — »Leider, ja.« — »Das gefällt mir, dieses Ja. Wäre ich nur für mich vorsichtig, hättest du Ursache, zu fürchten. Aber ich bin Gott« — er schlug das Zeichen des Kreuzes — »verantwortlich für dies Reich der Römer. Ich bedarf dein; nicht ich, vielmehr das Reich der Römer: Willst du ihm dienen?« — »Ja, treu bis in den Tod.« — »Willst du auch mir treu dienen?« — »Dem Reich und dir.« — »Das gefällt mir, Vetter.« ›Er ist von kindlicher Einfalt‹, dachte er beruhigt. »Höre: Ich brauche einen Vertreter in Rat und Schlacht. Unverwandte Vertreter sind gefährlich, wir haben's erlebt! Ich wählte darum deinen Bruder; wir haben's erlebt, was davon kam. Wenn ich nun dir vertraue, wirst du — wie er — mein Vertrauen mißbrauchen?« — »Nein.« — »Wohlan. Ich will es mit dir wagen. Gallien ist ... ist ... stark bedroht, vier ... fünf Städte sind in der Hand der Germanen.« — »O Schmach und Schande!« — »Hm, auch dieser edle Zorn gefällt mir.« ›Brächte doch auch ich solch töricht Aufflammen zuwege‹, dachte er. »Willst du ausziehen, Gallien dem Römerreich zu erhalten?« Begeistert schritt der Jüngling drei Schritte vor. »Ich ...?« — »Bleib! Bleib, wo du stehst! Nicht näher! Nun, willst du?«
Gluten stiegen in Julians bleiches Antlitz, als er zögernd wiederholte: »Ich? — Ich bin kein Feldherr!« — »Ah«, meinte Constantius mit Behagen, »ich seh's, du fürchtest die Germanen.« — »Beim Helios — nein.« — »Bei ... bei ... wem ... schwörst du, Unseliger?« schrie Constantius aufspringend. »Vergib ..., beim Genius Roms!« — »Auch noch sehr heidnisch. — Also du willst ...?« — »Ich ... ich weiß nicht, was ich können werde. Aber ich habe den besten Willen; nichts steht mir höher als dies Reich der Römer und sein Wohl, das darfst du glauben.« Bei diesen Worten verschönte sich das jugendliche Antlitz, die dunklen Augen leuchteten.
»Schwöre mir, Gallien nicht zu verlassen, solang ein einziger Barbar unbesiegt in Gallien lebt.«
»Ich schwöre.« — »Gut, ich glaube dir, Julian. ›Der Knabe ist ein Schwärmer durch und durch!‹ Aber nicht deinem Wort allein; ich werde dich zu binden wissen. Was weißt du von ... von deiner Mutter ..., deiner Schwester?« Da fuhr Julian flammend auf: »Unmenschlich ist's von dir, diese Frage zu tun.« Wohlgefällig nickte der Imperator: »Hm, du liebst sie also heiß! Sie, oder ihr Andenken. Nun wisse: Deine Schwester lebt.« — »Ich hörte davon.« — »So? So? Ei sieh! Nun: Auch deine Mutter lebt.« — »O Constantius, Dank! Welche Gnade! Welche Güte.« Und überwältigt von Rührung sank er auf die Knie, Tränen brachen aus seinen Augen.
›Er weint; er ist ganz ungefährlich‹ »Mehr noch, ich habe beide kommen lassen aus ihren bisherigen Ver..., Verweilungen. Sie sind hier.« — »Hier? Ich darf sie sehen! O Constantius! Laß mich ...«
»Gemach! Das Wiedersehen und die Freiheit von euch dreien ist der Preis für Verpflichtungen, die du übernehmen wirst. Du gehst nach Gallien, sobald ich es befehle.« — »Mit Freude!« — »Du übernimmst es, die Provinz den Barbaren zu entreißen mit den Mitteln, die du dort antreffen wirst.« — »Herr, welche sind das? Wie viele Legionen, welche Gelder, welche Vorräte? Welche Städte sind verloren, welche noch unser?« — »Hm, diese Fragen mißfallen mir sehr! Wie? Du willst schon markten, feilschen? Reut dich dein Ja?« — »Nein doch. Aber Köln vor allem, Köln ist doch noch nicht gefallen? Wenn das wäre ..., könnte ich's nicht übernehmen. Soviel habe sogar ich schon von Feldherrnschaft für Gallien gelernt. Wie steht's mit Köln?«
Constantius schien die Frage zu überhören; er hastete unmutig in dem Gemach auf und nieder.
Aber Julian beharrte: »Köln ist doch noch unser?« — »Ja, ja doch!« fuhr ihn der Augustus heftig an. »Ich würde ja selbst gehen, die Aufgabe zu lösen, ist sie doch gar leicht. Allein, mich und alle Kräfte des Reichs rufen die Sarmaten an den Ister, die Perser an den Euphrat. Nicht einen Mann mehr, als in Gallien stehen, darfst du von mir verlangen. Willst du Gallien damit retten oder den Barbaren überlassen für immer?« — »Niemals! Was ist es auch, das ich wage? Mein Leben? Es gehört dem Reich. Mein Name, mein Ruhm als Feldherr? Ach, ich habe keinen zu verlieren. Meine Eitelkeit? — Die zu verlieren wäre ein Gewinn. Es sei!« — »Gut. Aber nicht nur als Feldherr, als Herrscher brauche ich dich in Gallien. Ist die verwüstete Provinz den Barbaren entrissen, muß sie wieder bewohnbar gemacht werden. Cäsar mußt du werden.«
›Wie Gallus‹ dachte Julian.
»Wie Gallus, denkst du jetzt. Ja, laß dich seinen blutigen Schatten warnen. Bleibe treu! Bedenke ...«, hier schritt er plötzlich dicht an ihn heran und sah ihm mit drohendem, grausamem Blick ins Auge: »Bedenk es wohl: Deine Mutter und deine Schwester sind in meiner Hand; wertvolle Geiseln!« Er trat nun zwischen die Vorhänge und winkte dem Neger: »Rufe die Frauen.«
Julian fuhr auf: »Du ... du bist furchtbar, Imperator!«
»Vergiß das nie! Die Furcht vor dem Imperator«, höhnte er, »ist der Weisheit Anfang; wenigstens für seine Untertanen. Und höre noch eins: Als Cäsar sollen die Provinzialien nur einen Mann verehren, der dem Herrscher möglichst nahe verbunden ist. Nun bist du zwar mein Vetter; aber das genügt nicht. Du warst auch mein Schwager; jedoch dies Band zerriß schon längst der Tod. Es soll neu geknüpft werden. Meine Schwester soll deine Gemahlin werden.« Julian fuhr auf. »Nein, o nein! Nie. Nie!« Grimmig zischte Constantius ihn an: »Nein? Du wagst es? Bist du rasend? Die höchste Ehre der Welt? Und ein Wink von dieser Hand und dein Kopf schmückt die Zinnen dieser Feste. Und du wagst es ...?« Julian hörte die Drohung gar nicht. Er hatte die Augen geschlossen und beschwor, nach innen blickend in seine Seele, ein Mädchenbild herauf, das hier ruhte wie unter silberner Flut: ›Helena!‹ sprach er zu sich selbst. ›Helena! Darf ich? Dich lieb ich! Keine andre je! Darf ich, diese Liebe im Herzen, einer andern Gatte werden? Ich müßte ihr sagen, daß nur das Reich, der Staat ... Aber nein! Nein! Keine Spaltung zwischen Ehe und Liebe. Hilf mir, Helios, mein Gott! Keine Unwahrheit! Lieber den Tod als des Herzens Lüge.‹ — »Nein«, sprach er laut, aus seinem Brüten auffahrend.
»Nein wagst du zu sagen ...? Unseliger, so sei denn ..., Schweig! Da — da sind sie.« Julian rührte sich nicht. Das Haupt auf die Brust gesenkt, blieb er regungslos stehen, die Augen zu Boden geschlagen. »So seid ihr einig, Dank dem Himmel?« fragte eine sanfte Stimme. Die Imperatrix schwebte freudig bewegt über die Schwelle. »Aber nein, so scheint es! Der Augustus zürnt; wie finster er blickt! Hilf mir, o hilf, Helena, ihn versöhnen.« Bei dem Namen Helena fuhr Julian aus seinem Brüten; er wandte sich; er sah die beiden Frauen.
Da schrak er zusammen, das Blut schoß ihm in die Wangen. Er taumelte; er stützte sich auf die nächste Halbsäule, welche eine Büste Constantins trug.
»Bei ... bei allen Göttern! Imperator«, fragte er, »wer ...? wer ...? welche von beiden ist deine Schwester?« Bevor Constantius antworten konnte, faßte die Imperatrix die Jungfrau an der Hand und führte sie raschen Schrittes dem Jüngling zu: »Diese da«, lächelte sie traurig, aber mit herzgewinnender Anmut. »Habe nur keine Angst vor der andern! Diese da, Julianus, ist deine Braut. Willst du nun des Imperators Schwager werden?« — »Und ... und ...«, lächelte die Jungfrau verschämt, »und mein Gatte?« Da senkte Julianus das Knie vor den beiden Frauen: »O Helena!« rief er. »Ja, der Gott, der große Gott tut noch Wunder.«
Wohl war der Herrscher mächtig erstaunt gewesen über den plötzlichen Umschlag in dem Entschlusse seines Vetters; nicht ohne Mißtrauen erfuhr er, daß die beiden füreinander Bestimmten sich bereits kannten; sein Argwohn erwachte aufs neue. Jedoch seine Gemahlin erinnerte ihn, daß ja in keines andern als in seinem Kopf — nicht in ihrem oder in des Sterndeuters Ratschlägen — zuerst der Gedanke an diese Verbindung aufgetaucht sei. So beruhigte er sich denn wieder und gestattete auch, daß noch an diesem Abend Julian die Mutter und die Schwester zugeführt werden durften. Dem neuen Cäsar wurde ein ganzer Flügel des Palastes zur Wohnung angewiesen; Constantius selbst geleitete ihn dorthin mit Gemahlin und Schwester.
Als sie den viereckigen Zwischenhof durchschritten, bemerkte Julian ein halbes Dutzend Leibwächter, aus deren Mitte riesengroß ein Gefangener ragte; das Licht der Pechfackeln fiel auf sein blondrotes zottiges Haupt. »Behrung!« rief Julian, stehenbleibend, »Freund Behrung! Wohin gehst du?« — »Wohin ich dich einmal führen sollte: zum Tod. Lebwohl.« — »Dein Freund?« forschte höchst argwöhnisch der Augustus. »Der germanische Bär?« — »Er war sehr gutherzig gegen mich auf dem Wege aus Macellum. Was hat er verbrochen?« — »Er hat seinen Soldvertrag gekündigt und dann, beim Wein, im Rausche gesagt — Späher hinterbrachten es dem Wächter über meine Sicherheit —: er lebe lieber unter den Bären des Neckarwaldes als unter den Füchsen dieses Palastes.« Julian lächelte: »Und deshalb sterben? Im Wein ist Wahrheit.«
Eusebia erschrak: »Gott! Welche Keckheit des Wortes. Man sieht, der junge Philosoph hat nie am Hofe gelebt.« Constantius maß den Kühnen mit hocherstauntem Blick: »Es ist Majestätsbeleidigung, o Cäsar!« sprach er auf griechisch. »Aber, Wahrheit? Wir wollen sehen, ob der Germane wirklich Wahrhaftigkeit hat. Gib acht, wie er sogleich ums liebe Leben lügen wird. — Sprich«, sagte er nun wieder auf lateinisch, »vielleicht kannst du den Hals retten: Du hast unter den Füchsen des Palastes gewiß nur meine Diener gemeint, nicht mich?« — »Dich vor allem, Herr.« Constantius starrte vor Staunen; er kämpfte sichtlich mit sich selbst.
»Das ist Mannesart! O Imperator«, rief da Julian, »gewähre deinem Cäsar seine erste Bitte: Schenke mir dies verwirkte Leben.«
»Es sei!« erwiderte Constantius weiterschreitend, »nimm ihn mit zu seinen Bären. Hoffentlich fressen sie ihn.« Er winkte, die Leibwächter nahmen dem Gebundenen die Ketten ab. »Siehst du«, sprach Julian leise zu ihm, der sich an ihn herandrängte und treuherzig ihm die Rechte bot, »siehst du, auch dich hat gerettet mein Gott! Weißt du noch, wie er heißt ...?« — »Der waltende Wotan.« — »Unverbesserlicher!« lachte Julian und folgte den voranschreitenden Frauen.
Constantius vermied es, der ersten Begegnung Julians mit den Seinen beizuwohnen; er gestattete, daß der treue Jovian, der ängstlich vor dem Außentore des Palastes auf die Entscheidung harrte, daß, auf den Wunsch der Imperatrix, auch Philippus und der Mönch Johannes herbeigerufen würden, und kehrte in sein Gemach zurück, Eusebius eine Abschiedsunterredung zu bewilligen; denn dieser hatte Urlaub auf unbestimmte Zeit verlangt: »Zur Herstellung seiner durch die Aufregungen der letzten Zeit erschütterten Gesundheit«, wie es in der Gesuchschrift hieß.
Die beiden Frauen und die beiden Freunde erklärten nun dem immer noch staunenden Julian die Vorgeschichte, die Zusammenhänge dieser plötzlichen Wandlungen.
Daß nur die Weissagung von Julians frühem Tod in dem wieder eroberten Gallien den schwankenden Imperator entschieden habe, verschwiegen Eusebia und der Sternweise selbstverständlich dem in Glück und Liebe schwebenden und schwelgenden Brautpaar ebenso wie Jovian. Nach einer Unterbrechung des Gesprächs ergriff Johannes, der bis dahin nur selten ein Wort zur Erklärung eingeworfen, sich demütig zurückgehalten hatte, die Hand Julians und sprach, den tief eindringenden Blick auf ihn gerichtet: »Es ist edel von dir, geliebter Sohn, daß du dich soweit überwindest, dem Mann zu dienen, dessen Hand das Blut der Deinen vergossen hat. Siehst du, so erfüllest du das Gebot des Herrn: ›Vergeltet Böses mit Gutem!‹ Du bist ein Christ der Tat! Dafür wird dir mancher Zweifel am Glauben vergeben werden. Denn ach, ich glaube, du — der Schüler eines Lysias, eines Maximus —, du zweifelst ein wenig? Du hast Bedenken, du bist noch schwankend in deinen Entschlüssen?«
Um Julians feingeschnittene Lippen spielte ein leises Lächeln: »Ja, Vater Johannes, ich glaube auch, ich zweifle ein wenig; und ich verdiene dein Lob nicht. Keineswegs der Christ, der Römer in mir hat den Widerwillen überwunden, diesem — Augustus zu dienen. Und auch überwunden die Sehnsucht nach den Hainen und Hallen der Akademie, nach den Lehrern, die in Nikomedia und die am Ilissos wandeln, das Verlangen nach den Papyrusrollen in den Bibliotheken der Stoen: Denn wer am Becher der Weisheit zu nippen begann, wenn auch, wie ich, nur am Rande, den verzehrt der Durst nach reicherem Wissen. Ach, wieviel hätte ich noch zu lernen, zu forschen! Und nun reißt mich der Tubaschall hinaus aufs Schlachtfeld, in verbrannte Städte, in die Speere der Barbaren. Werd ich jemals wieder die Muße finden, einem Maximus, einem Libanius zu lauschen?«
»Nun«, meinte Jovian lächelnd, »diese Wahl blieb dir, glaub ich, erspart. Du konntest von dem Imperator hinweg nur nach Gallien gehen oder auf das Blutgerüst, nicht aber nach Athen zurück. Und es ist nun genug der Forschung, Cäsar Julian; nun gilt es Feldherrnschaft.« Und des jungen Mannes schönes Antlitz leuchtete bei diesen Worten.
Julian schlang den Arm um seine Schulter: »Dank, mein Jovian! Du bist mein guter Genius. Die Götter selbst — o schilt mich nicht, Johannes! — haben dich mir als solchen verkündet. Hört mich, ihr edlen Frauen! In der letzten Nacht warf ich mich hin und her in der engen Sänfte und konnte lange nicht Schlaf finden. Unablässig beschäftigte mich der Gedanke, was denn, falls ich am Leben bliebe, mein Beruf, was mein Geschick sein werde? Mächtig zog es mein Herz zu den geliebten Lehrern, zu den Büchern zurück. Erst kurz vor Sonnenaufgang schlief ich ein. Und nun kam mir ein Traum — gerade in der Zeit, da die Träume am wahrhaftigsten ...« — »In Christus geliebter Sohn«, klagte Johannes, »das ist heidnischer Wahnglaube.« — »In allen Göttern — was mehr ist — geliebter Vater«, lächelte Julian, »und jener vielgepriesene Judenjunge, der Frau Potifar so sehr gefiel, hat der nicht einem Herrscher geweissagt aus seinen Kuh-Träumen? Oder ist Jehova ein anderer als Gott-Vater? Du verstummst! Nichts für ungut! Aber ein bißchen Spott ist oft mein einziger Trost, bei soviel aufgezwungener Heuchelei.«
Da seufzte die Imperatrix tief.
»Nun wohlan, der behelmte Genius Romas — ich konnte seine Gesichtszüge im Gewölk kaum erkennen — schwebte auf mich zu, mit der Linken hob er einen Legionsadler in die Höhe, mit der Rechten reichte er mir ein Schwert und sprach: ›Mir gehörst du, Julianus! Du bist ein Römer. Kämpf und siege.‹
Ich erwachte, ich fuhr empor; ich sah noch seinen Helmkamm schimmern im Morgengold. Es war der Helm Jovians, der sich vom Rosse zu mir niederbog, und seine Züge waren die des Genius. O ihr teuren Frauen, ihr treuen Freunde! Glücklicher als ich kann kein Sterblicher sein. Ich soll Mutter und Schwester neu geschenkt erhalten, ich habe eine geliebte Braut und treue Freunde.«
»Und eine Beschützerin«, sprach Philippus auf die Imperatrix deutend, die noch bleicher schien als sonst —, »ohne die du jetzt gar nichts hättest, o Cäsar Julian, als ein Grab.«
Eusebia winkte ihm, zu schweigen: »Sein Glück — euer Glück vielmehr — ist mein reichster Lohn, ist mein Glück. Freue dich, Cäsar: Wir alle, die wir's wohl meinen mit dir, sind ernst, allzu ernst für deine Jugend, für deine Neigung zum Witz. Dies junge Geschöpf da, deine Helena, ist unter einem fröhlichen Stern geboren; ihre Heiterkeit wird dir ein Labsal sein. Sieh nur, wie sie so strahlend lächeln kann, und silberhell ertönt ihr Lachen.«
Einstweilen trat Philippus zu Johannes und flüsterte: »O Freund, und wir? — Wir sollen die Geliebte wiedersehen! Nach so vielen Jahren! Mir pocht das Herz zum Springen. Ob sie noch schön ist?« — »Schweig, Philippus! Nicht solche Worte! Willst du auch in mir die alte Sünde wecken? An ihr Seelenheil denke! Wie mögen all die Jahre, die Einsamkeit, die ungerechte Strafe ohne Schuld, auf ihren Glauben gewirkt haben? Ob ihr Gemüt der Haß verbittert, vom Gottvertrauen abgelenkt hat?« — »Es wäre kein Wunder«, meinte der Arzt. »Aber still ...! Draußen im Hofe wird eine Sänfte niedergesetzt! Sie kommen! — Irene soll ich wiedersehen.« Er zitterte heftig. Der Mönch senkte die Augen und betete: »Und führe uns nicht in Versuchung.«
Nur kurze Zeit vorher waren Mutter und Tochter nach so vieljähriger Trennung einander wiedergegeben worden, und kaum hatte sich ihre stürmische Erregung in zärtlichen, ängstlichen Fragen, in Tränen des Schmerzes und der Rührung ausgedrückt, als sie aufgefordert wurden, sich aus der Villa in den Palast, zu dem Sohn, dem Bruder zu begeben, dem neuen Cäsar und verlobten Schwager des Imperators.
Auf ihre staunenden Fragen über den Zusammenhang all dieser sich überstürzenden Dinge — den Untergang des Gallus hatten sie schon in ihren Verbannungen erfahren —, wußten die Eunuchen, die sie einluden, die Sänfte zu besteigen, keinen Bescheid zu geben; sie waren auf Raten und Vermutungen angewiesen.
»Mein geliebter Knabe! Ach nein, nicht mehr Knabe«, sprach die Mutter. »Er war stets unter den Söhnen mein Liebling — ich kann's nicht leugnen —, Gallus war so unbändig. Julian hing an mir mit so zärtlicher Liebe! Wie er wohl aussehen mag? Er war gar klein und schmächtig für sein Alter.«
»O nein! Er ist gewiß groß und stark und männlich geworden«, rief das schöne junge Mädchen. Die Schwester schmückten die günstigsten Dinge an Julians Erscheinung: das dunkle Lockenhaar, die Augen, der feine Mund; und sie war frei von den unvorteilhaften: der spitzen Nase, dem spitzen Kinn, den tiefen Augenhöhlen und den vorstehenden Knochen der allzuhagern Wangen. »O wie liebte auch ich ihn! Dachte ich an ihn in all der Zeit, sah ich ihn stets als schönen jungen Helden. Du wirst es sehen, Mutter, er muß der stattlich Schönste von allen sein. O, wie sehne ich mich, an seinem Herzen zu ruhen! Die Sänfte hält. O Mutter, Mutter, laß mich vorauseilen. Ich kann die Sehnsucht nicht mehr zügeln.«
Sie stieß die Türe der Sänfte auf, flog die Stufen zu dem Palasteingang hinan, schlug den schwerfaltigen Vorhang zurück, eilte atemlos in den taghell erleuchteten Raum, ließ, ohne ein Wort, die Blicke über die Anwesenden gleiten und rief nun jauchzend: »Julian! Mein Bruder! Geliebter, herrlicher Bruder!« Und mit ausgebreiteten Armen eilte sie auf den etwas weiter stehenden schönen Jüngling zu, der errötend zurückwich.
»Guten Geschmack hast du, Schwesterlein«, lachte Julian, sie auffangend. »Aber du mußt dich schon mit mir begnügen, der da ist mein Freund Jovian.«
Das Mädchen verstummte vor Scham und lieblicher Verwirrung, Helena kam ihr zu Hilfe: »Die neue Schwester aber, hoff ich, kennst du noch, die Mitgefangne«, lächelte sie und umarmte Juliana.
»Jedoch die Mutter? Wo bleibt die Mutter?« rief Julian und flog auf den Eingangsvorhang zu.
Plötzlich blieb er wie gebannt stehen, mit großen Augen starrte er vor sich hin, die Arme in stummem Staunen erhebend. Denn wunderbar in der Tat war der Anblick dieser Frau. Hochaufgerichtet, ihren Sohn überragend, blieb die Matrone, von der Stirn bis zu den Knöcheln in ein dunkelgraues Trauergewand gehüllt, dicht am Eingang stehen. Das edle Antlitz war zu beiden Seiten umflutet von einem breitwallenden Strome silberweißen Haares, das aus der enganliegenden Mantelkapuze vorn auf ihre Brust niederquoll.
Das Wunderbarste aber an der wunderbaren Erscheinung waren die großen dunkelbraunen Augen, die in bläulichem Weiß schwimmend, mit ihrem unbestimmten Blick nicht an irgendeinem Erdending zu haften, in das Unendliche, in das Unirdische, das Jenseitige suchend, zu schauen schienen.
So, die Rechte auf einen hohen schwarzen Stab gestützt, blieb die hehre Gestalt unbeweglich stehen und fragte mit tiefer, nur leise zitternder Stimme: »Wo ist Julian, wo ist mein lieber Sohn?« — »Mutter!« rief der aus tiefstem Grund der Seele und sank ehrfürchtig vor ihr nieder, ihre Knie umfassend. Feierliches Schweigen waltete nun in dem weiten Saal.
Endlich sprach die immer noch aus der Maßen schöne Matrone, den Blick der verklärt schimmernden Augen tief in seine Seele senkend: »Ja. Dank sei dem dreieinigen Gott! — Er ist mir rein geblieben; in diesen Augen leuchtet unbefleckter Glanz. Die Sünde der Welt hat ihn mir nie berührt. Lieber wär er mir gestorben. Aber er lebt! Er lebt, Dank sei dem Herrn, der alle seine Wege seinen Engeln befohlen hatte. Über schuppige Häupter der Drachen und über giftige Schlangen ist er gewandelt — unversehrt! Der Herr hat große Wunder an ihm getan. Dir, o Herr, dreieiniger Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist — dir weih ich sein Haupt und sein Leben ganz und gar. Dem Erlöser und seiner Botschaft des Heils, die allein mich vor Verzweiflung, vor Wahnsinn, vor der Verfluchung Gottes und der Welt behütet hat in den Schrecken jener Mordnacht, in der verzehrenden Qual meiner einsamen Sehnsucht! — Christus dem Herrn, in dem allein das Heil ist, weihe ich den Sohn, diesen Sohn von tausend Schmerzen! — Ihr andern aber alle, wer ihr auch seid, ob die Höchsten der Zeitlichkeit und die Weisesten, beugt, ich beschwöre euch, beugt eure Knie in den Staub vor Gott und sprechet mit mir: »Dank sei dir, Herr Jesus Christus, Gottes eingeborener Sohn! Dank sei dir! Lob und Preis in Ewigkeit, der du durch deiner Güte und Barmherzigkeit und Allmacht Wunder diese Stunde hast herbeigeführt. Lob und Preis sei dir und Anbetung in Ewigkeit. Amen!«
Da erhob die Frau, hoch sich reckend, den Stab, auf den sie sich gestützt hatte. Nun zeigte sich, der Griff des schwarzen Schaftes war ein silbernes Kreuz; hell blitzte es, augenblendend, in dem Licht der Fackeln.
Und alle, alle — bis auf einen — sanken bei ihrer Beschwörung in die Knie, die drei Frauen und Johannes zuerst. Der flüsterte vor sich hin: »Das ist eine Heilige auf Erden.« Auch Philippus folgte — zögernd: ›Wahnsinn ist es‹, dachte der, ›aber göttlicher Wahnsinn wie der Sibylle.‹
Nur Julian blieb stehen, er zitterte am ganzen Leibe; scheu wandte er den Blick von der Mutter ab, er wollte entfliehen.
Da sprang Jovianus auf, faßte ihn fest an der Schulter, zog ihn nieder und, selbst wieder auf die Knie sinkend, raunte er ihm zu: »Die Mutter! Julian, um ihrer Seelenruhe willen! Die Mutter!« — »Heucheln? Lügen?« knirschte der. »Schone die Mutter!«
Und er zwang den Widerstrebenden zu sich nieder; die Matrone hatte die Zögerung nicht bemerkt, denn mit verzückten, weit geöffneten Augen hatte sie nach oben geblickt, sprachlos, achtlos ihrer Umgebung. Jetzt legte sie die Hand dem vor ihr knienden Sohn auf das Haupt und schloß feierlich: »Segne ihn, Christus, sein Erlöser und Gott! Ich und mein Haus, wir wollen dir dienen. Leben wir, so leben wir dir, sterben wir, so sterben wir dir, darum wir leben oder sterben, dein sind wir, Jesus Christus. Amen.« Feierliche, weihevolle Stille folgte diesen in höchster Begeisterung gesprochenen Worten.
Aber doch lag ein gewisser dumpfer Druck über allen. Die Matrone hatte so plötzlich, so gewaltig, ja gewaltsam den auf ganz anderes gerichteten Gedanken der drei Frauen und der drei weltlichen Männer eine Richtung aufgezwungen, die dem Augenblicke ferne lag. Julian trat der Schweiß auf die zu Boden gesenkte Stirn.
Der erste, der aufsprang, war Jovianus: »Auf!« rief er und schlug dem Freunde, der, in wehvollem Zwiespalt ringend, vor sich hinstarrte, auf die Schulter. »Hörst du die Tuba draußen schmettern durch die Nacht? Es ist der Sammelruf der Legionen, Cäsar Julian«, rief er. »Sie gibt dem ganzen Heer das Zeichen zur Versammlung morgen früh vor den Toren der Stadt. Als Cäsar wirst du feierlich begrüßt. Dann zur Hochzeit.«
»Jawohl«, fiel Philippus, sich erhebend, ein, »unter guten Sternen; unter Eusebias Augen!«
»Und dann«, schloß Julian, sich kräftig ermannend und hoch aufrichtend, »dann sofort auf nach Gallien; und wehe den Barbaren!«
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.