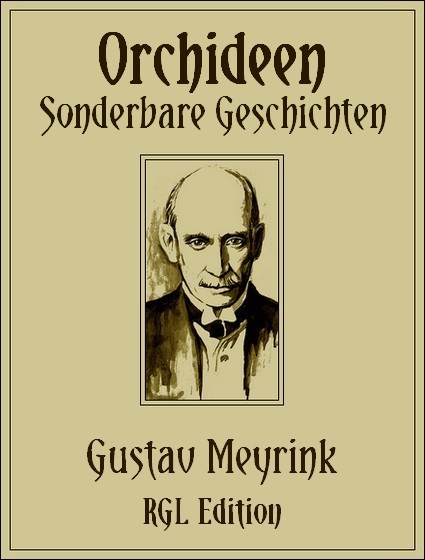
RGL e-Book Cover 2016©
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.
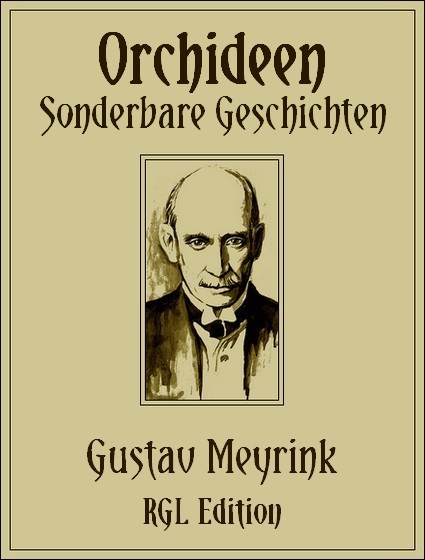
RGL e-Book Cover 2016©
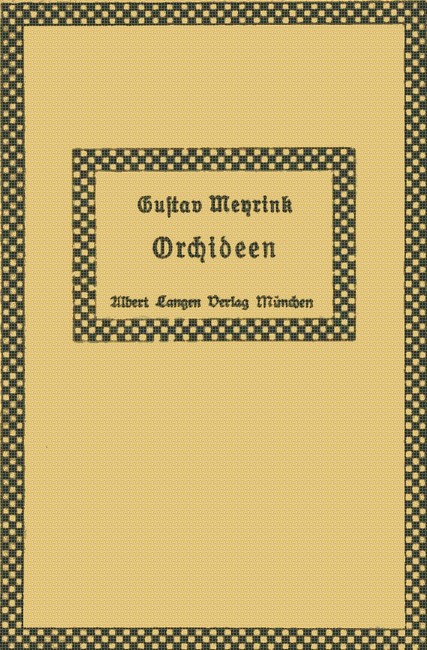
"Orchideen," Verlag Albert Langen, München, 1905, Buchdeckel
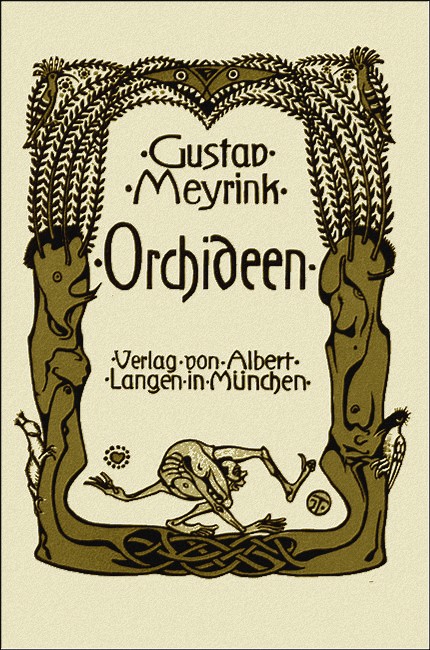
"Orchideen," Verlag Albert Langen, München, 1905, Titelblatt
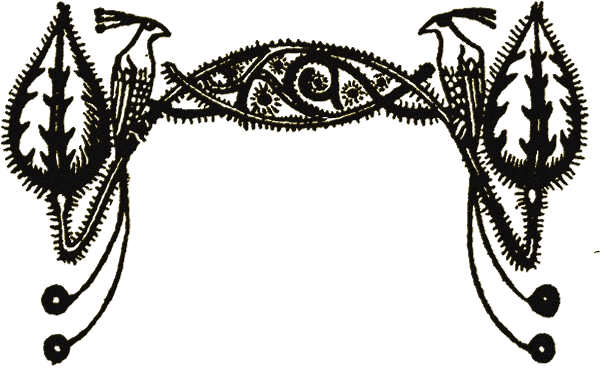
Anfangs sagenhaft – gerüchteweise – ohne Zusammenhang drang aus Asien die Nachricht in die Zentren westlicher Kultur, daß in Sikkhim – südlich vom Himalaja – von ganz ungebildeten, halbbarbarischen Büßern – sogenannten Gosains – eine geradezu fabelhafte Erfindung gemacht worden sei.
Die anglo-indischen Zeitungen meldeten zwar auch das Gerücht, schienen aber schlechter als die russischen informiert, und Kenner der Verhältnisse staunten hierüber nicht, da bekanntlich Sikkhim allem, was englisch ist, mit Abscheu aus dem Wege geht. –
Das war wohl auch der Grund, weshalb die rätselhafte Erfindung auf dem Umwege Petersburg-Berlin nach Europa drang.
Die gelehrten Kreise Berlins waren fast vom Veitstanz ergriffen, als ihnen die Phänomene vorgeführt wurden.
Der große Saal, der sonst nur wissenschaftlichen Vorträgen diente, war dicht gefüllt.
In der Mitte, auf einem Podium, standen die beiden indischen Experimentatoren: der Gosain Deb Schumscher Dschung, das eingefallene Gesicht mit heiliger weißer Asche bestrichen, und der dunkelhäutige Brahmane Radschendralalamitra, – als solcher durch die dünne Baumwollschnur kenntlich, die ihm über die linke Brusthälfte hing.
An Drähten von der Saaldecke herab waren in Mannshöhe gläserne, chemische Kochkolben befestigt, in denen sich Spuren eines weißlichen Pulvers befanden. Leicht explodierbare Stoffe, vermutlich Jodide, wie der Dolmetsch angab.
Unter lautloser Stille des Auditoriums näherte sich der Gosain einem solchen Kochkolben, band eine dünne Goldkette um den Hals des Glases und knüpfte die Enden dem Brahmanen um die Schläfen.
Dann trat er hinter ihn, erhob beide Arme und murmelte die Mantrams – Beschwörungsformeln – seiner Sekte. – Die beiden asketischen Gestalten standen wie Statuen. Mit jener Regungslosigkeit, die man nur an arischen Asiaten sieht, wenn sie sich ihren religiösen Meditationen hingeben.
Die schwarzen Augen des Brahmanen starrten auf den Kolben. Die Menge war wie gebannt. –
Viele mußten die Lider schließen oder wegsehen, um nicht ohnmächtig zu werden. – Der Anblick solcher versteinerter Gestalten wirkt wie hypnotisierend, und mancher fragte flüsternd seinen Nebenmann, ob es ihm nicht auch scheine, als ob das Gesicht des Brahmanen manchmal wie in Nebel getaucht sei. –
Dieser Eindruck wurde jedoch nur durch den Anblick des heiligen Tilakzeichens auf der dunklen Haut des Inders erweckt, – ein großes weißes U, das jeder Gläubige als Symbol Vishnus des Erhalters auf Stirne, Brust und Armen trägt.
Plötzlich blitzte in dem Glaskolben ein Funken auf, der das Pulver zur Explosion brachte. – Einen Augenblick: Rauch, dann erschien in der Flasche eine indische Landschaft von unbeschreiblicher Schönheit. – Der Brahmane hatte seine Gedanken projiziert! –
Es war der Tadsch Mahal von Agra, jenes Zauberschloß des Großmoguls Aurungzeb, in dem dieser vor Jahrhunderten seinen Vater einkerkern ließ.
Der Kuppelbau aus bläulichem Weiß wie Kristallschnee – mit schlanken Seitenminaretts – in einer Pracht, die den Menschen in die Knie zwingt, warf sein Spiegelbild auf den endlosen schimmernden Wasserweg zwischen traumgeschmiegten Zypressen. –
Ein Bild, das dunkles Heimweh weckt nach vergessenen Gefilden, die der Tiefschlaf der Seelenwanderung verschlungen.
Stimmengewirr der Zuschauer, ein Staunen und Fragen. – Die Flasche wurde losgewickelt und ging von Hand zu Hand.
Monatelang halte sich so ein fixiertes plastisches Gedankenbild, übersetzte der Dolmetsch, zumal es der immensen stetigen Vorstellungskraft Radschendralalamitras entsprungen sei. – Projektionen europäischer Gehirne dagegen hätten nicht annähernd solche Farbenpracht und Dauer.
Viele ähnliche Experimente wurden noch gemacht, bei denen teils wieder der Brahmane, teils einer oder der andere der berufensten Gelehrten die Goldkette um die Schläfen knüpfte.
Klar wurden eigentlich nur die Vorstellungsbilder der Mathematiker; – recht sonderbar fielen hingegen die Resultate aus, die den Köpfen juridischer Kapazitäten entsprangen. – Allgemeines Staunen aber und Kopfschütteln bewirkte die angestrengte Gedankenprojektion des berühmten Professors für innere Medizin, Sanitätsrats Mauldrescher. – Sogar den feierlichen Asiaten blieb der Mund offen: Eine unglaubliche Menge kleiner mißfarbener Brocken, dann wieder ein Konglomerat verschwommener Klumpen und Zacken war in dem Versuchskolben entstanden.
»Wie italienischer Salat«, sagte spöttisch ein Theologe, der sich vorsichtshalber gar nicht an den Experimenten beteiligt hatte.
Besonders der Mitte zu, wo sich bei wissenschaftlichen Gedanken die Vorstellungen über Physik und Chemie niederschlagen, wie der Dolmetsch betonte, – war die Materie gänzlich versulzt.
Auf Erklärungen, wieso und wodurch die Phänomene eigentlich zustande kämen, ließen sich die Inder nicht ein.
»Später einmal – später« sagten sie in ihrem gebrochenen Deutsch.
Zwei Tage darauf fand wieder eine Vorführung der Apparate – diesmal halbpopulär – in einer anderen europäischen Metropole statt. – Wieder die atemlose Spannung des Publikums und dieselben bewundernden Ausrufe, als zuerst unter der Einwirkung des Brahmanen ein Bild der seltsamen tibetanischen Festung Taklakot erschien.
Abermals folgten die mehr oder minder nichtssagenden Gedankenbilder der Stadtgrößen.
Die Mediziner lächelten nur überlegen, waren jedoch diesmal nicht zu bewegen, in die Flasche – hineinzudenken.
Als endlich eine Gesellschaft Offiziere näher trat, machte alles respektvoll Platz. – Na selbstverständlich!
»Gustl, was meinst du, denk du amol wos«, sagt ein Leutnant mit gefettetem Scheitel zu einem Kameraden.
»Ah, – i nöt, mir is vüll z'vüll Ziwüll do.«
»Na, aber ich biddde, ich biddde, doch einer von die Herren – – – – – –« forderte gereizt der Major auf.
Ein Hauptmann trat vor: »Sö, Dolmetscher, kann ma sich a wos Idealls denken? I wüll ma wos Idealls denken!«
»Was wird es denn sein, Herr Hauptmann?« (»Auf den Zwockel bin ich neugierig«, schrie einer aus der Menge.)
»No«, sagte der Hauptmann, »no, – i wier halt an die ehrenräddlichen Vurschriften denken!«
»Hm.« der Dolmetsch strich sich das Kinn. »Hm, – ich – hm, ich denke, Herr Hauptmann, – hm, – dazu – hm – sind die Flaschen vielleicht doch nicht widerstandsfähig genug.«
Ein Oberleutnant drängte sich vor. »Alsdann laß mich, Kamerad.«
»Ja, ja, laßt's 'n Katschmatschek«, schrien alle. »Dös is a scharfer Denker.«
Der Oberleutnant legte sich die Kette um den Kopf. – »Bitte« (– verlegen reichte ihm der Dolmetsch ein Tuch –) »bitte: ... Pomade isoliert nämlich.« –
Deb Schumscher Dschung, der Gosain mit seinem roten Lendentuch und dem weißgetünchten Gesicht, trat hinter den Offizier. – Er sah diesmal noch unheimlicher aus als in Berlin.
Dann hob er die Arme.
Fünf Minuten – – – – – –
Zehn Minuten – – – nichts.
Der Gosain biß vor Anstrengung die Zähne zusammen. Der Schweiß lief ihm in die Augen.
Da! – Endlich. – – Das Pulver war zwar nicht explodiert, aber eine sammetschwarze Kugel, so groß wie ein Apfel, schwebte frei in der Flasche. –
»Dös Werkl spüllt nimmer«, entschuldigte sich verlegen lächelnd der Offizier und trat vom Podium herab. – –
Die Menge brüllte vor Lachen. –
Erstaunt nahm der Brahmane die Flasche – – Da! – Wie er sie bewegte, berührte die innen schwebende Kugel die Glaswand. Sofort zersprang diese, und die Splitter, wie von einem Magnet angezogen, flogen in die Kugel, um darin spurlos zu verschwinden.
Der sammetschwarze Körper schwebte unbeweglich frei im Raum. –
Eigentlich sah das Ding gar nicht wie eine Kugel aus und machte eher den Eindruck eines gähnenden Loches. – Und es war auch gar nichts anderes als ein Loch. –
Es war ein absolutes: – ein mathematisches »Nichts«! – Was dann geschah, war nichts als die notwendige Folgeerscheinung dieses »Nichts«. – Alles an dieses »Nichts« angrenzende stürzte naturnotwendig hinein, um darin augenblicklich ebenfalls zu »Nichts« zu werden, d. h. spurlos zu verschwinden.
Wirklich entstand sofort ein heftiges Sausen, das immer mehr und mehr anschwoll, denn die Luft im Saale wurde in die Kugel hineingesaugt. Kleine Papierschnitzel, Handschuhe, Damenschleier – alles riß es mit hinein. –
Ja, als ein Offizier mit dem Säbel in das unheimliche Loch stieß, verschwand die Klinge, als ob sie abgeschmolzen wäre. –
»Jetzt dös geht zu weit«, rief der Major bei diesem Anblick, »dös kann i nöt dulden. Geh' mer, meine Herren, geh' mer. Bidde, – ich bidde.« –
»Was host dir denn denkt, eigentlich, Katschmatschek?« fragten die Herren beim Verlassen des Saales.
»I? – No – – – wos ma sich halt so denkt.«
Die Menge, die sich das Phänomen nicht erklären konnte und nur das schreckliche, immer mehr anwachsende Sausen hörte, drängte angsterfüllt zu den Türen.
Die einzigen Zurückbleibenden waren die beiden Inder.
»Das ganze Universum, das Brahma schuf, Vishnu erhält und Siva zerstört, wird nach und nach in diese Kugel stürzen«, sagte feierlich Radschendralalalamitra, »– das ist der Fluch, daß wir nach Westen gingen, Bruder!«
»Was liegt daran«, murmelte der Gosain, »einmal müssen wir alle ins negative Reich des Seins.«
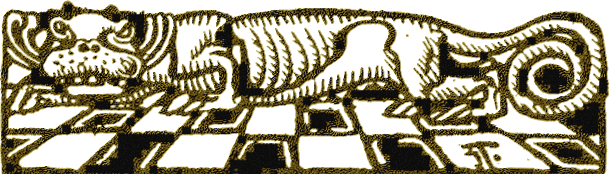
»Haben Sie den Blitz gesehen? – Da muß etwas an der elektrischen Zentrale passiert sein. – – Gerade dort über den Häusern.«
Einige Personen waren stehen geblieben und blickten in derselben Richtung. – – Eine schwere Wolkenschicht lag regungslos über der Stadt und bedeckte das Tal wie ein schwarzer Deckel: – der Dunst, der von den Dächern aufstieg und nicht wollte, daß die Sterne sich lustig machen über die törichten Menschen.
Wieder blitzte etwas auf – von der Anhöhe zum Himmel empor – und verschwand.
»Weiß Gott, was das sein kann; vorhin hat es doch links geblitzt, und jetzt wieder da drüben?! – – – Vielleicht sind's gar die Preußen«, meinte einer.
»Wo sollen die denn herkommen, bitt' Sie?! Übrigens habe ich noch vor zehn Minuten die Herren Generale im Hotel de Saxe sitzen sehen.«
»Na, wissen Sie, das wäre gerade kein Grund; – aber die Preußen – –?! das ist doch nicht einmal ein Witz, so etwas kann ja selbst bei uns nicht –«
Eine blendendhelle eiförmige Scheibe stand plötzlich am Himmel, – riesengroß – und die Menge starrte mit offenem Munde in die Höhe.
»Ein Kompaß, ein Kompaß«, rief die dicke Frau Schmiedl und eilte auf ihren Balkon. –
»Erstens heißt es ›Komet‹, zweitens hätte er doch einen Schweif«, wies die vornehme Tochter sie zurecht.
Ein Schrei barst in der Stadt und lief durch die Straßen und Gäßchen, in die Haustore, durch dunkle Gänge und über krumme Treppen bis in die ärmsten Stübchen. – – Alles riß die Vorhänge zur Seite und stieß die Scheiben auf, – die Fenster waren im Nu von Köpfen erfüllt: Ah!
Da oben am Himmel in dem mächtigen Dunst eine leuchtende Scheibe und mitten darin zeichnete sich die Silhouette eines Ungeheuers, – eines drachenartigen Geschöpfes ab. So groß wie der Josefsplatz, pechschwarz und mit einem gräßlichen Maul. – Genau wie der Josefsplatz.
Ein Chamäleon, ein Chamäleon! – Scheußlich.
Ehe die Menge zur Besinnung kam, war das Phantom verschwunden und der Himmel so dunkel wie früher.
Die Menschen sahen stundenlang empor, bis sie Nasenbluten bekamen, – aber nichts zeigte sich mehr.
Als ob sich der Teufel einen Spaß gemacht hätte.
»Das apokalyptische Tier«, meinten die Katholiken und schlugen ein Kreuz nach dem anderen.
»Nein, nein, ein Chamäleon«, beruhigten die Protestanten. – – –
Glöng, glöng, glöng: Ein Wagen der Rettungsgesellschaft stürmte in die Menge, die schreiend auseinanderstob, und hielt vor einem niedrigen Haustor.
»Ist wem was geschehen?« rief der Herr Stadtarzt und bahnte sich einen Weg durch das Menschenknäuel. Man schob soeben eine mit Tüchern bedeckte Tragbahre aus dem Hause.
»Ach Gott, Herr Doktor, die gnädige Frau ist vor Schrecken niedergekommen«; jammerte das Stubenmädchen, »und es kann höchstens acht Monate alt sein, – er wisse es ganz genau, sagt der gnädige Herr.« –
»Die Frau Cininbulk hat sich ›versehen‹ an dem Ungeheuer«, – lief es von Mund zu Mund.
Eine große Unruhe entstand.
»Machen Sie doch Platz, Himmel Herrgott; – ich muß nach Hause«, hörte man vereinzelte Stimmen schreien.
»Laßt uns nach Hause gehen, nach unsern Frauen sehen«, – intonierten ein paar Gassenbuben und der Mob johlte. –
»Kusch, ihr Lausbuben«, schimpfte der Herr Stadtarzt – und lief ebenfalls so schnell er konnte heim.
Wenn es nicht zu regnen angefangen hätte, wer weiß, wie lange die Leute noch auf der Straße geblieben wären. So leerten sich allmählich die Plätze und Gassen und nächtliche Ruhe legte sich auf die nassen Steine, die trüb im Laternenlicht glänzten. –
Mit dem Eheglück der Cinibulks war es seit jener Nacht vorbei.
Gerade in so einer Musterehe mußte das passieren! Wenn das Kind wenigstens gestorben wäre, – Achtmonatskinder sterben doch sonst gewöhnlich.
Der Gatte, der Stadtrat Tarquinius Cinibulk, schäumte vor Wut, – die Buben auf der Gasse liefen ihm nach und johlten; die mährische Amme hatte die Freisen bekommen, als sie das Kleine erblickte, und er mußte in die Zeitung handgroße Annoncen einrücken lassen, um eine blinde Amme aufzutreiben. –
Schon am nächsten Tage nach jenem schrecklichen Ereignis hatte er angestrengt zu tun, um alle die Agenten von Castans Panoptikum aus dem Hause zu scheuchen, die das Kind sehen und für die nächste Weltausstellung gewinnen wollten.
Vielleicht war es einer dieser Leute gewesen, der ihm, um seine Vaterfreuden noch mehr zu dämpfen, die verhängnisvolle Idee, er sei von seiner Gattin hintergangen worden, eingegeben hatte, denn kurz darauf war er zum Herrn Polizeirat gelaufen, der nicht nur gerne Silberzeug zu Weihnachten annahm, sondern auch durch emsiges Verdächtigen mißliebiger Personen Karriere gemacht hatte.
Es vergingen richtig kaum acht Wochen, als bekannt wurde, daß der Stadtrat Cinibulk einen gewissen Dr. Max Lederer wegen Ehebruchs verklagt hatte. – Die Staatsanwaltschaft griff auf die Befürwortung des Polizeirates die Sache selbstverständlich auf, obwohl keine Ertappung in flagranti vorlag.
Die Gerichtsverhandlung verlief äußerst interessant. Die Anklage des Staatsanwaltes stützte sich auf die frappante Ähnlichkeit der kleinen Mißgeburt, die nackt und kreischend in einem rosa Korbe lag, mit dem Dr. Max Lederer.
»Sehen Sie sich, hoher Gerichtshof, nur einmal den Unterkiefer an und die krummen Beine, – von der niedrigen Stirne, – wenn man das überhaupt Stirne nennen darf, – ganz zu schweigen. Betrachten Sie die Glotzaugen, bitte, und den borniert viehischen Ausdruck des Kindes und vergleichen Sie all das mit den Zügen des Angeklagten«, sagte der Staatsanwalt, – »wenn Sie dann noch an seiner Schuld zweifeln – – –!«
»Es wird wohl keinem Menschen einfallen, hier eine gewisse Ähnlichkeit zu leugnen«, fiel der Verteidiger ein, – »ich muß aber ausdrücklich betonen, daß diese Ähnlichkeit nicht dem Verhältnis von Vater zu Kind entspringt, sondern nur dem Umstand einer gemeinsamen Ähnlichkeit mit einem Chamäleon. – Wenn hier jemand die Schuld trägt, so ist es das Chamäleon und nicht der Angeklagte! – Säbelbeine, hoher Gerichtshof, Glotzaugen, hoher Gerichtshof, – sogar ein derartiger Unterkiefer – – –«
»Zur Sache, Herr Verteidiger!«
Der Advokat verbeugte sich. »Also kurz und gut, ich stelle den Antrag auf Einvernahme von Sachverständigen aus der Zoologie.«
Der Gerichtshof hatte nach kurzer Beratung den Antrag mit dem Bemerken abgelehnt, daß er seit neuester Zeit prinzipiell nur noch Sachverständige aus dem Schreibfache zulasse, um eine neue Rede zu beginnen, als der Verteidiger, der sich bis dahin eifrig mit seinem Klienten besprochen hatte, energisch vortrat, auf die Füße des Kindes wies und anhob:
»Hoher Gerichtshof! – Ich bemerke soeben, daß das Kind an den Fußsohlen sehr auffallende sogenannte Muttermale trägt. Hoher Gerichtshof, können das nicht vielleicht – Vatermale sein?! Forschen Sie nach, ich bitte Sie mit aufgehobenen Händen; lassen Sie Herrn Cinibulk sowohl als auch Dr. Lederer hier Schuhe und Strümpfe ausziehen, – vielleicht können wir das Rätsel, wer der Vater ist, in einem Augenblick lösen.«
Der Stadtrat Cinibulk wurde sehr rot und erklärte, lieber seinerseits von der Anklage zurückzutreten, als so etwas zu tun; und er beruhigte sich erst, als man ihm erlaubte, sich vorher draußen die Füße waschen zu dürfen.
Der Angeklagte Max Lederer zog zuerst seine Strümpfe aus.
Als seine Füße sichtbar wurden, erhob sich ein brüllendes Gelächter im Auditorium: Er hatte nämlich Klauen, – jawohl, zweigespaltene Klauen wie ein Chamäleon.
»No servus, das sind doch überhaupt keine Füße«, brummte der Staatsanwalt ärgerlich und schmiß seinen Bleistift zu Boden.
Der Verteidiger machte sogleich den Vorsitzenden aufmerksam, daß es denn doch wohl ausgeschlossen sei, daß so eine stattliche Dame wie Frau Cinibulk jemals mit einem so häßlichen Menschen hätte intim verkehren können; – doch der Gerichtshof meinte, während der fraglichen Delikte hätte der Angeklagte doch nicht die Stiefel auszuziehen zu brauchen.
»Sagen Sie, Herr Doktor«, wandte sich leise der Verteidiger während der noch immer herrschenden Unruhe an den Gerichtsarzt, mit dem er gut befreundet war, – »sagen Sie, können Sie nicht auf geistige Umnachtung schließen?«
»Natürlich kann ich das, – ich kann alles, ich war doch früher Regimentsarzt; – warten wir aber noch ab, bis der Herr Stadtrat hereinkommt.«
Aber Stadtrat Cinibulk, der kam nicht und kam nicht.
Da könne man noch lange warten, hieß es; und die Verhandlung hätte vertagt werden müssen, wenn nicht plötzlich aus dem Auditorium der Optiker Cervenka hervorgetreten wäre und der Sache eine neue Wendung gegeben hätte:
»Ich kann es nicht mehr mit ansehen«, sagte er, »daß ein Unschuldiger leidet, und unterziehe mich lieber freiwillig einer Disziplinarstrafe wegen nächtlicher Ruhestörung. Ich war es, der damals die Erscheinung am Himmel hervorgebracht hat. Mittels zweier Sonnenmikroskope oder Scheinwerfer, die eine neue wunderbare Erfindung von mir sind, habe ich damals zersetzte, also unsichtbare Lichtsrahlen gegen den Himmel geworfen. Wo sie sich trafen, wurden sie sichtbar und bildeten die helle Scheibe. – Das vermeintliche Chamäleon war ein kleines Diapositivbild des Herrn Doktor Lederer, das ich an die Wolken warf, da ich mein eigenes zu Hause vergessen hatte. Ich habe nämlich früher einmal den Dr. Lederer im Dampfbad der Kuriosität wegen photographisch aufgenommen. – Also, wenn sich die Frau Cinibulk, die damals hochschwanger war, an diesem Bilde ›versehen‹ hat, ist es sehr begreiflich, daß das Kind dem Angeklagten ähnlich sieht.«
Der Gerichtsdiener kam jetzt herein und meldete, daß tatsächlich an den Sohlen des Herrn Stadtrates muttermalartige Flecken anfingen sichtbar zu werden, doch müsse man immerhin weiter weg versuchen, ob sie sich nicht auch noch wegwaschen ließen.
Der Gerichtshof beschloß jedoch, das Resultat nicht erst abzuwarten, sondern sprach den Angeklagten wegen Mangels an Beweisen frei.


Im Ruderklub »Clia« herrschte brausender Jubel. Rudi, genannt der Sulzfisch, der zweite »Bug«, hatte sich überreden lassen und sein Mitwirken zugesagt. – Nun war der »Achter« komplett. – Gott sei Dank. –
Und Pepi Staudacher, der berühmte Steuermann, hielt eine schwungvolle Rede über das Geheimnis des englischen Schlages und toastierte auf den blauen Donaustrand und den alten Stephansdom (duliö, duliö). Dann schritt er feierlich von einem Ruderer zum andern, jedem das Trainingsehrenwort – vorerst das kleine – abzunehmen.
Was da alles verboten wurde, es war zum Staunen! Staudacher, für den als Steuermann all dies keinerlei Geltung hatte, wußte es auswendig: »Erstens nicht rauchen, zweitens nicht trinken, drittens keinen Kaffee, viertens keinen Pfeffer, fünftens kein Salz, sechstens – – siebtens – – – achtens – – –, und vor allem keine Liebe, – hören Sie, – keine Liebe! – weder praktische noch theoretische –!«
Die anwesenden Klubjungfrauen sanken um einen halben Kopf zusammen, weil sie die Beine ausstrecken mußten, um ihren Freundinnen vis-a-vis bedeutungsvolle Fußtritte unter dem Tisch zu versetzen.
Der schöne Rudi schwellte die Heldenbrust und stieß drei schwere Seufzer aus, die anderen schrien wild nach Bier, der kommenden schrecklichen Tage gedenkend. –
»Eine Stunde noch, meine Herren, heute ausnahmsweise, dann ins Bett, und von morgen an schläft die Mannschaft im Bootshause.«
»Mhm«, brummte bestätigend der Schlagmann, trank aus und ging. »Ja, ja, der nimmt's ernst«, sagten alle bewundernd. –
Spät in der Nacht traf ihn die heimkehrende Mannschaft zwar Arm in Arm mit einer auffallend gekleideten Dame in der Bretzelgasse, aber es konnte ja gerade so gut seine Schwester sein. – Wer kann denn in der Dunkelheit eine anständige Dame von einer Infektioneuse unterscheiden!
Der »Achter« kam dahergesaust, die Rollsitze schnarchten, die schweren Ruderschläge dröhnten über das grüne, klare Wasser.
»Jetzt kommt der Endspurt, da schauen S', da schauen S'!«
»Eins, zwei, drei, vier, fünf – aha – ein vierundvierziger!«
Staudachers Kommandogeheul ertönte: »Achtung, stop. Achter, Sechser: zum Streichen! Einser, Dreier: fort. – Ha–alt!«
Die Mannschaft stieg aus, keuchend, schweißbedeckt. –
»Da schauen S' den Nummer drei, die Pratzen! Wie junge Reisetaschen, was? Überhaupt die Steuerbordseite is gut beisamm'. – Der beste Mann im Boot ist halt doch Nummer sieben. – Ja, ja, unser Siebener. Gelt, Wastl, ha, ha.«
»No, und die Haxn von Nummer acht san gar nix, was?«
»Wissen S', wievüll mür heut g'fahrn san, Herr von Borgenheld?« wandte sich Sebastian Kurzweil, der zweite Schlagmann an den Vizeobmann, der verständnislos dem Herausheben des vierzehn Meter langen, einem Haifisch gleichenden Achtriemers zusah.
»Dreimal«, riet der Vizeobmann.
»Wie vüll, sag' ich«, brüllte Kurzweil.
»Fünfmal«, stotterte erschreckt Herr von Borgenheld.
»Himmelsakra!« – der Ruderer schüttelte den Arm.
»Er meint: – ›wie lang‹«, warf ein Junior ein, der schüchtern dabeistand und einen schmutzigen Fetzen in der Hand hielt.
»Ach so! – Fünf Kilometer!«
Die Mannschaft machte Miene, sich auf Herrn von Borgenheld zu stürzen. Sie hätten ihn zerrissen, da rief sie eine Serie rätselhafter Kommandos wieder an das Boot: »Mann an Rigger, – aufff – auf mich (prschsch – da lief das Wasser aus dem umgewendeten Boot) – schwen–ken, – fort!« –
Und acht rot-weiß und spärlich bekleidete Gestalten, ohne Strümpfe und mit phantastischem Schuhwerk hantierten an dem Boot herum und schleppten es mit tiefem Ernst in den Schuppen. –
»No, raten Sie jetzt!« und der Steuermann schwenkte eine silberne Taschenuhr an einem roten Strick hin und her.
»Also wie viel?« – Der Vizeobmann mochte aber nicht mehr. Staudacher zündete sich eine Virginia na, denn ein echter Steuermann muß gewissenhaft alles tun, was gesundheitsschädlich ist, um leichter zu werden.
»Also raten Sie, Herr Dr. Hecht!«
»Füglich – äh – füglich – soll man die ›Zeit‹ geheim halten«, näselte dieser fachgewandt und zwinkerte nervös mit den Augenlidern.
»No, dann schauen Sie selbst«, sagte Staudacher. Alle beugten sich vor.
»5 Minuten 32 Sekunden«, kreischte der Junior und schwenkte den schmutzigen Fetzen über dem Kopf.
»Jawohl 5:32! – Wissen Sie, was das heißt, meine Herren, 5:32 für 2000 Meter, – stehendes Wasser, ich bitte!«
»Fünfi zwoaradreiß'g, fünfi zwoaradreiß'g«, brüllte Kurzweil, der jetzt splitternackt auf der Terrasse des Bootshauses stand, wie ein Stier herunter.
Eine wilde Begeisterung ergriff alle Mitglieder.
5:32!! –
Sogar der Obmann Schön machte einen dicken Hals und meinte, daß man selbst seinerzeit in Zürich, im Seeklub, keine bessere Zeit gefahren sei.
»Jawohl, 5:32! Und kennen Sie auch den Hamburger Rekord im Training?« fuhr Staudacher fort. – – »6 Minuten 2 Sekunden!! bei Windstille, – – mir hat es ein Freund telegraphiert. – – 6:2! – – –! und wissen Sie auch, was 30 Sekunden Differenz sind? 11 Längen – klare Längen, – jawohl!«
»Sie, Ihre Zeit kann absolut nicht stimm'«, wandte sich ein Berliner Ruderer, der als Gast zugegen war, an Staudacher, »sehen Se mal, der englische Professionalrekord is 5:55, da wären Sie ja um 23 Sekunden besser. Nu hören Se mal! – Überhaupt die Wiener ›Zeiten‹ sind verflucht verdächtig, – vielleicht jehen Ihre Stoppuhren falsch!«
»Schauen S', daß weiter kommen, Sö – fünfifünfafufz'g Sö, – setzen S' ös in d' Lotterie dö fünfifünfafufz'g. Haben S' überhaupt an Idee – bereits – – was mür Weana für a Kraft hab'n«, höhnte Kurzweil von der Terrasse, dann hob er die Arme und brüllte, wie weiland Ares im trojanischen Krieg, daß es durch die Erlenwäldchen an den Ufern des Donaukanals gellte.
»Hören Se doch nu endlich mit dem Jebrülle auf – Sie da oben, – oder wollen Sie vielleicht 'n dreibänd'ges Buch über planloses Jeschrei herausjeben!« rief der Berliner ärgerlich.
»Pst, pst – nur keinen Streit«, besänftigte Staudacher. – »Übrigens, meine Herren, – ich nehme heute schon die Glückwünsche zu unserem künftigen großen Siege in Hamburg entgegen. – Meine Herren, auf diesen Sieg –, meine Herren – hipp – hipp – –«
Die harmonischen Töne einer Drehorgel schnitten ihm die Worte ab – einen Augenblick Totenstille, dann rhythmisches Trampeln im Ankleideraum der Mannschaft, und alle stimmten begeistert mit ein in das Lied:
»Dös is wos für'n Weana,
Für a wean'risches Bluat,
Wos a wean'rischer Walzer
An 'm Weana all's tuat ...«
Der Ausschluß des Klubs war auf dem Bahnhof versammelt und wartete auf die aus Hamburg heimkehrende Mannschaft in größter Erregung, denn in den Morgenblättern war ein schreckliches Telegramm abgedruckt gewesen:
HAMBURG – ACHTERRENNEN UM DEN STAATSPREIS.
»Resultate: Favorit = Hammonia – Hamburg – erste: 6 Minuten 2 Sekunden; Ruderklub ›Clia‹ – Wien – letzte: 6 Minuten 32 Sekunden
»Interessantes Rennen zwischen Favorit = Hammonia, Hamburg, und Berliner Ruderklub. Wien unter acht Booten achtes, kam nie ernstlich in Betracht. Die Arbeit der Österreicher saft- und kraftlos und auffallend marionettenhaft.«
»Sehen Sie wohl, was habe ich jesagt«, höhnte der Berliner, der schon eine Stunde auf dem Perron wartete, »jerade ne janze Minute schlechtere Zeit als anjeblich hier im Training.«
»Ja, es ist schrecklich fatal«, lispelte der Obmann, »und wir haben schon gestern Einladungen zum Siegesfest verschickt und das Bootshaus beflaggt und mit Reisig geschmückt.«
»Es muß rein etwas passiert sein«, meinte zögernd ein alter Herr, – dann schrien plötzlich alle durcheinander: »Der Nummer zwei is Schuld – –, der Sulzfisch, der zieht ja nicht einmal das Gewicht seiner Kappe, – der ganze Kerl ist schwabberig wie Hektographenmasse.«
»Was denn Nummer zwei! Die ganze Backbordseite ist keinen Schuß Pulver wert.«
»Überhaupt, der ›Einsatz‹ fehlt. Catch the water! – verstehen Sie mich, – verstehen Sie englisch? Catch the water. Schauen Sie her, so! catch, catch, catch!«
»Meine Herren, meine Herren, was nutzt das alles: catch, catch, catch, wenn man ›Swivels‹ hat, wie wollen Sie da ›einsetzen‹. Hab' ich nicht immer gesagt: feste Dollen, was, Herr von Schwamm? – Ja, feste Dollen, haha, zu meiner Zeit: rum – bum – rum bum –«
»Hätt' allesnicht g'schadt, aber natürlich knapp vorm Training bei der Nacht mit Weibern rumlaufen, daran liegt's. Haben S' damals unsern ›Stroke‹ g'segn in der Bretzelgass'n? Wissen S', wer die Frauensperson war? Die blonde Sportmirzl, wann Sö's no kenna!«
Ein gellender Pfiff. Der Zug fährt ein.
Aus verschiedenen Coupés steigen die »Clianesen« aus. Ärgerliche Gesichter, müde, abgespannte Mienen: – – –
»Träger! Träger! – Himmel Sakra, sind denn keine Träger da!«
»Erzählt's doch, was ist denn g'schehn? Letzte, immer Letzte?«
»Der ›Sulzfisch‹«, murmelte Kurzweil ingrimmig.
Der schöne Rudi hat es gehört und tritt mit geschwellter Heldenbrust an ihn heran: »Mein Herr, ich bin Reserveleutnant im Artillerieregiment Nr. 23, verstehen Sie mich?« Und er zwinkert mit entzündeten Lidern, und sein Gesicht ist klebrig und rußgeschwärzt, als ob er auf einem Stempelkissen geschlafen hätte.
»Ruhe, meine Herren, Ruhe!« Staudacher ist es, der eine Flasche in der Hand hält.
»Erzählen, Staudacher, erzählen!« – Alles umdrängte ihn. Der kleine Steuermann hebt die Flasche in die Höhe: »Hier ist des Rätsels Lösung, – wissen Sie, was da drin ist? – Alsterwasser, Hamburger Alsterwasser! – – Und da drin soll unsereins rudern, wo wir an unser dünnes klares ›Kaiserwasser‹ gewöhnt sind, – net wahr, Kurzweil? Wissen S', daß dieses Alsterwasser bereits um ein Fünftel dicker ist als wie das unsrige!? – (ja, wirklich, m'r siecht's) – Ich hab's selbst mit dem Aräometer g'messen, und unsere Zeit ist trotzdem nur ein Sechstel schlechter! – Nur ein Sechstel – meine Herren! – Hä? Habn S' an Idee, wie wir hier g'wonnen hätten! – Da wären die Hamburger gar net mit'kommen.«
Alle waren voll Bewunderung: »Nein, wirklich, alles was recht ist, unser Staudacher ist ein findiger Kopf, so einen sollen S' uns zeigen, die, die ... die deutschen Brüder aus dem ›Reich‹ – –«
»Ja, ja! – 's gibt nur a Kaiserstadt, 's gibt nur a Wean!«

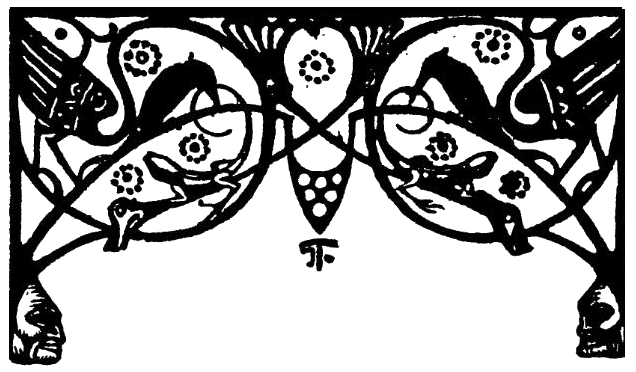
Die beiden Freunde saßen an einem Eckfenster des Cafés Radetzky und steckten die Köpfe zusammen.
»Er ist fort, – heute nachmittag mit seinem Diener nach Berlin gefahren. – Das Haus ist vollkommen leer; – ich komme soeben von dort und habe mich genau überzeugt; – die beiden Perser waren die einzigen Bewohner.«
»Also ist er doch auf das Telegramm hereingefallen?!«
»Darüber war ich keinen Moment im Zweifel; wenn er den Namen Fabio Marini hört, ist er nicht zu halten.«
»Wundert mich eigentlich, denn er hat doch Jahre mit ihm zusammengelebt, – bis zu seinem Tode, – was könnte er da noch Neues über ihn in Berlin erfahren?«
»Oho! Professor Marini soll ihm noch vieles geheim gehalten haben; – er hat es selbst so gesprächsweise fallen lassen, – ungefähr vor einem halben Jahr, als unser guter Axel noch unter uns war.«
»Ist denn tatsächlich etwas Wahres an dieser geheimnisvollen Präparationsmethode Fabio Marinis? – Glaubst du wirklich so fest daran, Sinclair? –«
»Von ›glauben‹ kann hier gar keine Rede sein. Mit diesen Augen habe ich in Florenz eine von Marini präparierte Kindesleiche gesehen. Ich sage dir, jeder hätte geschworen, daß das Kind bloß schlafe, – keine Spur von Starre, keine Runzeln, keine Falten – sogar die rosa Hautfarbe eines Lebendigen war vorhanden.«
»Hm. – Du denkst, der Perser könne wirklich Axel ermordet und – – –«
»Das weiß ich nicht, Ottokar, aber es ist denn doch unser beider Gewissenspflicht, uns Sicherheit über Axels Schicksal zu verschaffen. – Was, wenn er damals durch irgendein Gift bloß in eine Art Totenstarre versetzt worden wäre! – Gott, wie habe ich auf dem anatomischen Institut den Ärzten zugeredet, – sie angefleht, noch Wiederbelebungsversuche zu machen. – – – Was wollen Sie denn eigentlich, hieß es, – der Mann ist tot, das ist klar, und ein Eingriff an der Leiche ohne Erlaubnis des Dr. Daraschekoh ist unzulässig. Und Sie wiesen mir den Kontrakt vor, in dem ausdrücklich stand, daß Axel dem jeweiligen Inhaber dieses Scheines seinen Körper nach dem Tode verkaufe und dafür bereits am so und sovielten 500 fl. in Empfang genommen und quittiert habe.«
»Nein, – es ist gräßlich, – und so etwas hat in unserem Jahrhundert noch Gesetzeskraft. – So oft ich daran denke, faßt mich eine namenlose Wut. – Der arme Axel! – Wenn er eine Ahnung gehabt hätte, daß dieser Perser, sein wütendster Feind, der Besitzer des Kontraktes sein könne! – Er war immer der Ansicht, das anatomische Institut selbst – –«
»Und konnte denn der Advokat gar nichts ausrichten? –«
»Alles umsonst. – Nicht einmal das Zeugnis des alten Milchweibes, daß Daraschekoh einmal in seinem Garten bei Sonnenaufgang den Namen Axels so lange verflucht habe, bis ihm im Paroxysmus der Schaum vor den Mund getreten sei, wurde beachtet. – – Ja, wenn Daraschekoh nicht europäischer medicinae doctor wäre! – Wozu aber noch reden, – willst du mitgehen oder nicht, Ottokar? Entschließe dich.«
»Gewiß will ich – aber bedenke, wenn man uns erwischt – als Einbrecher! – Der Perser hat einen tadellosen Ruf als Gelehrter! Der bloße Hinweis auf unseren Verdacht ist doch, – weiß Gott, – kein plausibler Grund. – Nimm es mir nicht übel, aber ist es wirklich ganz ausgeschlossen, daß du dich geirrt hast, als du Axels Stimme vernahmst? – – Fahre nicht auf, Sinclair, bitte, sage mir noch einmal genau, wie das damals geschah. – Warst du nicht vielleicht schon vorher irgendwie aufgeregt?« –
»Aber gar keine Spur! – Eine halbe Stunde früher war ich auf dem Hradschin und sah mir wieder einmal die Wenzelskapelle und den Veitsdom an, diese alten fremdartigen Bauten mit ihren Skulpturen wie aus geronnenem Blut, die immer von neuem einen so tiefen, unerhörten Eindruck auf unsere Seele machen, – und den Hungerturm und die Alchimistengasse. – Dann ging ich die Schloßstiege herab und bleibe unwillkürlich stehen, da die kleine Tür, die durch die Mauer zum Hause Daraschekohs führt, offen ist. – Im selben Augenblick höre ich deutlich, – es mußte aus dem Fenster herüber tönen – eine Stimme (und ich schwöre einen heiligen Eid darauf: es war Axels Stimme) –rufen: Eins – – zwei – – drei – – vier.
Ach Gott, wäre ich doch damals sofort in die Wohnung eingedrungen; – aber ehe ich mich recht besinnen konnte, hatte der türkische Diener Daraschekohs die Mauerpforte zugeschlagen. – Ich sage dir, wir müssen in das Haus! – Wir müssen! – Was, wenn Axel wirklich noch lebte! – Schau, – man kann uns ja gar nicht erwischen. – Wer geht denn nachts über die alte Schloßstiege, bitte dich, – und ich kann jetzt mit Sperrhaken umgehen, daß du staunen wirst.«
Die beiden Freunde hatten sich bis zur Dunkelheit in den Straßen umhergetrieben, ehe sie ihren Plan ausführten. Dann waren sie über die Mauer geklettert und standen endlich vor dem altertümlichen Hause, das dem Perser gehörte.
Das Gebäude – einsam auf der Anhöhe des Fürstenbergschen Parkes – lehnt wie ein toter Wächter an der Seitenmauer der grasbewachsenen Schloßstiege.
»Dieser Garten, diese alten Ulmen da unten haben etwas namenlos Grauenhaftes«, flüsterte Ottokar Dohnal, »sieh nur, wie drohend sich der Hradschin vom Himmel abhebt. – Und diese erleuchteten Nischenfenster dort in der Burg! – Wahrhaft, es weht eine seltsame Luft hier auf der Kleinseite. – Als ob sich alles Leben tief in die Erde zurückgezogen hätte – aus Angst vor dem lauernden Tode. Hast du nicht auch das Gefühl, daß eines Tages dieses schattenhafte Bild plötzlich versinken könnte – wie eine Vision, – eine Fata morgana, – daß dieses schlafende zusammengekauerte Leben wie ein gespenstisches Tier zu etwas Neuem, Schreckhaften erwachen müßte! – Und sieh nur, da unten die weißen Kieswege – wie Adern.« –
»Komm doch schon«, drängte Sinclair, »mir schlottern die Knie vor Aufregung, – hier, – halte mir unterdessen den Stationsplan.«
Die Türe war bald geöffnet und die beiden tappten eine alte Treppe empor, auf die der dunkle Sternenhimmel durch die runden Fenster kaum einen Schein warf.
»Nicht anzünden, man könnte von unten – vom Gartenhaus – das Licht bemerken, hörst du Ottokar! Geh dicht hinter mir. Achtung, hier ist eine Stufe ausgebrochen. – Die Gangtür ist offen – – – – hier, hier – links.«
Sie standen plötzlich in einem Zimmer.
»So mach doch keinen solchen Lärm!«
»Ich kann nicht dafür: die Türe ist von selbst wieder zugefallen.«
»Wir werden Licht machen müssen. Ich fürchte jeden Augenblick etwas umzuwerfen, es stehen soviel Stühle im Weg.«
In diesem Moment blitzte ein blauer Funke an der Wand auf, und ein Geräusch wurde hörbar – wie ein seufzendes Einatmen.
Leises Knirschen schien aus dem Boden, aus allen Fugen zu dringen.
Eine Sekunde wieder Totenstille. – Dann zählte laut und langsam eine röchelnde Stimme:
Eins – – – – zwei – – – – drei – –
Ottokar Dohnal schrie auf, kratzte wie wahnsinnig an seiner Streichholzschachtel, – seine Hände flogen vor grauenhaftem Entsetzen. – Endlich Licht – Licht! Die beiden Freunde blickten sich in die kalkweißen Gesichter: »Axel!«
– – viiier – – fünf – – sssechss – siiieben –
Dort aus der Nische kommt das Zählen.
acht – neun – zeeehn – elf –
Von der Decke der Wandvertiefung an einem Kupferstab hing ein menschlicher Kopf mit blondem Haar. – Der Stab drang mitten in die Scheitelwölbung. – Der Hals unter dem Kinn mit einer seidenen Schärpe umwickelt – – und darunter mit Luftröhren und Bronchien die zwei rötlichen Lungenflügel. – Dazwischen bewegte sich rhythmisch das Herz, – mit goldenen Drähten umwunden, die auf den Boden zu einem kleinen elektrischen Apparate führten. – Die Adern, straff gefüllt, leiteten Blut aus zwei dünnhalsigen Flaschen empor.
Ottokar Dohnal hatte die Kerze auf einen kleinen Leuchter gestellt und klammerte sich an seines Freundes Arm, um nicht umzufallen.
Das war Axels Kopf, die Lippen rot, mit blühender Gesichtsfarbe, wie lebend. – Die Augen, weit aufgerissen, starrten mit einem gräßlichen Ausdruck auf einen Brennspiegel an der gegenüberliegenden Wand, die mit turkmenischen und kirgisischen Waffen und Tüchern bedeckt schien. – Überall die bizarren Muster orientalischer Gewebe.
Das Zimmer war voll präparierter Tiere – Schlangen und Affen in seltsamen Verrenkungen lagen unter umhergestreuten Büchern.
In einer gläsernen Wanne auf einem Seitentische schwamm ein menschlicher Bauch in einer bläulichen Flüssigkeit.
Die Gipsbüste Fabio Marinis blickte von einem Postamente ernst auf das Zimmer herab. –
Die Freunde konnten kein Wort hervorbringen; hypnotisiert starrten sie auf das Herz dieser furchtbaren menschlichen Uhr, das wie lebendig zitterte und schlug.
»Um Gottes willen – fort von hier – ich werde ohnmächtig. – Verflucht sei dieses persische Ungeheuer.«
Sie wollten zur Türe.
Da! – Wieder dieses unheimliche Knirschen, das aus dem Munde des Präparators zu kommen schien. –
Zwei blaue Funken zuckten auf und wurden von dem Brennspiegel gerade auf die Pupillen reflektiert. Seine Lippen öffneten sich, – schwerfällig streckte sich die Zunge vor, – bog sich hinter die Vorderzähne, – und die Stimme röchelte:
Ein Vier–rrr– tel.
Dann schloß sich der Mund und das Gesicht stierte wieder geradeaus.
»Gräßlich!! – Das Gehirn funktioniert – lebt. – – – – nimm die Kerze, Sinclair!«
»So öffne doch, um Himmels willen – warum öffnest du nicht?«
»Ich kann nicht, da – da, schau!«
Die innere Türklinke war eine menschliche Hand, mit Ringen geschmückt. – Die Hand des Toten; die weißen Finger krallten ins Leere. –
»Hier, hier, nimm das Tuch! Was fürchtest du dich – – es ist doch unseres Axels Hand!«
Sie standen wieder auf dem Gang und sahen, wie die Türe langsam ins Schloß fiel.
Eine schwarze gläserne Tafel hing daran:
DR. MOHAMMED DARASCHE-KOH
ANATOM
Die Kerze flackerte im Luftzug, der über die ziegelsteinerne Treppe emporwehte.
Da taumelte Ottokar an die Wand und sank stöhnend in die Knie: »Hier! Das da – –« er wies auf den Glockenzug.
Sinclair leuchtete näher hin.
Mit einem Schrei sprang er zurück und ließ die Kerze fallen. – –
Der blecherne Leuchter klirrte von Stein zu Stein.
Wie wahnsinnig, – die Haare gesträubt, – mit pfeifendem Atem rasten sie in der Finsternis die Stufen hinab.
»Persischer Satan. – Persischer Satan.«


Reifes Sonnenlicht liegt auf den grauen Steinen, – der alte Platz verträumt den stillen Sonntagnachmittag. –
Aneinandergelehnt schlummern die müden Häuser mit den verfallenen Holztreppen und heimlichen Winkeln, – mit den treuen Mahagonimöbeln in den kleinen altmodischen Stuben.
Und warme Sommerluft atmet durch wachsame offene Fensterchen.
Ein Einsamer geht langsam über den Platz zur Kirche des heiligen Thomas, die fromm herabsieht auf das ruhige Bild. Er tritt ein. – Weihrauchduft.
Seufzend fällt die schwere Türe zurück an das Lederpolster. Verschlungen ist der laute Schein der Welt – grünrosa fließen die Sonnenstrahlen durch schmale Kirchenfenster auf die heiligen Steinquadern. – Hier unten ruhen die Frommen aus vom wechselnden Sein.
Der Einsame atmet die tote Luft. – Gestorben sind die Klänge, andächtig liegt der Dom im Schatten der Töne. – Das Herz wird ruhig und trinkt den dunkeln Weihrauchduft.
Der Fremde blickt auf die Schar der Kirchenbänke, die, weihevoll zum Altar hingebeugt, wie auf ein kommendes Wunder warten.
Er ist einer jener Lebendigen, die das Leid überwunden haben und mit andern Augen tief hineinsehen in eine andere Welt. Er fühlt den geheimnisvollen Atem der Dinge: Das verborgene lautlose Leben der Dämmerung.
Die verleugneten, heimlichen Gedanken, die hier geboren wurden, ziehen unstet – suchend durch den Raum. Wesen ohne Blut, ohne Freude und Weh – wachsbleich, wie die kranken Gewächse der Dunkelheit.
Verschwiegen schwingen die roten Ampeln – feierlich – an langen geduldigen Stricken; – der Luftzug von den Flügeln der goldenen Erzengel bewegt sie. –
– Da. Ein leises Scharren unter den Bänken. – Es huscht zum Betstuhl und versteckt sich.
Jetzt kommt es um die Säule geschlichen:
Eine bläuliche Menschenhand!
Auf flinken Fingern läuft sie am Boden hin: eine gespenstische Spinne! – Horcht. – Klettert eine Eisenstange empor und verschwindet im Opferstock.
Die silbernen Münzen darin klirren leise.
Träumend ist ihr de Einsame mit den Augen gefolgt, und seine Blicke fallen auf einen alten Mann, der im Schatten eines alten Pfeilers steht. – Die beiden sehen sich ernst an.
»Es gibt viele gierige Hände hier«, flüstert der Alte.
Der Einsame nickt.
Aus dem nächtigen Hintergrunde ziehen trübe Gestalten heran. Langsam – sie bewegen sich kaum.
Betschnecken!
Menschenbüsten – Frauenköpfe mit schleiernden Umrissen auf kalten, schlüpfrigen Schneckenleibern – mit Kopftüchern und schwarzen katholischen Augen – saugen sie sich lautlos über die kalten Fliesen.
»Sie leben von den leeren Gebeten«, sagt der Alte. »Jeder sieht sie, und doch kennt sie keiner, – wenn sie tagsüber bei den Kirchentüren hocken.«
Wenn der Priester die Messe liest, schlafen sie in den Flüsterecken.
»Hat sie mein Hiersein im Beten gestört?« fragt der Einsame. –
Der Alte tritt an seine linke Seite: »Wessen Füße im lebendigen Wasser stehen, der ist selber das Gebet! Wußte ich doch, daß heute einer kommen würde, der sehen und hören kann!«
Gelbe Lichtreflexe hüpfen über die Steine, wie Irrlichter.
»Sehen Sie die Goldadern, die sich hier unter den Quadern hinziehen?« Das Gesicht des Alten flackert.
Der Einsame schüttelt den Kopf: »Mein Blick dringt nicht so tief. – Oder meinen Sie es anders?«
Der Alte nimmt ihn an der Hand und führt ihn zum Altar. – Das Bild des Gekreuzigten ragt stumm.
Schatten bewegen sich leise in den dunklen Seitenlogen hinter gebrauchten kunstvollen Gittern: – Schemen alter Stiftfräulein aus vergessenen Zeiten, die nie mehr wiederkehren, – fremdartig – entsagungsvoll wie Weihrauchduft.
Es rauschen ihre schwarzen seidenen Kleider.
Der Greis deutet zu Boden: »Hier tritt es fast zutage. Einen Fuß tief unter den Fliesen, – lauteres Gold, ein breiter leuchtender Streifen. Die Adern ziehen sich über den alten Platz bis weiter unter die Häuser. – Wunderbar, daß die Menschen nicht längst schon darauf gestoßen sind, als sie das Pflaster gelegt haben. – Ich allein weiß es seit vielen Jahren und habe es niemandem gesagt. – Bis heute. – Keiner hatte ein reines Herz. –«
Ein Geräusch! –
In dem gläsernen Reliquienschrein ist das silberne Herz herabgefallen, das in der Knochenhand des heiligen Thomas lag.
Der Alte hört es nicht. Er ist entrückt. Seine Augen schauen ekstatisch ins Weite mit starrem, geradem Blick: »Die Tempel sein aus schimmerndem Gold. – Der Fährmann holt über – zum letztenmal.«
Der Fremde lauscht den prophetischen Worten, die flüsternd in seine Seele dringen wie feiner, erstickender Staub aus dem heiligen Moder versunkener Jahrhunderte.
Hier unter seinen Füßen! Ein blinkendes Zepter gefesselter, schlafender Macht! Es steigt ihm brennend in die Augen: Muß denn auf dem Golde der Fluch sein, läßt er sich nicht bannen durch Menschenliebe und Mitleid? – Wieviel Tausende verhungern! –
Vom Glockenturme tönt die siebente Stunde. Die Luft vibriert.
Die Gedanken des Einsamen fliegen mit dem Schall hinaus in eine Welt voll üppiger Kunst, voll Pracht und Herrlichkeit.
Ihn schaudert. Er sieht den Alten an. – Wie verändert sind die Räume. – Es hallt der Schritt. Die Ecken der Betstühle sind abgestoßen, abgeschürft der Fuß der steinernen Pfeiler. Die weißgestrichenen Statuen der Päpste bedeckt mit Staub.
»Haben Sie das ... das Metall mit körperlichen Augen gesehen – in den Händen gehalten?«
Der Alte nickt. »Im Klostergarten draußen, beim Muttergottesbild unter blühenden Lilien, kann man es greifen.«
– – – Er zieht eine blaue Kapsel hervor. »Hier.« Öffnet sie und gibt dem Einsamen ein zackiges Ding.
Die beiden Männer schweigen. – – –
Zur Kirche dringt weit her der Lärm des Lebens: das Volk kehrt heim von den lustigen Wiesen – morgen ist Arbeitstag. –
Die Frauen tragen müde Kinder auf dem Arm.
Der Einsame hat den Gegenstand genommen und schüttelt dem Alten die Hand. – Dann wirft er einen Blick zurück zum Altar. Nochmals umwogt ihn der geheimnisvolle Hauch friedvoller Erkenntnis:
»Vom Herzen gehen Dinge aus – sind herzgeboren und herzgefügt.«
Er schlägt das Kreuz und geht. Am offenen Türspalt lehnt der müde Tag. Frischer Abendwind weht herein. –
Über den Markt rasselt ein Leiterwagen, mit Laub bekränzt, voll lachender, fröhlicher Menschen, und in die Botengänge der alten Häuser fallen die roten Strahlen der sinkenden Sonne.
Der Fremde lehnt an dem steinernen Denkmal inmitten des Platzes und sinnt: Er ruft im Geiste den Vorübergehenden zu, was er soeben erfahren. Er hört, wie das Lachen verstummt. – – – Die Bauten zerstauben, die Kirche stürzt. – – – Ausgerissen, im Staube die weinenden Lilien des Klostergartens. –
Es wankt die Erde; die Dämonen des Hasses brüllen zum Himmel!
Ein Pochwerk hämmert und dröhnt und stampft den Platz, die Stadt und blutende Menschenherzen zu goldenem Staub. – – –
Der Träumer schüttelt den Kopf und sinnt und lauscht der klingenden Stimme des verborgenen Meisters im Herzen: »Wer eine schlimme Tat nicht scheut und die nicht liebt, die Glück verleiht –
Der ist entsagend, einsichtsvoll, entschlossen, voll von Wesenheit.«
Wie ist doch der zackige Brocken so leicht für hartes Gold? – – – Der Einsame sieht ihn an:
Ein menschlicher Wirbelknochen!


Die Schlüssel klirren, und ein Trupp Sträflinge betritt den Gefängnishof. – Es ist zwölf Uhr, und sie müssen im Kreise herumgehen, um Luft zu schöpfen, paarweise – einer hinter dem andern. –
Der Hof ist gepflastert. Nur in der Mitte ein paar Flecken dunkles Gras wie Grabhügel. – Vier dünne Bäume und eine Hecke aus traurigem Liguster.
Ringsum alte gelbe Mauern mit kleinen, vergitterten Kerkerfenstern.
Die Sträflinge in ihren grauen Zuchthauskleidern, sie reden kaum und gehen immer im Kreise herum – einer hinter dem andern. – Fast alle sind krank: Skorbut, geschwollene Gelenke. – Die Gesichter grau wie Fensterkitt, die Augen erloschen. Mit freudlosem Herzen halten sie gleichen Schritt.
Der Aufseher mit Säbel und Mütze steht an der Hoftüre und starrt vor sich hin. –
Längs der Mauer ist nackte Erde. – Dort wächst nichts: das Leid sickert durch die gelben Wände.
»Lukawsky war eben beim Präsidenten«, ruft ein Gefangener den Sträflingen durch sein Kerkerfenster halblaut zu. – Der Trupp marschiert weiter. – »Was ist's mit ihm?« fragt ein Neuling seinen Nebenmann.
»Lukawsky, der Mörder, ist zum Tode verurteilt durch den Strang, und heute glaub' ich, soll sich's entscheiden, ob das Urteil bestätigt wird oder nicht. Der Präsident hat ihm die Bestätigung des Urteils auf dem Amtszimmer verlesen. – Der Lukawsky hat kein Wort gesagt, nur getaumelt hat er. – Aber draußen hat er mit den Zähnen geknirscht und einen Wutanfall bekommen. – Die Aufseher haben ihm die Zwangsjacke angelegt und ihn mit Gurten auf die Bank geschnallt, daß er kein Glied rühren kann bis morgen früh. – Und ein Kruzifix haben sie ihm hingestellt.« – Bruchstückweise hatte der Gefangene den Vorbeimarschierenden dies zugerufen. –
»Auf Zelle Nr. 25 liegt er, der Lukawsky«, sagt einer der ältesten Sträflinge. – Alle blickten zum Gitterfenster Nr. 25 hinauf.
Der Aufseher lehnt gedankenlos am Tor und stößt mit dem Fuß ein Stück altes Brot beiseite, das im Wege liegt. –
In den schmalen Gängen des alten Landgerichtes liegen die Kerkertüren dicht nebeneinander. – Niedrige Eichentüren, in das Mauerwerk eingelassen, mit Eisenbändern und mächtigen Riegeln und Schlössern. – Jede Tür hat einen vergitterten Ausschnitt, kaum eine Spanne im Geviert. Durch diese ist die Neuigkeit gedrungen und läuft längs der Fenstergitter von Mund zu Mund: »Morgen wird er gehenkt!« –
Es ist still auf den Gängen und im ganzen Hause, und doch herrscht ein feines Geräusch. Leise, unhörbar. Nur zu fühlen. – Durch die Mauern dringt es und spielt in der Luft, wie Mückenschwärme. – Das ist das Leben, das gebundene, gefangene Leben!
Mitten im Haupteingang, dort wo er weiter wird, steht eine alte leere Truhe ganz im Dunkeln.
Lautlos, langsam hebt sich der Deckel. – Da fährt es wie Todesfurcht durchs ganze Haus. – Den Gefangenen bleibt das Wort im Munde stecken. Auf den Gängen kein Laut mehr, – daß man das Schlagen des Herzens hört und das Klingen im Ohr. –
Die Bäume und Sträucher auf dem Hofe rühren kein Blatt und greifen mit herbstlichen Ästen in die trübe Luft. – Es ist, wie wenn sie noch dunkler geworden wären. –
Ein Trupp Sträflinge ist stehen geblieben wie auf einen Winke: Hat nicht jemand geschrien? –
Aus der alten Truhe kriecht langsam ein scheußlicher Wurm. – Ein Blutegel von gigantischer Form. – Dunkelgelb mit schwarzen Flecken, saugt er sich die Zellen entlang am Boden hin. – Bald dick werdend, dann wieder dünn, bewegt er sich vorwärts und tastet und sucht. – Am Kopfe seitlich in jeder Höhle starren fünf aneinandergequetschte Augäpfel, – ohne Lider und unbeweglich. – Es ist der Schrecken. –
Er schleicht sich zu den Gerichteten und saugt ihnen das warme Blut aus – unterhalb der Kehle, dort, wo die große Ader das Leben vom Herzen zum Kopfe trägt. – Und umschlingt mit seinen schlüpfrigen Ringen den warmen Menschenleib.
Jetzt ist er zur Zelle des Mörders gekommen. –
Ein langes grauenhaftes Schreien, ohne Unterbrechung, wie ein einziger nicht endender Ton, dringt auf den Hof.
Der Aufseher am Türpfosten fährt zusammen und reißt den Torflügel auf. – »Alle, marsch hinauf, auf die Zellen«, schreit er, und die Gefangenen laufen an ihm vorbei, ohne ihn anzusehen, die steinernen Treppen hinauf. – Trapp, trapp, trapp – mit plumpen, genagelten Schuhen.
Dann ist es wieder still geworden. – Der Wind fährt in den öden Hofraum hinunter und reißt eine alte Dachluke ab, die klirrend und splitternd auf die schmutzige Erde fällt.
Der Verurteilte kann nur den Kopf bewegen. – Er sieht die weiß getünchten Kerkerwände vor sich. – Undurchdringlich. – Morgen früh um sieben Uhr werden sie ihn holen. – Noch achtzehn Stunden bis dahin. – Und sieben Stunden, dann kommt die Nacht. – – – Bald wird Winter sein, und das Frühjahr kommt und der heiße Sommer. – Dann wird er aufstehen – früh – schon in der Dämmerung –, und auf die Straße gehen, den alten Milchkarren ansehen und den Hund davor ... Die Freiheit –! Er kann ja tun, was er will. –
Da schnürt es ihm wieder die Kehle: – wenn er sich nur bewegen könnte, – verflucht, verflucht, verflucht – und mit den Fäusten an die Mauern schlagen. – Hinaus! – – – Alles zerbrechen und in die Riemen beißen. – Er will jetzt nicht sterben – will nicht – will nicht! – Damals hätten sie ihn hängen dürfen, als er ihn ermordet hat, – den alten Mann, – der schon mit einem Fuß im Grabe stand. – Jetzt hätte er es doch nicht mehr getan! – Der Verteidiger hat das nicht erwähnt. – Warum hat er es den Geschworenen nicht selbst zugerufen?! – Sie hätten dann anders geurteilt. – Er muß es jetzt noch dem Präsidenten sagen. – Der Aufseher soll ihn vorführen. – Jetzt gleich. – – – Morgen früh ist's zu spät, da hat der Präsident die Uniform an, und er kann nicht so dicht an ihn heran. – Und der Präsident würde ihn nicht anhören. – Dann ist's zu spät, man kann die vielen Polizeileute nicht mehr wegschicken. – Das tut der Präsident nicht. – – –
Der Henker legt ihm die Schlinge über den Kopf, – er hat braune Augen und sieht ihm immer scharf auf den Mund. – Sie reißen an, alles dreht sich – halt, halt – er will noch etwas sagen, etwas Wichtiges.
Ob der Aufseher kommen wird und ihn heute noch losbinden von der Bank? – Er kann doch nicht so liegen bleiben die ganzen achtzehn Stunden. – Natürlich nicht, der Beichtvater muß doch noch kommen, so hat er es immer gelesen. Das ist Gesetz. – Er glaubt an nichts, aber nach ihm verlangen wird er, es ist sein Recht. – Und den Schädel wird er ihm einschlagen, dem frechen Pfaffen, mit dem steinernen Krug dort. – – – – – – Die Zunge ist ihm wie gedörrt. – Trinken will er – er ist durstig. – Himmel, Herrgott! – Warum geben sie ihm nichts zu trinken! – Er wird sich beschweren, wenn die Inspektion nächste Woche kommt. – Er wird es ihm schon eintränken, – dem Aufseher, dem verfluchten Hund! – Er wird solange schreien, bis sie kommen und ihn losbinden, immer lauter und lauter, daß die Wände einstürzen. – Und dann liegt er unter freiem Himmel ganz hoch oben, daß sie ihn nicht finden können, wenn sie um ihn herum gehen und ihn suchen. – – – – – – – – – Er muß irgendwo herabgefallen sein, deucht ihm, – es hat ihm einen solchen Ruck gegeben durch den Körper. –
Sollte er geschlafen haben? – Es ist dämmerig. –
Er will sich an den Kopf greifen: seine Hände sind festgebunden. – – – Vom alten Turme dröhnt die Zeit – eins, zwei – wie spät mag's sein? – Sechs Uhr. – Herrgott im Himmel, nur noch dreizehn Stunden, und sie reißen ihm den Atem aus der Brust. – Hingerichtet soll er werden, erbarmungslos – gehenkt. – Die Zähne klappern ihm vor Kälte. – Etwas saugt ihm am Herzen, er kann es nicht sehen. – Dann steigt es ihm schwarz ins Gehirn. – Er schreit und hört sich nicht schreien, – alles schreit in ihm, die Arme, die Brust, die Beine, – der ganze Körper, – ohne Aufhören, ohne Atemholen. – – –
An das offene Fenster des Amtszimmers, das einzige, das nicht vergittert ist, tritt ein alter Mann mit weißem Bart und einem harten, finstern Gesicht und sieht in den Hofraum hinab. Das Schreien stört ihn, er runzelt die Stirn, – murmelt etwas und schlägt das Fenster zu.
Am Himmel jagen die Wolken und bilden hakenförmige Streifen. – – Zerfetzte Hieroglyphen, wie eine alte, verloschene Schrift: »Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet!«


St sprich (s-prich) wie S–t
und mach die Schnauze süß und lieblich.
Jörn Uhl war lang, hatte die Augen enge stehend und strohblondes Haar. – Er war ein Obotrit seiner Abstammung nach. – Möglich auch, dass er ein Kaschube war, – jedenfalls war er ein Norddeutscher.
Er lebte abgeschlossen, stand früh vor Sonnenaufgang mit den Hühnern auf und wusch sich dann immer in einer Ballje, während seine Brüder noch in den Federn lagen. –
Mach dich nützlich, war sein Wahlspruch, und wenn Sonnabendabends die alte Magd Dorchen Mahnke mit Gretchen Klempke am Gesindetisch saß und tühnte, – ach, da schnackte er nu nie mit. –
Er war so abgeschlossen und gänzlich verschieden von seinen Geschwistern, und das kam wohl daher, weil seine Mutter, als sie ihn zeugte, an etwas ganz anderes gedacht hatte. –
»Tühnen – nein«, – sagte er sich, biß die Zähne zusammen und ging hinaus in die Abendluft.
Er war ein Uhl!!
Dahinten – weit am Himmel lag das letzte träumende Gelb, schwere Nachtwolken darüber, daß die Sterne nicht hervorkonnten. Und dichte Nebelschleier zogen langsam über die Heide. – –
Da kam ein dunklen Schatten mit etwas Blitzendem über der Schulter auf das Haus zu. – War Fiete Krey, der so spät noch von Felde kam. – Ein paar Schritte von ihm weg Lisbeth Sootje, das Süßchen, – und sie trippelte auf Jörn zu und bot ihm die kleine Hand.
»'n Tachch, Jörn«, sagte sie so fein zu ihm, als er ihre Hand hielt. – »Ich komme nu man eben ein büschen snacken. Is Dorchen in? – Sieh ma, ich hab mich ein Strickstrumpf mitgebracht, – ach, nu hat sich das Strickzeug verheddert. Laß nachch«, und: »muß mal klar kriegen«, sagte sie dann, um sich von ihm loszumachen. –
Jörn kuckte ihr auf das blonde Köpfchen. –
Heintüüt, wollte er zu ihr sagen, Heintüüt; aber er sagte es nicht, er dachte es bloß, – er war ein Uhl! –
Noch oft später im Leben mußte er daran denken, daß er ihr damals nicht Heintüüt gesagt hatte, und auch sie dachte später oft daran zurück, wie sich ihr Strickzeug vertüdert hatte. –
So läßt es Gott oft anders geschehen, als wir hier auf Erden uns vornehmen. – Nöch?
Jörn strich noch durch die Wiesen, und es lag so kühl in der Luft. – Von weitem drangen über die Felder die Weisen der Spielleute aus der Schenke, bald leise, leise, – bald übermäßig deutlich, – wie es der Abendwind herübertrug. Als es an zu regnen fing, lenkte er seine Schritte dem Hofe zu. –
Es war schon so finster geworden, daß man es kaum über den Weg springen sah, wenn ein Pagütz mang das Gras hüpfte. Jörn legte seine Kappe ab, als er an den Gesindetisch trat.
»Hast dein Strickzeug all klar gekriegt?« sagte er zu Lisbeth.
»Hab' es klar gekriecht«, nickte sie. –
»Hest du all 'n Swohn siehn, dej mit 'n Buuk opn koolen Woter swemm?« fragte da Pieter Uhl, sein Bruder, und tat vertraulich zu Gretchen Klempke. –
»Ich geh' nu man nach oben«, sagte Jörn verdrossen, der solche Redensarten nicht leiden mochte. – »Schlaf süß, Lisbeth!« »Schlaf süss, Jörn!«
»Baller man, jüü«, rief ihm sein Bruder nach.
»Ja-nu-man«* – – – seufzte Dorchen Mahnke, denn sie war hellsehend.
[* »Ja-nu-man«. Niicht zu verwechseln mit Hanuman--der Affenkönig--brahmhinische Götterfigur.]
Jörn Uhl war nach oben gegangen – in sein Zimmer, – reinigte sein Beinkleid, denn er war arg in Mudd gesackt, und aß noch ein bißchen Buchweizengrütze mit Sahne, die er von Mittag her in einen Topf getan und hinter dem Ofen verstochen hatte. –
»Schmeckt schön«, sagte er.
Dann nahm er einen Foil und machte reine. –
Bis alles wieder blitzeblank gescheuert war, nahm er ein Buch vor, das ihm Fiete Krey mal von Hamburg mitgebracht hatte, wo gerade Dom war. –
»Ach, das ist es ja nich«, sagte er. – »Es is wohl Claudius, der Wandsbecker Bote: – – ›lieber Mond, du gehst so stille‹ – der ruht nu man schon lange draußen in Ottensen.« –
Denn nahm er ein ander Buch aus dem Spinde und trat für einen kleinen Augenblick an das Vogelbauer, das vor dem Fenster hing. –
»Bist du ein klein süßer Finke«, sagte er, »tüüt – tüüt.« – – Das Vögelchen hatte sein Köpfchen aus den Flügeln gezogen und sah nu ganz starr und erschrocken ins Lichte. – – Dann klappte er finster die Luke zu, denn von drüben her aus Krögers Destillation tönte das trunkene Gegröhle der wüsten Gesellen beim Bechersturz, – und setzte sich in Urahns geschnitzten Stuhl. – – – – – War auch so'n altes Stück! – Mit steife Lehne, und da, wo die Farbe wechgetan war, kuckte nu das schöne Schnitzwerk durch.
Clawes Uhl anno domini 1675 stand darüber.
Ja, die Uhlen waren ein erbgesessen Geschlecht, knorrig und hahnebüchen! –
Wie Großmutter Jörn zum Manne nahm – Jörns Großvater hiess auch Jörn – da wollte sie lange nicht ja und Amen sagen. –
Sie war eine stolze Deern gewesen, und verschlossen war sie – verschlossen, – hatte Kreyenblut in den Adern; und noch als sie eine Göhre war und zu Schule ging zu Pastor Lorenzen, sprach sie selten ein Wort und spielte nie mit den andern Göhren. –
Hatte klein harte Fäuste und rotes Haar, – die lüttje Deern. –
»Ich tanze nich mit dich«, hatte sie zu ihrem Bräutigam gesagt, »im Tanze liegt etwas Sündhaftes in«, und hatte sich wech von ihm gebogen.
Denn hatte sie noch ein »Rundstück warm« mit Tunke gegessen und war allein hinausgefahren mit ihren Pferden über die dämmerfrische Heide. –
»Weshalb ich ihn nur nicht liebe«, wiederholte sie sich immer wieder beim Fahren.
Denn hielt sie plötzlich an. – Ein Junge badete dort, nackend, ganz nackend. – Sie sah sich ihn lange an, und er bemerkte es nicht. – Da fühlte sie, wie etwas in ihre keusche Seele drang: – – daß alles in der Natur zur Liebe geschaffen war. –
Jetzt wußte sie es, sie hatte es deutlich gesehen. – Jetzt wußte sie auch, daß sie Jörn liebe, aus ganzer Seele liebe.
Keusch natürlich.
Da war Jörn leise an ihren Wagen getreten – er war ihr nachgegangen – und hinten aufgesessen. – »Was kiekst du so?« hatte er gesagt. –
Der Knabe aber verstach sich.
Ihr war ganz fladderig geworden. – »Mien Uhl«, hatte sie gesagt. Dann waren sie zu zweit weiter gefahren. –
So kam es, daß Großvater Uhl eine Krey zum Weibe nahm.
Wir hatten Jörn verlassen, als er Buchweizengrütze mit Schüh aß und ein Buch vorgenommen hatte. –
Es war: »Fietze Faatz, der Mettenkönig« von Pastor Thietgen und hatte eine Auflage, – sooo groß! –
In Hamburch las es jeder, es hieß sogar, daß es demnächst aus dem Frenssenschen ins Deutsche übersetzt werden sollte. Jörn Uhl las und las.
Es handelte davon, wie Fietze Faatz noch drei Jahre alt war, ein kleinen Buttje, – wie er immerzu lernen wollte – immerzu! – –, und mit Nestküken, seinem Schwesterlein, die ein klein niedliches Göhr war, in der Twiete spielte und im Fleet Sticklegrintjes fing. –
Wie er denn nach Schule sollte und nich lateinisch konnte. Wie Senator Stühlkens lütt Jettchen im Grünen Koppeister schloß und sie von einem Quittje und einer lüderlichen Deern das Lied lernten:
»Op de Brüch, do steit
en ohlen Kerl un fleit,
un Mareiken Popp
grölt jem dol
dat Signol:
Du kumm man eben ropp«,
und wie der Vater da so böse über war. –
Jörn Uhl las und las: – daß Fietze Faatz 10 Jahre wurde, und 10 1/2, und 10 3/4, und 11 Jahre und Jettchen Stühlken immer Schritt mit ihm im Alter hielt und keines das andere darin überflügeln konnte, – das Fietze Faatz von Tag zu Tag ernster zusah, wenn Jettchen Koppeister schoß, bis sie endlich längere Kleider erhielt.
Jörn Uhl las die ganze Nacht, – – und Fietze Fatz war erst 11 1/2 Jahre alt, – las den nächsten Tag und die kommende Nacht: – Da war Fietze Fatz allerdings schon 16 Jahre, aber Jörn hatte erst ein Drittel des Buches gelesen und fiel vor Schwäche vom Stuhl. – –
Wegen des Gepolters kam das Gesinde nach oben, – früher hatten sie es nicht gewagt – er war ein Uhl! –
Voran Fiete Krey, der Grossknecht. – Wie der Jörn sah, scheuerte er sich hinter den Ohren und entsetzte sich: hatte der mit eins einen langen grauen Bart bekommen und war selber beim Lesen sechzehn Jahre älter geworden.
»Junge, – Minsch«, – sagte Krey, – »kuck dich nu man eben im Spiegel.«
»Dat kumt von die verdammten Bücher«, setzte er halblaut hinzu
Lisbeth Sootje aber mochte Jörn nu mit eins gar nicht mehr leiden; – – – und so blieb es.
Tja.


Der Pfarrer hatte sich so herzlich auf die Heimkehr seines Bruders Martin aus dem Süden gefreut, und als dieser endlich eintrat in die altertümliche Stube, eine Stunde früher, als man erwartet hatte, da war alle Freude verschwunden. Woran es lag, konnte er nicht begreifen, er empfand es nur, wie man einen Novembertag empfindet, an dem die Welt zu Asche zu zerfallen droht.
Auch Ursula, die Alte, brachte anfangs keinen Laut hervor. Martin war braun wie ein Ägypter und lächelte freundlich, als er dem Pfarrer die Hände schüttelte.
Er bleibe gewiß zum Abendessen zu Hause und sei gar nicht müde, sagte er. Die nächsten paar Tage müsse er zwar in die Hauptstadt, dann aber wolle er den ganzen Sommer daheim sein.
Sie sprachen von ihrer Jugendzeit, als der Vater noch lebte, – und der Pfarrer sah, daß Martins seltsamer melancholischer Zug sich noch verstärkt hatte.
»Glaubst du nicht auch, daß gewisse überraschende, einschneidende Ereignisse bloß deshalb eintreten müssen, weil man eine innere Furcht vor ihnen nicht unterdrücken kann?« waren Martins letzte Worte vor dem Schlafengehen gewesen. »Und weißt du noch, welch grauenhaftes Entsetzen mich schon als kleines Kind befiel, als ich einmal in der Küche ein blutiges Kalbshirn sah ...«
Der Pfarrer konnte nicht schlafen, es lag wie ein erstickender, spukhafter Nebel in dem früher so gemütlichen Zimmer.
Das Neue, das Ungewohnte, – dachte der Pfarrer.
Aber es war nicht das Neue, das Ungewohnte, es war ein anderes, das sein Bruder hereingebracht hatte.
Die Möbel sahen nicht so aus wie sonst, die alten Bilder hingen, als ob sie von unsichtbaren Kräften an die Wände gepreßt würden. Man hatte das bange Ahnen, daß das bloße Ausdenken irgendeines fremden, rätselhaften Gedankens eine ruckweise, unerhörte Veränderung hervorbringen müsse. – Nur nichts Neues denken, – bleibe beim Alten, Alltäglichen, warnt das Innere. Gedanken sind gefährlich wie Blitze!
Martins Abenteuer nach der Schlacht bei Omdurman ging dem Pfarrer nicht aus dem Sinn: wie er in die Hände der Obeahneger gefallen war, die ihn an einen Baum banden – – – – – Der Obizauberer kommt aus seiner Hütte, kniet vor ihm hin und legt noch ein blutiges Menschengehirn auf die Trommel, die eine Sklavin hält.
Jetzt sticht er mit einer langen Nadel in verschiedene Partien dieses Gehirns, und Martin schreit jedesmal wild auf, weil er den Stich im eigenen Kopf fühlt.
Was hat das zu bedeuten?!
Der Herr erbarme sich seiner! ...
Gelähmt an allen Gliedern wurde Martin damals von englischen Soldaten ins Feldspital gebracht.
Eines Tages fand der Pfarrer seinen Bruder bewußtlos zu Hause vor.
Der Metzger mit seiner Fleischmulde sei gerade eingetreten, berichtete die alte Ursula, da plötzlich sei Herr Martin ohne Grund ohnmächtig geworden.
»Das geht so nicht weiter, du mußt in die Nervenheilanstalt des Professors Diokletian Büffelklein; der Mann genießt einen Weltruf«, hatte der Pfarrer zu seinem Bruder gesagt, als dieser wieder zu sich gekommen war, und Martin willigte ein. –
»Sie sind Herr Schleiden? Ihr Bruder, der Pfarrer, hat mir bereits von Ihnen berichtet. Nehmen Sie Platz und erzählen Sie in kurzen Worten«, sagte Professor Büffelklein, als Martin das Sprechzimmer betrat.
Martin setzte sich und begann:
»Drei Monate nach dem Ereignis bei Omdurman – Sie wissen – waren die letzten Lähmungserscheinungen ...«
»Zeigen Sie mir die Zunge – hm, keine Abweichung, mäßiger Tremor«, unterbrach der Professor. »Warum erzählen Sie denn nicht weiter?« – – –
»... waren die letzten Lähmungserscheinugen –« setzte Martin fort.
»Schlagen Sie ein Bein über das andere. So. Noch mehr, so –« befahl der Gelehrte und klopfte sodann mit einem kleinen Stahlhammer auf die Stelle unterhalb der Kniescheibe des Patienten. Sofort fuhr das Bein in die Höhe.
»Erhöhte Reflexe«, sagte der Professor. – »Haben Sie immer erhöhte Reflexe gehabt?«
»Ich weiß nicht; ich habe mir nie aufs Knie geklopft«, entschuldigte sich Martin.
»Schließen Sie ein Auge. Jetzt das andere. Öffnen Sie das linke, so – jetzt rechts – gut – Lichtreflexe in Ordnung. War der Lichtreflex bei Ihnen stets in Ordnung, besonders in letzter Zeit, Herr Schleiden?«
Martin schwieg resigniert.
»Auf solche Zeichen hätten Sie eben achten müssen«, bemerkte der Professor mit leichtem Vorwurf und hieß den Kranken sich entkleiden.
Eine lange, genaue Untersuchung fand statt, während welcher der Arzt alle Kennzeichen tiefsten Denkens offenbarte und dazu lateinische Worte murmelte.
»Sie sagten doch vorhin, daß Sie Lähmungserscheinungen hätten, ich finde aber keine«, sagte er plötzlich.
»Nein, ich wollte doch sagen, daß Sie nach drei Monaten verschwunden seien«, entgegnete Martin Schleiden.
»Sind Sie denn schon so lange krank, mein Herr?«
Martin machte ein verblüfftes Gesicht.
»Es ist eine merkwürdige Erscheinung, daß sich fast alle deutschen Patienten so unklar ausdrücken«, meinte freundlich lächelnd der Professor; »da sollten Sie einmal einer Untersuchung auf einer französischen Klinik beiwohnen. Wie prägnant sich da selbst der einfache Mann ausdrückt. Übrigens hat es nicht viel auf sich mit Ihrer Krankheit. Neurasthenie, weiter nichts. – Es wird Sie wohl gewiß auch interessieren, daß es uns Ärzten – gerade in allerletzter Zeit – gelungen ist, diesen Nervensachen auf den Grund zu kommen. Ja, das ist der Segen der modernen Forschungsmethode, heute ganz genau zu wissen, daß wir füglich gar keine Mittel – Arzneien – anwenden können. – Zielbewußt das Krankheitsbild im Auge behalten! Tag für Tag! Sie würden staunen, was wir damit erzielen können. Sie verstehen! – Und dann die Hauptsache: Vermeiden Sie jede Anstrengung, das ist Gift für Sie – und jeden zweiten Tag melden Sie sich bei mir zur Visite. – Also nochmals: keine Aufregung!«
Der Professor schüttelte dem Kranken die Hand und schien infolge der geistigen Anstrengung sichtlich erschöpft.
Das Sanatorium, ein massiver Steinbau, bildete das Eck einer sauberen Straße, die das unbelebteste Stadtviertel schnitt.
Gegenüber zog sich das alte Palais der Gräfin Zahradka hin, dessen stets verhängte Fenster den krankhaft ruhigen Eindruck der leblosen Straße verstärkte.
Fast nie ging jemand vorbei, denn der Eingang in das vielbesuchte Sanatorium lag auf der anderen Seite bei den Ziergärten, neben den beiden alten Kastanienbäumen.
Martin Schleiden liebte die Einsamkeit, und der Garten mit seinen Teppichpflanzen, seinen Rollstühlen und launischen Kranken, mit dem langweiligen Springbrunnen und den dummen Glaskugeln war ihm verleidet.
Ihn zog die stille Straße an und das alte Palais mit den dunklen Fenstergittern. Wie mochte es drinnen aussehen?
Alte verblichene Gobelins, verschossene Möbel, umwickelte Glaslüster. Eine Greisin mit buschigen weißen Augenbrauen und herben, harten Zügen, die der Tod und das Leben vergessen hatte. –
Tag für Tag schritt Martin Schleiden das Palais entlang. – In solchen öden Straßen muß man dicht an den Häusern gehen. –
Martin Schleiden hatte den ruhigen, eigentümlichen Schritt der Menschen, die lange in den Tropen gelebt haben. Er störte den Eindruck der Straße nicht; sie paßten so zueinander, diese weltfremden Daseinsformen.
Drei heiße Tage waren gekommen, und jedesmal begegnete er auf seinem einsamen Weg einem Alten, der stets eine Gipsbüste trug.
Eine Gipsbüste mit einem Bürgergesicht, das sich niemand merken konnte. –
Diesesmal waren sie zusammengestoßen – der Alte war so ungeschickt.
Die Büste neigte sich und fiel langsam zu Boden. – Alles fällt langsam, nur wissen es die Menschen nicht, die keine Zeit haben zur Beobachtung. –
Der Gipskopf zerbrach, und aus den weißen Scherben quoll ein blutiges Menschengehirn. –
Martin Schleiden blickte starr hin, streckte sich und wurde fahl. Dann breitete er die Arme aus und schlug die Hände vors Gesicht.
Mit einem Seufzer stürzte er zu Boden. – –
Der Professor und die beiden Assistenzärzte hatten den Vorgang von den Fenstern zufällig mit angesehen.
Der Kranke lag jetzt im Untersuchungszimmer. Er war gänzlich gelähmt und ohne Bewußtsein.
Eine halbe Stunde später war der Tod eingetreten. –
Ein Telegramm hatte den Pfarrer ins Sanatorium berufen, der jetzt weinend vor dem Mann der Wissenschaft stand.
»Wie ist das nur alles so rasch gekommen, Herr Professor?« –
»Es war vorauszusehen, lieber Pfarrer«, sagte der Gelehrte. »Wir hielten uns streng an die Erfahrungen, die wir Ärzte im Laufe der Jahre in der Heilmethode gemacht haben, aber wenn der Patient selber nicht befolgt, was man ihm vorschreibt, so ist eben jede ärztliche Kunst verloren.«
»Wer war denn der Mann mit der Gipsbüste?« unterbrach der Pfarrer.
»Da fragen Sie mich nach Nebenumständen, zu deren Beobachtung mir Zeit und Muße fehlt – lassen Sie mich fortfahren:
Hier in diesem Zimmer habe ich wiederholte Male Ihrem Bruder auf das ausdrücklichste die Enthaltung von jeglicher Art Aufregung verordnet. – Ärztlich verordnet! Wer nicht folgte, war Ihr Bruder. Es erschüttert mich selbst tief, lieber Freund, aber Sie werden mir recht geben: Strikte Befolgung der ärztlichen Vorschrift ist und bleibt die Hauptsache. Ich selbst war Augenzeuge des Unglücksfalles:
Schlägt der Mann in höchster Aufregung die Hände vor den Kopf, wankt, taumelt und stürzt zu Boden. Da war jede Hilfe zu spät. – Ich kann Ihnen schon heute das Ergebnis der Obduktion voraussagen: Hochgradige Blutleere des Gehirnes, infolge diffuser Sklerosierung der grauen Hirnrinde. Und jetzt beruhigen Sie sich, lieber Mann, beherzigen Sie den Satz und lernen Sie daraus: Wie man sich bettet, so liegt man. –
Es klingt hart, aber Sie wissen, die Wahrheit will starke Jünger haben.«


23. September
So. – Jetzt bin ich fertig mit meinem System und sicher, daß kein Furchtgefühl in mir entstehen kann.
Die Geheimschrift kann niemand entziffern. Es ist doch gut, wenn man alles vorher genau überlegt und in möglichst vielen Gebieten auf der Höhe des Wissens steht. Dies soll ein Tagebuch für mich sein; kein anderer als ich ist es zu lesen imstande, und ich kann jetzt gefahrlos niederschreiben, was ich zu meiner Selbstbeobachtung für nötig halte. – Verstecken allein genügt nicht, der Zufall bringt es an den Tag. –
Gerade die heimlichsten Verstecke sind die unsichersten. – Wie verkehrt alles ist, was man in der Kindheit lernt! – Ich aber habe mit den Jahren zu lernen verstanden, wie man den Dingen ins Innere sieht, und ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe, damit auch nicht eine Spur von Furcht in mir erwachen kann.
Die einen sagen, es gibt ein Gewissen, die anderen leugnen es; das ist dann beiden ein Problem und ein Anstoß zum Streit. Und wie einfach doch die Wahrheit ist: Es gibt ein Gewissen und es gibt keines, je nachdem man daran glaubt. Wenn ich an ein Gewissen in mir glaube, suggeriere ich es mir. Ganz natürlich.
Seltsam ist dabei nur, daß, wenn ich an ein Gewissen glaube, es dadurch nicht nur entsteht, sondern auch sich ganz selbständig meinem Wunsche und Willen entgegenzustellen vermag.
»Entgegen« stellen! – Sonderbar! – Es stellt sich also das Ich, das ich mir einbilde, dem Ich gegenüber, mit dem ich es mir selbst geschaffen habe, und spielt dann eine recht unabhängige Rolle.
Eigentlich scheint es aber auch in andern Dingen so zu sein. Z. B. schlägt manchmal mein Herz schneller, wenn man von dem Morde spricht, und ich stehe dabei und bin doch sicher, daß sie mir nie auf die Spur kommen können. Ich erschrecke nicht im geringsten in solchen Fällen, – ich weiß es ganz genau, denn ich beobachte mich zu scharf, als daß es mir entgehen könnte; und doch fühle ich mein Herz schneller schlagen.
Die Idee mit dem Gewissen ist wirklich das Teuflischste, was je ein Priester erdacht hat. –
Wer wohl der erste war, der diesen Gedanken in die Welt brachte! – Ein Schuldiger? Kaum! Und ein Schuldloser? Ein sogenannter Gerechter? Wie hätte der sich so in die Folgen einer solchen Idee hineindenken können?! –
Es kann nur so sein, daß irgend ein Alter es Kindern als Schreckgespenst dargestellt hat. Mit dem Instinkt der drohenden Wehrlosigkeit des Alters gegenüber der keimenden brutalen Kraft der Jugend. –
Ich kann mich ganz gut erinnern, wie ich noch als großer Junge für möglich gehalten hätte, daß sich die Schemen der Erschlagenen an die Fersen des Mörders heften und ihm in Visionen erscheinen. –
Mörder! – Wie listig schon wieder das Wort gewählt und gebaut ist. – Mörder! Es liegt ordentlich etwas Röchelndes drin. –
Ich denke, der Buchstabe »Ö« ist die Wurzel, aus der das Entsetzliche aus-klingt. – –
Wie einen die Menschen mit Suggestionen schlau umstellt haben!
Aber ich weiß schon, wie ich solche Gefahren entwerte. Tausendmal habe ich mir dieses Wort an jenem Abend vorgesagt, bis es die Schrecklichkeit für mich verloren hat. – Jetzt ist es mir ein Wort wie jedes andere. – –
– – Ich kann mir ganz gut vorstellen, daß einen ungebildeten Mörder die Wahnideen, von den Toten verfolgt zu werden, in den Irrsinn hetzen, aber nur den, der nicht überlegt, nicht wägt, nicht vorausdenkt. – Wer ist denn heutzutage gewöhnt, in brechende Augen voll Todesangst kaltblütig hineinzuschauen, ohne ein inneres Leck davonzutragen, oder in gurgelnde Kehlen den Fluch zurückzudrosseln, vor dem man sich heimlich doch fürchtet. – Kein Wunder, daß so ein Bild lebendig werden kann und dann eine Art Gewissen erzeugt, dem man schließlich erliegt. –
Wenn ich über mich nachdenke, muß ich bekennen, daß ich eigentlich geradezu genial vorgegangen bin:
Zwei Menschen kurz hintereinander zu vergiften und dabei alle Spuren des Verdachtes zu verwischen, ist wohl schon Dümmeren, als ich bin, geglückt; aber die Schuld, das eigene Schuldgefühl zu ersticken, noch ehe es geboren, das – – – Ich glaube wirklich, ich bin der einzige – – –
Ja, wenn einer das Unglück hätte, allwissend zu sein, für den gäbe es schwerlich einen inneren Schutz: – so aber habe ich wohlweislich meine eigene Unwissenheit benützt und klug ein Gift gewählt, das eine Todesart erzeugt, deren Verlauf mir gänzlich unbekannt ist und auch bleiben soll: Morphium, Strychnin, Cyankali; – alle ihre Wirkungen kenne ich oder könnte ich mir vorstellen: Verrenkungen, Krämpfe, blitzartiges Niederstürzen, Schaum vor dem Mund. – Aber Curarin! – Ich habe keine Ahnung, wie bei diesem Gift der Todeskampf aussehen mag, und wie sollte sich da eine Vorstellung in mir bilden können?! Darüber nachzulesen werde ich mich natürlich hüten, und zufällig oder unfreiwillig etwas darüber mit anhören zu müssen, ist ausgeschlossen. – Wer kennt denn heute überhaupt den Namen Curarin?!
Also! – Wenn ich mir nicht einmal ein Bild von den letzten Minuten meiner beiden Opfer (welch albernes Wort) machen kann, wie könnte mich ein solches je verfolgen? – Und sollte ich dennoch davon träumen, so kann ich mir beim Erwachen die Unhaltbarkeit einer solchen Suggestion direkt beweisen. Und welche Suggestion wäre stärker als ein solcher Beweis!
26. September
Merkwürdig, gerade heute nachts träumte ich, daß die beiden Toten links und rechts hinter mir hergehen. – Vielleicht, weil ich gestern die Idee vom Träumen niedergeschrieben habe!? –
Da gibt es jetzt nur zwei Wege, um solchen Traumbildern den Eintritt zu verrammeln:
Entweder fortwährend sie sich innerlich vorzuhalten, um sich daran zu gewöhnen, wie ich es mit dem dummen Wort »Mörder« mache, oder zweitens diese Erinnerung ganz auszureißen aus dem Gedächtnisse. –
Das erstere? – Hm. – – Das Traumbild war zu scheußlich! – – Ich wähle den zweiten Weg. –
Also: »Ich will nicht mehr daran denken! Ich will nicht! Ich will nicht, nicht, nicht mehr daran denken! – Hörst Du! – Du sollst gar nicht mehr daran denken! –«
Eigentlich ist diese Form: »Du sollst nicht usw.« recht unüberlegt, wie ich jetzt bemerke, man soll sich nicht mit »Du« anreden, – dadurch zerlegt man sozusagen sein Ich in zwei Teile: in ein Ich und ein Du, und das könnte mit der Zeit verhängnisvolle Wirkungen haben! –
5. Oktober
Wenn ich das Wesen der Suggestion nicht so genau studiert hätte, könnte ich wirklich recht nervös werden: Heute war es die achte Nacht, daß ich jedesmal von demselben Bilde geträumt habe. – Immer die Zwei hinter mir her, auf Schritt und Tritt. – – Ich werde heute abends unter die Leute gehen und etwas mehr als sonst trinken. –
Am liebsten ginge ich ins Theater, – aber natürlich: gerade heute ist »Macbeth«.
7. Oktober
Man lernt doch nie aus. – Jetzt weiß ich, warum ich so hartnäckig davon träumen mußte. – Paracelsus sagt ausdrücklich, daß man, um beständig lebhaft zu träumen, nichts anderes zu tun brauche, als ein- oder zweimal seine Träume niederzuschreiben. Das werde ich nächstens gründlich bleiben lassen. Ob das so ein moderner Gelehrter wüßte. Aber auf den Paracelsus schimpfen, das können sie.
13. Oktober
Ich muß mir heute genau aufschreiben, was passiert ist, damit nicht in meiner Erinnerung etwa Dinge dazuwachsen, die gar nicht geschehen sind. – –
Seit einiger Zeit hatte ich das Gefühl – die Träume bin ich Gott sei dank los –, als ob stets jemand links hinter mir ginge. –
Ich hätte mich natürlich umdrehen können, um mich von der Sinnestäuschung zu überzeugen, das wäre aber ein großer Fehler gewesen, denn schon dadurch hätte ich mir selbst gegenüber heimlich zugegeben, daß die Möglichkeit von etwas Wirklichem überhaupt vorhanden sein könne. – Das hielt so einige Tage an. – Ich blieb gespannt auf meiner Hut. –
Wie ich nun heute früh an meinen Frühstückstisch trete, habe ich wieder dieses lästige Gefühl, und plötzlich höre ich ein knirschendes Geräusch hinter mir. – Ehe ich mich fassen konnte, hatte mich der Schrecken übermannt, und ich war herumgefahren. – Einen Augenblick sah ich ganz deutlich mit wachen Augen den toten Richard Erben, grau in grau, – dann huschte das Phantom blitzschnell wieder hinter mich, – aber doch nicht mehr so weit, daß ich es nur wie vorher bloß ahnen kann. – Wenn ich mich ganz grad richte und die Augen stark nach links wende, kann ich seine Konturen sehen, so wie im Augenschimmer; – drehe ich aber den Kopf, so weicht die Gestalt im selben Maß zurück. –
Es ist mir ja ganz klar, daß das Geräusch nur von der alten Aufwärterin verursacht sein konnte, die keinen Augenblick still ist und sich immer an den Türen herumdrückt.
Sie darf mir von jetzt ab nur mehr in die Wohnung, wenn ich nicht zu Haus bin. Ich will überhaupt keinen Menschen mehr in die Nähe haben. –
Wie mir das Haar zu Berge stand! – Ich denke mir, daß das davon kommt, daß sich einem die Kopfhaut zusammenzieht.
Und das Phantom? Die erste Empfindung war ein Nachwehen aus den früheren Träumen, – ganz einfach; und das Sichtbarwerden entstand ruckweise durch den plötzlichen Schrecken. – Schrecken, – Furcht, Haß, Liebe sind lauter Kräfte, die das Ich zerteilen und daher die eigenen, sonst ganz unbewußten Gedanken sichtbar machen können, daß sie sich im Wahrnehmungsvermögen wie in einem Reflektor spiegeln. –
Ich darf jetzt längere Zeit gar nicht unter Leute gehen und muß mich scharf beobachten, denn das geht so nicht mehr weiter. –
Unangenehm ist, daß das gerade auf den dreizehnten des Monats fallen muß. – Ich hätte wirklich gegen das alberne Vorurteil mit dem dreizehnten, das eben auch in mir zu stecken scheint, von allem Anfang an energisch kämpfen sollen. – Übrigens, was liegt an diesem unwichtigen Umstand.
20. Oktober
Am liebsten hätte ich meine Koffer gepackt und wäre in eine andere Stadt gefahren. –
Schon wieder hat sich die Alte an der Tür zu schaffen gemacht. –
Wieder dieses Geräusch, – diesmal rechts hinter mir. – Derselbe Vorgang wie neulich. – Jetzt sehe ich rechts meinen vergifteten Onkel, und wenn ich das Kinn auf die Brust drücke, so quasi auf meine Schultern schiele, – alle beide links und rechts. – Die Beine kann ich nicht sehen. Es scheint mir übrigens, als ob die Gestalt des Richard Erben jetzt mehr hervorgetreten, näher zu mir gekommen wäre. Die Alte muß mir aus dem Hause, – das wird mir immer verdächtiger, – aber ich werde noch einige Wochen ein freundliches Gesicht machen, – damit sie nicht Mißtrauen schöpft. –
Auch das Übersiedeln muß ich noch hinausschieben, es würde den Leuten auffallen, und man kann nicht vorsichtig genug sein. –
Morgen will ich wieder das Wort »Mörder« ein paar Stunden lang üben – es fängt an, unangenehm auf mich zu wirken –, um mich wieder an den Klang zu gewöhnen. – – Eine merkwürdige Entdeckung habe ich heute gemacht; ich habe mich im Spiegel beobachtet und gesehen, daß ich beim Gehen mehr mit dem Ballen auftrete als früher und daher ein leichtes Schwanken spüre. – Die Redensart vom »festen Auftreten« scheint einen tiefen, inneren Sinn zu haben, wie überhaupt in den Worten ein psychologisches Geheimnis zu stecken scheint. – Ich werde darauf achten, daß ich wieder mehr auf den Fersen gehe. –
Gott, wenn ich nur nicht immer über Nacht die Hälfte von dem vergäße, was ich mir tagsüber vornehme. – Rein, als ob der Schlaf alles verwischte.
1. November
Letztesmal habe ich doch absichtlich nichts über das zweite Phantom niedergeschrieben, und doch verschwindet es nicht. – Gräßlich, gräßlich. – Gibt es denn keinen Widerstand? –
Ich habe doch einmal ganz klar unterschieden, daß es zwei Wege gibt, um mich aus der Sphäre solcher Bilder zu rücken. – Ich habe doch den zweiten eingeschlagen und bin dabei immerwährend auf dem ersten! –
War ich denn damals sinnesverwirrt? –
Sind die beiden Gestalten Spaltungen meines Ichs oder haben sie ihr eigenes unabhängiges Leben?
– – – Nein, nein! – Dann würde ich sie ja füttern mit meinem eigenen Leben! Also sind es doch wirkliche Wesen! – Grauenhaft! – Aber nein, ich betrachte sie doch nur als selbständige Wesen, und was man als Wirklichkeit betrachtet, das ist – das ist – – – Herrgott, barmherziger, ich schreibe ja nicht, wie man sonst schreibt. – Ich schreibe ja, als ob mir jemand diktieren würde. – – – Das muß von der Geheimschrift kommen, die ich immer erst übersetzen muß, ehe ich sie fließend lesen kann. –
Morgen schreibe ich das ganze Buch noch einmal kurrent ab. – Herrgott, steh mir bei in dieser langen Nacht.
10. November
Es sind wirkliche Wesen, sie haben mir im Traum ihren Todeskampf erzählt. – Jesus schütze mich, – ja – Jesus, Jesus! – Sie wollen mich erdrosseln! – Ich habe nachgelesen; – es war die Wahrheit, – Curarin wirkt so, genau so. – Woher wüßten sie es, wenn sie nur Scheinwesen wären – – –
Gott im Himmel, – warum hast du mir nie gesagt, daß man nach dem Tode weiterlebt, – ich hätte ja nicht gemordet.
Warum hast du dich mir nicht als Kind geoffenbart?
– – – Ich schreibe schon wieder so, wie man spricht; und ich will nicht.
12. November
Ich sehe wieder klar, jetzt, wo ich das ganze Buch abgeschrieben habe. – Ich bin krank. Da hilft nur kalter Mut und klares Wissen.
Für morgen früh habe ich mir den Dr. Wetterstrand bestellt, der muß mir genau sagen, wo der Fehler lag. – Ich werde ihm alles haarklein berichten, er wird mir ruhig zuhören und das über Suggestion verraten, was ich noch nicht weiß. –
Er kann im ersten Augenblick unmöglich für wahr halten, daß ich wirklich gemordet habe, – er wird glauben, ich sei bloß wahnsinnig. –
Und daß er es sich zu Hause nicht mehr überlegt, dafür werde ich sorgen: – – Ein Gläschen Wein!!!
13. November


»Mackintosh ist wieder hier, das Mistviech.«
Ein Lauffeuer ging durch die Stadt.
George Mackintosh, den Deutschamerikaner, der vor fünf Jahren allen adieu gesagt, hatte jeder noch gut im Gedächtnis, – seine Streiche konnte man gerade sowenig vergessen wie das scharfe, dunkle Gesicht, das heute wieder auf dem »Graben« aufgetaucht war. –
Was will denn der Mensch schon wieder hier?
Langsam, aber sicher war er damals weggeekelt worden; – alle hatten daran mitgearbeitet, – der mit der Miene der Freundschaft, jener mit Tücke und falschen Gerüchten, aber jeder mit einem Quentchen vorsichtiger Verleumdung – und alle diese kleinen Niederträchtigkeiten ergaben schließlich zusammen eine so große Gemeinheit, daß sie jeden anderen Mann wahrscheinlich zerquetscht hätte, den Amerikaner aber nur zu einer Abreise bewog. – – –
Mackintosh hatte ein Gesicht, scharf wie ein Papiermesser, und sehr lange Beine.
Das allein schon vertragen die Menschen schlecht, die die Rassentheorie so gerne mißachten.
Er war schrecklich verhaßt, und anstatt diesen Haß zu verringern, indem er sich landläufigen Ideen angepaßt hätte, stand er stets abseits der Menge und kam alle Augenblicke mit etwas neuem: – Hypnose, Spiritismus, Handlesekunst, ja eines Tages sogar mit einer symbolischen Erklärung des Hamlet. – Das mußte natürlich die guten Bürger aufbringen und ganz besonders keimende Genies, wie z. B. den Herrn Tewinger vom Tageblatt, der soeben ein Buch unter dem Titel »Wie ich über Shakespeare denke« herausgeben wollte.
Und dieser »Dorn im Auge« war wieder hier und wohnte mit seiner indischen Dienerschaft in der »roten Sonne«.
»Wohl nur vorübergehend?« forschte ihn ein alter Bekannter aus.
»Natürlich: vorübergehend, denn ich kann mein Haus ja erst am 15. August beziehen. – Ich habe mir nämlich ein Haus in der Ferdinand-Straße gekauft.« –
Das Gesicht der Stadt wurde um einige Zoll länger: – Ein Haus in der Ferdinand-Straße! – Woher hat dieser Abenteurer das Geld?! –
Und noch dazu eine indische Dienerschaft. – Na, werden ja sehen, wie lange er machen wird!
Mackintosch hatte natürlich schon wieder etwas Neues: Eine elektrische Maschinerie, mit der man Goldadern in der Erde sozusagen wittern könne, – eine Art moderner wissenschaftlicher Wünschelrute. –
Die meisten glaubten es selbstverständlich nicht: »Wenn es gut wäre, hätten das doch schon andere erfunden!«
Nicht wegzuleugnen war aber, daß der Amerikaner während der fünf Jahre ungeheuer reich geworden sein mußte. Wenigstens behauptete dies das Auskunftsbureau der Firma Schnufflers Eidam steif und fest.
– – – Und richtig, es verging auch keine Woche, daß er nicht ein neues Haus gekauft hätte. –
Ganz planlos durcheinander; eines auf dem Obstmarkt, dann wieder eines in der Herrengasse, – aber alle in der inneren Stadt. –
Um Gottes willen, will er es vielleicht bis zum Bürgermeister bringen?
Kein Mensch konnte daraus klug werden. –
»Haben Sie schon seine Visitenkarte gesehen? Da schauen Sie her, das ist denn doch schon die höchste Frechheit, – bloß ein Monogramm, – gar kein Name! – Er sagt, er brauche nicht mehr zu heißen, er hätte Geld genug!«
Mackintosh war nach Wien gefahren und verkehrte dort, wie das Gerücht ging, mit einer Reihe Abgeordneten, die täglich um ihn waren.
Was er mit ihnen gar so wichtig tat, konnte man nicht und nicht herausbekommen, aber offenbar hatte er seine Hand bei dem neuen Gesetzentwurf über die Umänderung der Schürfrechte im Spiele.
Täglich stand etwas in den Zeitungen, – Debatten für und wider, – und es sah ganz danach aus, als ob das Gesetz, daß man hinfort – natürlich nur außer gewöhnlichen Vorkommnissen – auch mitten in den Städten Freischürfe errichten dürfe, recht bald angenommen werden würde.
Die Geschichte sah merkwürdig aus, und die allgemeine Meinung lautete, daß wohl irgend eine große Kohlengewerkschaft dahinter stecken müsse.
Mackintosh allein hatte doch gewiß kein so starkes Interesse daran, – wahrscheinlich war er nur von irgend einer Gruppe vorgeschoben.
Er reiste übrigens bald nach Hause zurück und schien ganz vortrefflicher Laune. So freundlich hatte man ihn noch nie gesehen. »Es geht ihm aber auch gut, – erst gestern hat er sich wieder eine ›Realität‹ gekauft, – es ist jetzt die dreizehnte«, – erzählte beim Beamtentische im Kasino der Herr Oberkontrollor vom Grundbuchamt. – »Sie kennen's ja: das Eckhaus ›zur angezweifelten Jungfrau‹ schräg vis-à-vis von den ›drei eisernen Trotteln‹, wo jetzt die städtische Befundhauptkommission für die Inundations-Bezirkswasserbeschau drin ist.«
»Der Mann wird sich noch verspekulieren und so«, meinte da der Herr Baurat, – »wissen Sie, um was er jetzt wieder angesucht hat, meine Herren? – Drei von seinen Häusern will er einreißen lassen, das in der Perlgasse – das vierte rechts neben dem Pulverturm – und das Numero conscriptionis 47184/II. – Die neuen Baupläne sind schon bewilligt!« –
Alles sperrte den Mund auf.
Durch die Straßen jagte der Herbstwind, – die Natur atmete tief auf, ehe sie schlafen geht.
Der Himmel ist so blau und kalt, und die Wolken so backig und stimmungsvoll, als hätte sie der liebe Gott eigens vom Meister Wilhelm Schulz malen lassen.
Oh, wie wäre die Stadt so schön und rein, wenn der ekelhafte Amerikaner mit seiner Zerstörungswut nicht die klare Luft mit dem feinen Mauerstaub so vergiftet hätte. – – Das aber auch so etwas bewilligt wird!
Drei Häuser einreißen, na gut, – aber alle dreizehn gleichzeitig, da hört sich denn doch alles auf.
Jeder Mensch muß ja schon husten, und wie weh das tut, wenn einem das verdammte Ziegelpulver in die Augen kommt.
»Das wird ein schön verrücktes Zeug werden, was er uns dafür aufbauen wird. – ›Sezession‹ natürlich, – ich möchte darauf wetten«, hieß es. –
»Sie müssen wirklich nicht recht gehört haben, Herr Schebor! – Was?! gar nichts will er dafür hinbauen? – Ist er denn irrsinnig geworden, – wozu hätte er denn dann die neuen Baupläne eingereicht?« –
– – – »Bloß damit ihm vorläufig die Bewilligung zum Einreißen der Häuser erteilt wird!« –
»Meine Herren, wissen Sie das Neueste schon«, der Schloßbauaspirant Vyskotschil war ganz außer Atem: »Gold in der Stadt, ja wohl, – Gold! Vielleicht grad' hirr zu unsrrn Fißen.«
Alles sah auf die Füße des Herrn von Vyskotschil, die flach wie Biskuits in den Lackstiefeln staken.
Der ganze »Graben« lief zusamen.
»Wer hat da was gesaagt von Gold!« rief der Herr Kommerzienrat Löwenstein.
»Mr. Mackintosh will goldhaltiges Gestein in dem Bodengrund seines niedergerissenen Hauses in der Perlgasse gefunden haben«, bestätigte ein Beamter des Bergbauamtes, »man hat sogar telegraphisch eine Kommission aus Wien berufen.«
Einige Tage später war George Mackintosh der gefeiertste Mann der Stadt. In allen Läden hingen Photographien von ihm, – mit dem kantigen Profil und dem höhnischen Zug um die schmalen Lippen.
Die Blätter brachten seine Lebensgeschichte, die Sportberichterstatter wußten plötzlich genau sein Gewicht, seinen Brust- und Bizepsumfang, ja sogar, wie viel Luft seine Lunge fasse.
Ihn zu interviewen war auch gar nicht schwer.
Er wohnte wieder im Hotel »Zur roten Sonne«, ließ jedermann vor, bot die wundervollsten Zigarren an und erzählte mit entzückender Liebenswürdigkeit, was ihn dazu geführt hatte, seine Häuser einzureißen und in den freigewordenen Baugründen nach Gold zu graben:
Mit seinem neuen Apparat, der durch Steigen und Fallen der elektrischen Spannung genau das Vorhandensein von Gold unter der Erde anzeige und der seinem eigenen Gehirn entsprungen sei, hätte er nachts nicht nur die Keller seiner Gebäude genau durchforscht, sondern auch die aller seiner Nachbarhäuser, in die er sich heimlich Zutritt zu verschaffen gewußt.
»Sehen Sie, da haben Sie auch die amtlichen Berichte des Bergbauamtes und das Gutachten des eminenten Sachverständigen Professor Senkrecht aus Wien, der übrigens ein alter guter Freund von mir ist.«
– – – Und richtig, da stand schwarz auf weiß, mit dem amtlichen Stempel beglaubigt, daß sich in sämtlichen dreizehn Bauplätzen, die der Amerikaner George Mackintosh käuflich erworben, Gold in der dem Sande beigemengten, bekannten Form gefunden habe, und zwar in einem Quotienten, der auf eine immense Menge Gold besonders in den unteren Schichten mit Sicherheit schließen lasse. Diese Art des Vorkommens sei bis jetzt nur in Amerika und Asien nachgewiesen worden, doch könne man der Ansicht des Mr. Mackintosh, daß es sich hier offenkundig um ein altes Flußbett der Vorzeit handle, ohne weiteres beipflichten. Eine genaue Rentabilität lasse sich ziffernmäßig natürlich nicht ausführen, aber daß hier ein Metallreichtum erster Stärke, ja vielleicht ein ganz beispielloses Lager verborgen liege, sei wohl außer Zweifel.
Besonders interessant war der Plan, den der Amerikaner von der mutmaßlichen Ausdehnung der Goldmine entworfen und der die vollste Anerkennung der sachverständigen Kommission gefunden hatte.
Da sah man deutlich, daß sich das ehemalige Flußbett von einem Haus des Amerikaners anfangend zu den übrigen in komplizierten Windungen gerade unter den Nachbarhäusern hinzog, um wieder bei einem Eckhause Mackintoshs in der Zeltnergasse in der Erde zu verschwinden. –
Die Beweisführung, daß es so und nicht anders sein konnte, war so einfach und klar, daß sie jedem, – selbst wenn er nicht an die Präzision der elektrischen Metallkonstatierungsmaschine glauben wollte – einleuchten mußte.
– – – War das ein Glück, daß das neue Schürfrecht bereits Gesetzeskraft erlangt hatte. –
Wie umsichtig und verschwiegen der Amerikaner aber auch alles vorgesehen hatte.
Die Hausherren, in deren Grund und Boden plötzlich solche Reichtümer staken, saßen aufgeblasen in den Cafés und waren des Lobes voll über ihren findigen Nachbarn, den man früher so grundlos und niederträchtig verleumdet hatte.
»Pfui über solche Ehrabschneider!«
Jeden Abend hielten die Herren lange Versammlungen und berieten sich mit dem Advokaten des engeren Komitees, was nunmehr geschehen solle.
»Ganz einfach! – Alles genau dem Mr. Mackintosh nachmachen«, meinte der, »neue ixbeliebige Baupläne überreichen, wie es das Gesetz verlangt, dann einreißen, einreißen, einreißen, damit man so rasch wie möglich auf den Grund kommt. – Anders geht es nicht, denn schon jetzt in den Kellern nachzugraben, ist nutzlos und übrigens nach § 47 a Unterabteilung Y gebrochen durch römisch XXIII unzulässig.«
– – – Und so geschah es. –
Der Vorschlag eines überklugen ausländischen Ingenieurs, sich erst zu überzeugen, ob nicht Mackintosh am Ende gar den Goldfund auf die Fundstellen heimlich habe hinschaffen lassen, um die Kommission zu täuschen, – wurde niedergelächelt.
Ein Gehämmer und Gekrach in den Straßen, das Fallen der Balken, das Rufen der Arbeiter und das Rasseln der Schuttwagen, dazu der verdammte Wind, der den Staub in dichten Wolken umherblies! Es war zum Verstandverlieren.
Die ganze Stadt hatte Augenentzündung, die Vorzimmer der Augenklinik platzten fast vor dem Andrang der Patienten, und eine neue Broschüre des Professors Wochenschreiber »über den befremdenden Einfluß moderner Bautätigkeit auf die menschliche Hornhaut« war binnen weniger Tage vergriffen.
Es wurde immer ärger.
Der Verkehr stockte. In dichter Menge belagerte das Volk die »Rote Sonne«, und jeder wollte den Amerikaner sprechen, ob er denn nicht glaube, daß sich auch unter andern Gebäuden als den im Plan bezeichneten – Gold finden müsse. Militärpatrouillen zogen umher, an allen Straßenecken klebten die Kundmachungen der Behörden, daß vor Eintreffen der Ministerialerlässe strengstens verboten sei, noch andere Häuser niederzureißen.
Die Polizei ging mit blanker Waffe vor: kaum daß es nützte.
Gräßliche Fälle von Geistesstörung wurden bekannt: In der Vorstadt war eine Witwe nachts und im Hemde auf das eigene Dach geklettert und hatte unter gellem Gekreisch die Dachziegel von den Balken ihres Hauses gerissen.
Junge Mütter irrten wie trunken umher, und arme verlassene Säuglinge vertrockneten in den einsamen Stuben.
Ein Dunst lag über der Stadt, – dunkel, als ob der Dämon Gold seine Fledermausflügel ausgebreitet hätte.
Endlich, endlich war der große Tag gekommen. Die früher so herrlichen Bauten waren verschwunden, wie aus dem Boden gerissen, und ein Heer von Bergknappen hatte die Maurer abgelöst.
Schaufel und Spitzhaue flogen.
Von Gold – – keine Spur! – Es mußte also wohl tiefer liegen, als man vermutet hatte.
– – – Da! – – ein seltsames riesengroßes Inserat in den Tagesblättern:
GEORGE MACKINTOSH AN SEINE TEUERN BEKANNTEN
UND DIE IHM SO LIEB GEWORDENE STADT!
Umstände zwingen mich, allen für immer Lebewohl zu sagen.
Ich schenke der Stadt hiermit den großen Fesselballon, den ihr heute nachmittags auf dem Josefsplatz das erstemal aufsteigen sehen und jederzeit zu meinem Gedächtnisse umsonst benutzen könnt. Jeden einzelnen der Herren nochmals zu besuchen, fiel mir schwer, darum lasse ich in der Stadt eine große Visitenkarte zurück.
»Also doch wahnsinnig!
›Visitenkarte in der Stadt zurücklassen!‹ Heller Unsinn!
Was soll denn das Ganze überhaupt heißen? Verstehen Sie das vielleicht?« – So rief man allenthalben.
»Befremdend ist nur, daß der Amerikaner vor acht Tagen seine sämtlichen Bauplätze heimlich verkauft hat!«
– Der Photograph Maloch war es, der endlich Licht in das Rätsel brachte; er hatte als ersten den Aufstieg mit dem angekündigten Fesselballon mitgemacht und die Verwüstungen der Stadt von der Vogelperspektive aufgenommen.
Jetzt hing das Bild in seinem Schaufenster, und die Gasse war voll Menschen, die es betrachten wollten.
Was sah man da?
Mitten aus dem dunklen Häusermeer leuchteten die leeren Grundflächen der zerstörten Bauten in weißem Schutt und bildeten ein zackiges Geschnörkel:
»G M«
Die Initialen des Amerikaners!
– – – Die meisten Hausherren hat der Schlag getroffen, bloß dem alten Herrn Kommerzienrat Schlüsselbein war es ganz wurst. Sein Haus war sowieso baufällig gewesen.
Er rieb sich nur ärgerlich die entzündeten Augen und knurrte:
»Ich hab's ja immer gesagt, für was Ernstes hat der Mackintosh nie ä Sinn gehabt.«

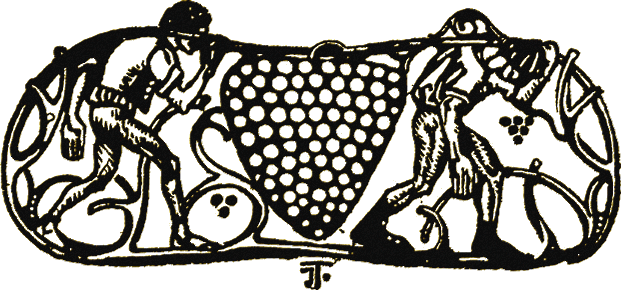
Sehen Sie den Hausierer dort mit dem wirren Bart? Tonio nennt man ihn. Gleich wird er zu unserem Tische kommen. Kaufen Sie ihm eine kleine Gemme ab oder ein paar Bologneser Tränen; – Sie wissen doch: diese Glastropfen, die in der Hand in winzige Splitter – wie Salz – zerspringen, wenn man das fadenförmige Ende abbricht. – Ein Spielzeug, weiter nichts. Und betrachten Sie dabei sein Gesicht, – den Ausdruck!
Nicht wahr, der Blick des Mannes hat etwas Tiefergreifendes? – Und was in der klanglosen Stimme liegt, wenn er seine Waren nennt: Bologneser Tränen, gesponnenes Frauenhaar. Wenn wir dann nach Hause gehen, will ich Ihnen seine Lebensgeschichte erzählen, nicht in diesem öden Wirtshaus – – – draußen am See – im Park.
Eine Geschichte, die ich niemals vergessen könnte, auch wenn er nicht mein Freund gewesen wäre, denn Sie hier jetzt als Hausierer sehen und der mich nicht mehr erkennt.
Ja, ja – glauben Sie es nur, er war mir ein guter Freund, – früher, als er noch lebte, – seine Seele noch hatte, – noch nicht wahnsinnig war. – – – Warum ich ihm nicht helfe? – Da läßt sich nicht helfen. Fühlen Sie nicht, daß man einer Seele nicht helfen soll, – die blind geworden – sich auf ihre eigene, geheimnisvolle Weise wieder zum Lichte tastet, – vielleicht auch zu einem neuen hellern Licht? –
Und es ist nichts mehr als ein Tasten der Seele nach Erinnerung, wenn Tonio hier Bologneser Tränen feilbietet! – Sie werden dann hören. – Gehen wir jetzt fort von hier. –
– – – Wie zauberhaft der See im Mondlicht schimmert!
– – – Das Schilf, da drüben am Ufer! – So nächtig – dunkel! – Und wie die Schatten der Ulmen auf der Wasserfläche schlummern – – – dort in der Bucht! – –
– – – In mancher Sommernacht saß ich auf dieser Bank, wenn der Wind flüsternd, suchend durch die Binsen strich und die plätschernden Wellen schlaftrunken an die Wurzeln der Uferbäume schlugen, – und dachte mich hinab in die zarten heimlichen Wunder des Sees, sah in der Tiefe leuchtende, glitzernde Fische, wie sie leise im Träume die rötlichen Flossen bewegen, – alte, moosgrüne Steine, ertrunkene Äste und totes Holz und schimmernde Muscheln auf weißem Kies.
Wäre es nicht besser, man läge – ein Toter – da unten auf weichen Matten von schaukelndem Tang – und hätte das Wünschen vergessen und das Träumen?! –
Doch ich wollte Ihnen von Tonio erzählen.
Wir wohnten damals alle drüben in der Stadt; – wir nannten ihn Tonio, obwohl er eigentlich anders heißt.
Von der schönen Mercedes haben Sie wohl auch nie gehört? Eine Kreolin mit rotem Haar und so hellen, seltsamen Augen.
Wie sie in die Stadt kamen, weiß ich nicht mehr, – jetzt ist sie seit langem verschollen. – –
Als Tonio und ich sie kennen lernten – auf einem Feste des Orchideenklubs –, war sie die Geliebte eines jungen Russen.
Wir saßen in einer Veranda, und aus dem Saale wehten die fernen süßen Töne eines spanischen Liedes heraus zu uns. –
– – – Girlanden tropischer Orchideen von unsagbarer Pracht hingen von der Decke herab: – Cattleëya aurea, die Kaiserin dieser Blumen, die niemals sterben, – Odontoglossen und Dendrobien auf morschen Holzstücken, weiße leuchtende Loelien, wie Schmetterlinge des Paradieses. – Kaskaden tiefblauer Lykasten, – und von dem Dickicht dieser wie im Tanze verschlungenen Blüten loderte ein betäubender Duft, der mich immer wieder durchströmt, wenn ich des Bildes jener Nacht gedenke, das scharf und deutlich wie in einem magischen Spiegel vor meiner Seele steht: Mercedes auf einer Bank aus Rindenholz, die Gestalt halb verdeckt hinter einem lebenden Vorhang violetter Vandeen. – Das schmale leidenschaftliche Gesicht ganz im Schatten.
Keiner von uns sprach ein Wort. –
Wie eine Vision aus tausend und einer Nacht; mir fiel das Märchen ein von der Sultanin, die eine Ghule war und bei Vollmond zum Friedhof schlich, um auf den Gräbern vom Fleische der Toten zu essen. Und Mercedes' Augen ruhten – wie forschend auf mir.
Dumpfes Erinnern wachte in mir auf, als ob mich einstmals in weiter Vergangenheit – in einem fernen, fernen Leben kalte, starre Schlangenaugen so angeblickt hätten, daß ich es nie mehr vergessen konnte.
Den Kopf hatte sie vorgebeugt und die phantastischen schwarz und purpur gesprenkelten Blütenzungen eines birmesischen Bulbophyllums waren in ihrem Haar verfangen, wie um neue unerhörte Sünden ihr ins Ohr zu raunen. Damals begriff ich, wie man um solch ein Weib seine Seele geben könne.
– – – Der Russe lag zu ihren Füßen. – Auch er sprach kein Wort. – –
Das Fest war fremdartig – wie die Orchideen selbst – und seltsamer Überraschungen voll. Ein Neger trat durch die Portieren und bot glitzernde Bologneser Tränen in einer Jaspisschale an. – Ich sah, wie Mercedes lächelnd dem Russen etwas sagte, – sah, wie er eine Bologneser Träne zwischen die Lippen nahm, lange so hielt und sie dann seiner Geliebten gab.
In diesem Augenblick schnellte, losgerankt aus dem Dunkel des Blättergewirres, eine riesige Orchidee, – das Gesicht eines Dämons, mit begehrlichen durstigen Lefzen, – ohne Kinn, nur schillernde Augen und ein klaffender, bläulicher Gaumen. Und dieses furchtbare Pflanzengesicht zitterte auf seinem Stengel; wiegte sich wie in bösem Lachen, – auf Mercedes' Hände starrend. Mir stand das Herz still, als hätte meine Seele in einen Abgrund geblickt.
Glauben Sie, daß Orchideen denken können? Ich habe in jenem Augenblick gefühlt, daß sie es können, – gefühlt, wie ein Hellsehender fühlt, daß diese phantastischen Blüten über ihre Herrin frohlockten. – Und sie war eine Orchideenkönigin, diese Kreolin mit ihren sinnlichen, roten Lippen, dem leise grünlichen Hautschimmer und dem Haar von der Farbe toten Kupfers. – – – – Nein, nein – Orchideen sind keine Blumen, – sind satanische Geschöpfe. – Wesen, die nur die Fühlhörner ihrer Gestalt uns zeigen, uns Augen, Lippen, Zungen in sinnbetörenden Farbenwirbeln vortäuschen, daß wir den scheußlichen Vipernleib nicht ahnen sollen, der sich – unsichtbar – todbringend verbirgt im Reiche der Schatten.
Trunken von dem betäubenden Duft traten wir endlich in den Saal zurück.
Der Russe rief uns ein Wort des Abschieds nach. – In Wahrheit ein Abschied, denn der Tod stand hinter ihm. – Eine Kesselexplosion – am nächsten Morgen – zerriß ihn in Atome.
Monate waren um, da war sein Bruder Ivan Mercedes' Geliebter, ein unzugänglicher, hochmütiger Mensch, der jeden Verkehr mied. – Beide bewohnten die Villa beim Stadttor, – abgeschieden von allen Bekannten, und lebten nur einer wilden, wahnsinnigen Liebe.
Wer sie so gesehen, wie ich, abends in der Dämmerung durch den Park gehen, aneinandergeschmiegt, sich fast im Flüstertone unterhaltend, weltverloren – keinen Blick für die Umgebung –, der begriff, daß eine übermächtige, unserem Blute fremde Leidenschaft diese beiden Wesen zusammengeschmiedet hielt.
Da – plötzlich – kam die Nachricht, daß auch Ivan verunglückt –, bei einer Ballonfahrt, die er scheinbar planlos unternommen, auf rätselhafte Weise aus der Gondel gestürzt sei.
Wir alle dachten, Mercedes werde den Schlag nicht verwinden.
– – Wenige Wochen später – im Frühjahr – fuhr sie in ihrem offenen Wagen an mir vorüber. Kein Zug in dem regungslosen Gesicht sprach von ausgestandenem Schmerze. Mir war, als ob eine ägyptische Bronzestatue, die Hände auf den Knien ruhend, den Blick in eine andere Welt gerichtet, und nicht ein lebendes Weib an mir vorbeigefahren sei. – – – Noch im Träume verfolgte mich der Eindruck: Das Steinbild des Memnon mit seiner übermenschlichen Ruhe und den leeren Augen in einer modernen Equipage in das Morgenrot fahrend, – immer weiter und weiter durch purpurleuchtende Nebel und wallenden Dunst der Sonne zu. – Die Schatten der Räder und Pferde unendlich lang – seltsam zerzogen – grauviolett, wie sie im Lichte des Frühmorgens gespenstergleich über die tauig-nassen Wege zucken.
Lange Zeit war ich dann auf Reisen und sah die Welt und manches wunderbare Bild, doch haben wenige so auf mich gewirkt. – Es gibt Farben und Formen, aus denen unsere Seele wache, lebendige Träume spinnt. – Das Tönen eines Straßengitters in der Nachtstunde unter unserm Fuß, ein Ruderschlag, eine Duftwelle, die scharfen Profile eines roten Häuserdaches, Regentropfen, die auf unsere Hände fallen, – sie sind oft die Zauberworte, die solche Bilder in unser Empfinden zurückwinken. Es liegt ein tief melancholisches Klingen wie Harfentöne in solchem Erinnerungsfühlen.
Ich kehrte heim und fand Tonio als des Russen Nachfolger bei Mercedes. – Betäubt von Liebe, gefesselt an Herz – an Sinnen – gefesselt an Händen, gefesselt an Füßen, – wie jener. – Ich sah und sprach Mercedes oft: dieselbe zügellose Liebe auch in ihr. – Zuweilen fühlte ich wieder ihren Blick forschend auf mir ruhn.
Wie damals in der Orchideen- Nacht.
In der Wohnung Manuels – unseres gemeinsamen Freundes – kamen wir manchmal zusammen, – Tonio und ich. Und eines Tages saß er dort am Fenster, – gebrochen. Die Züge verzerrt, wie die eines Gefolterten.
Manuel zog mich schweigend beiseite.
Es war eine merkwürdige Geschichte, die er mir hastig flüsternd erzählte: Mercedes, Satanistin, – eine Hexe –! Tonio hatte es aus Briefen und Schriften, die er bei ihr gefunden, entdeckt. Und die beiden Russen waren von ihr durch die magische Kraft der Imagination, – mit Hilfe von Bologneser Tränen, – ermordet worden. –
Ich habe das Manuskript später gelesen: Das Opfer, heißt es darin, wird zur selben Stunde in Stücke zerschmettert, wenn man die Bologneser Träne, die von ihm im Munde getragen und dann in heißer Liebe verschenkt wurde, in der Kirche beim Hochamt zerbricht.
Und Ivan und sein Bruder hatten ein so plötzliches schauerliches Ende gefunden! –
– – – Wir begriffen Tonios starre Verzweiflung. – Auch wenn am Gelingen des Zaubers nur der Zufall die Schuld getragen hätte, welcher Abgrund dämonischer Liebesempfindung lag in diesem Weibe! – Ein Empfinden, so fremd und unfaßbar, daß wir normalen Menschen mit unserer Erkenntnis wie in Triebsand versinken, wenn wir den Versuch wagen, mit Begriffen in diese schrecklichen Rätsel einer krebsigen Seele hinabzuleuchten. – –
Wir saßen damals die halbe Nacht – wir drei –- und horchten, wie die alte Uhr tickend die Zeit zernagte, und ich suchte und suchte vergeblich nach Worten des Trostes in meinem Hirn – im Herzen – in der Kehle; – und Tonios Augen hingen unverwandt an meinen Lippen: er wartete auf die Lüge, die ihm noch Betäubung bringen konnte. Wie Manuel – hinter mir – den Entschluß faßte, den Mund öffnete, um zu reden, – ich wußte es, ohne mich umzusehen. Jetzt – jetzt würde er es sagen. – – Ein Räuspern, ein Scharren mit dem Stuhl, – – – dann wieder Stille, eine ewig lange Zeit. Wir fühlten, jetzt tastet sich die Lüge durch das Zimmer, unsicher tappend an den Wänden, wie ein seelenloser Schemen ohne Kopf.
Endlich Worte – verlogene Worte – wie verdorrt: »Vielleicht – – – – – – – – vielleicht liebt sie dich anders, als – – – – als die andern.«
Totenstille. Wir saßen und hielten den Atem an: – daß nur die Lüge nicht stirbt, – – sie schwankt hin und her auf gallertenen Füßen und will fallen, – – – nur eine Sekunde noch!
Langsam, langsam begannen sich Tonios Züge zu verändern: Irrlicht Hoffnung!
– – – Da war die Lüge Fleisch geworden! –
– – – Soll ich Ihnen noch das Ende erzählen? Mir graut, es in Worte zu kleiden. – Stehen wir auf, mir läuft ein Schauer über den Rücken, wir haben zu lange hier auf der Bank gesessen. Und die Nacht ist so kalt.
– – – Sehen Sie, das Fatum blickt auf den Menschen wie eine Schlange, – es gibt kein Entrinnen. – Tonio versank aufs neue in einen Wirbel rasender Leidenschaft zu Mercedes, er schritt an ihrer Seite, – ihr Schatten. – Sie hielt ihn umklammert mit ihrer teuflischen Liebe wie ein Polyp der Tiefsee sein Opfer.
– – – An einem Karfreitag packte das Schicksal zu: Tonio stand frühmorgens im Aprilsturm vor der Kirchentür, barhaupt, in zerrissenen Kleidern, die Fäuste geballt, und wollte die Menge am Gottesdienste hindern. – Mercedes hatte ihm geschrieben – und er war darüber wahnsinnig geworden; – in seiner Tasche fand man ihren Brief, in dem sie ihn um eine Bologneser Träne bat.
Und seit jenem Karfreitag steht Tonios Geist in tiefer Nacht.


»Wahrhaftiglich, ohne Betrug und gewiß, ich sage dir:
so wie es unten ist, ist es auch oben.«
Tabula smaragdina
Der alte Tintenfisch saß auf einem dicken blauen Buch, das man in einem gescheiterten Schiffe gefunden hatte, und sog langsam die Druckerschwärze heraus.
Landbewohner haben gar keinen Begriff, wie beschäftigt so ein Tintenfisch den ganzen Tag über ist.
Dieser da hatte sich auf Medizin geworfen und von früh bis Abend mußten die beiden armen kleinen Seesterne – weil sie ihm soviel Geld schuldig waren – umblättern helfen.
Auf dem Leibe – dort wo andere Leute eine Taille haben – trug er einen goldenen Zwicker. – Ein Beutestück. Die Gläser standen weit ab – links und rechts –, und wer zufällig durchsah, dem wurde gräßlich schwindelig.
– – – – Tiefer Friede ringsum.
Mit einem Mal kam der Polyp angeschossen, die sackförmige Schnauze vorgestreckt, die Fangarme lang nachschleppend wie ein Rutenbündel, und ließ sich neben dem Buche nieder. – Wartete, bis der Alte aufschaute, grüßte dann sehr tief und wickelte eine Zinnbüchse aus sich heraus. »Sie sind wohl der violette Pulp aus dem Steinbuttgäßchen?« fragte gnädig der Alte. »Richtig, richtig, habe ja Ihre Mutter gut gekannt, – geborene ›von Octopus‹. (Sie, Barsch, bringen Sie mir 'mal den Gothaschen Polypenalmanach her.) Nun, was kann ich für Sie tun, lieber Pulp?«
»Inschrift, – ehüm, ehüm – Inschrift – lesen«, hüstelte der verlegen (er hatte so eine schleimige Aussprache) und deutete auf die Blechbüchse.
Der Tintenfisch stierte auf die Dose und machte gestielte Augen wie ein Staatsanwalt:
»Was sehe ich, – Blamol!? – Das ist ja ein unschätzbarer Fund. – Gewiß aus dem gestrandeten Weihnachtsdampfer? – Blamol – das neue Heilmittel, – je mehr man davon nimmt, desto gesünder wird man!
Wollen das Ding gleich öffnen lassen. Sie, Barsch, schießen Sie mal zu den zwei Hummern rüber, – Sie wissen doch, Korallenbank, Ast II, Brüder Scissors, – aber rasch.«
Kaum hatte die grüne Seerose, die in der Nähe saß, von der neuen Arznei gehört, huschte sie sogleich neben den Polypen: – – Ach, sie nahm sie so gerne ein; – ach, für ihr Leben gern! –
Und mit ihren vielen hundert Greifern führte sie ein entzückendes Gewimmel auf, daß man kein Auge von ihr abwenden konnte. –
Hai–fisch! – war sie schön! Der Mund war ein bißchen groß zwar, doch das ist gerade bei Damen so pikant.
Alle waren vergafft in ihre Reize und übersahen ganz, daß die beiden Hummern schon angekommen waren und emsig mit ihren Scheren an der Blechbüchse herumschnitten, wobei sie sich ihrem tschnetschenden Dialekt unterhielten. – Ein leiser Ruck, und die Dose fiel auseinander.
Wie ein Hagelschauer stoben die weißen Pillen heraus und – leichter als Kork – verschwanden sie blitzschnell in die Höhe.
Erregt stürzte alles durcheinander: »Aufhalten, aufhalten!«
Aber niemand hatte rasch genug zugreifen können. Nur der Seerose war es geglückt, noch eine Pille zu erwischen und sie schnell in den Mund zu stecken.
Allgemeiner Unwillen; – am liebsten hätte man die Brüder Scissors geohrfeigt.
»Sie, Barsch, Sie haben wohl auch nicht aufpassen können? – Wozu sind Sie eigentlich Assistent bei mir?«
War das ein Schimpfen und Keifen! Bloß der Pulp konnte kein Wort herausbringen, hieb nur wütend mit den geballten Fangarmen auf eine Muschel, daß das Perlmutter krachte.
Plötzlich trat Totenstille ein: – Die Seerose!
Der Schlag mußte sie getroffen haben: sie konnte kein Glied rühren. Die Fühler weit von sich gestreckt, wimmerte sie leise.
Mit wichtiger Miene schwamm der Tintenfisch hinzu und begann eine geheimnisvolle Untersuchung. Mit einem Kieselstein schlug er gegen einen oder den andern Fühler oder stach hinein. (Hm, hm, Babynskisches Phänomen, Störung der Pyramidenbahnen.) Nachdem er schließlich mit der Schärfe eines Flossensaumes der Seerose einige Male kreuz und quer über den Bauch gefahren war, wobei seine Augen einen undurchdringenden Blick annahmen, richtete er sich würdevoll auf und sagte: »Seitenstrangsklerose. – Die Dame ist gelähmt.«
»Ist noch Hilfe? Was glauben Sie? Helfen Sie, helfen Sie, – ich schieß rasch in die Apotheke«, rief da das gute Seepferd.
»Helfen?! – Herr, sind Sie verrückt? Glauben Sie vielleicht, ich habe Medizin studiert, um Krankheiten zu heilen?« Der Tintenfisch wurde immer heftiger. »Mir scheint, Sie halten mich für einen Barbier, oder wollen Sie mich verhöhnen? Sie, Barsch, – Hut und Stock, – ja!«
Einer nach dem andern schwamm fort: »Was einen hier in diesem Leben doch alles treffen kann, schrecklich – nicht?« Bald war der Platz leer, nur hin und wieder kam der Barsch mürrisch zurück, nach einigen verlorenen oder vergessenen Dingen zu suchen.
Auf dem Grunde des Meeres regte sich die Nacht. Die Strahlen, von denen niemand weiß, woher sie kommen und wohin sie entschwinden, schwebten wie Schleier in dem grünen Wasser und schimmerten so müde, als sollten sie nie mehr wiederkehren.
Die arme Seerose lag unbeweglich und sah ihnen nach in herbem Weh, wie sie langsam, langsam in die Höhe stiegen. Gestern um diese Zeit schlief sie schon längst, zur Kugel geballt, in sicherem Versteck. – Und jetzt? – Auf offener Straße umkommen zu müssen, wie ein – Tier! – Luftperlen traten ihr auf die Stirne. Und morgen ist Weihnachten!! An ihren fernen Gatten mußte sie denken, der sich, weiß Gott wo, herumtrieb. – Drei Monate nun schon Tangwitwe! Wahrhaftig, es wäre kein Wunder gewesen, wenn sie ihn hintergangen hätte.
Ach, wäre doch wenigstens das Seepferd bei ihr geblieben! Sie fürchtete sich so! –
Immer dunkler war es, daß man kaum mehr die eigenen Fühler unterscheiden konnte.
Breitschultrige Finsternis kroch hervor hinter Steinen und Algen und fraß die verschwommenen Schatten der Korallenbänke.
Gespenstisch glitten schwarze Körper vorüber – mit glühenden Augen und violett aufleuchtenden Flossen. – Nachtfische! – Scheußliche Rochen und Seeteufel, die in der Dunkelheit ihr Wesen treiben. Mordsinnend hinter Schiffstrümmern lauern. –
Scheu und leise wie Diebe öffnen die Muscheln ihre Schalen und locken den späten Wanderer auf weichen Pfühl zu grausigem Laster.
In weiter Ferne bellte ein Hundsfisch.
– – – Da zuckt durch die Ulven heller Schein: Eine leuchtende Meduse führt trunkene Zecher heim; – Aalgigerln mit schlumpigen Muränendirnen an der Flosse.
Zwei silbergeschmückte junge Lachse sind stehen geblieben und blicke verächtlich auf die berauschende Schar. Wüster Gesang erschallt:
»In dem grünen Tange – –
hab' ich sie gefragt,
Ob sie nach mir verlange. – –
Ja, hat sie gesagt.
Drauf hat sie sich gebückt –
und ich hab's sie gezwickt.
Ach im grünen Tange ...«
»No, no, aus dem Weg da, Sö, – So Frechlachs – Sö«, brüllte ein Aal plötzlich.
Der Silberne fährt auf: »Schweigen Sie! Sie haben's nötig, weanerisch zu reden. Glauben wohl, weil Sie das einzige Viech sind, das nicht im Donaugebiet vorkommt – –«
»Pst, pst«, beschwichtigte sie die Meduse, »schämen Sie sich doch, schauen Sie dorthin!« –
Alle verstummten und blickten voll Scheu auf einige schmächtige, farblose Gestalten, die sittsam ihres Weges ziehen.
»Lanzettenfischchen«, flüsterte einer.
? ? ? ? ?
– – – »Oh, das sind hohe Herren, – Hofräte, Diplomaten und so. – Ja, die sind schon von Geburt dazu bestimmt, welche Naturwunder: Haben weder Gehirn noch Rückgrat.« –
Minuten stummer Bewunderung, dann schwimmen alle friedlich weiter.
Die Geräusche verhallen. – Totenstille senkt sich nieder. Die Zeit rückt vor. – Mitternacht, die Stunde des Schreckens.
Waren das nicht Stimmen? – Crevetten können es doch nicht sein, – jetzt so spät? –
Die Wache geht um: Polizeikrebse! –
Wie sie scharren mit gepanzerten Beinen, über den Sand knirschend ihren Raub in Sicherheit bringen.
Wehe, wer ihnen in die Hände fällt; – vor keinem Verbrechen scheuen sie zurück, – – und ihre Lügen gelten vor Gericht wie Eide.
Sogar der Zitterrochen erbleicht, wenn sie nahen.
Der Seerose stockt der Herzschlag vor Entsetzen, sie, eine Dame, wehrlos, – auf offenem Platze! – Wenn sie sie erblicken! Sie werden sie vor den Polizeirat, den schurkischen Meineidkrebs, schleppen, – den größten Verbrecher der Tiefsee – und dann – und dann – –
Sie nähern sich ihr – – jetzt – – ein Schritt noch, und Schande und Verderben werden die Fänge um ihren Leib schlagen.
Da erbebt das dunkle Wasser, die Korallenbäume ächzen und zittern wie Tang, ein fahles Licht scheint weit hin.
Krebse, Rochen, Seeteufel ducken sich nieder und schießen in wilder Flucht über den Sand, Felsen brechen und wirbeln in die Höhe.
Eine bläulich gleißende Wand – so groß wie die Welt – fliegt durch das Meer.
Näher und näher jagt der Phosphorschein: die leuchtende Riesenflosse der Tintorera, des Dämons der Vernichtung, fegt einher und reißt abgrundtiefe glühende Trichter in das schäumende Wasser.
Alles dreht sich in rasender Hast. Die Seerose fliegt durch den Raum in brausende Weiten, hinauf und hinab – über Länder von smaragdenem Gischt. –
Wo sind die Krebse, wo Schande und Angst! Das brüllende Verderben stürmt durch die Welt. – Ein Bacchanal des Todes, ein jauchzender Tanz für die Seele.
Die Sinne erlöschen, wie trübes Licht.
Ein furchtbarer Ruck. – Wirbel stehen, und schneller, schneller, immer schneller und schneller drehen sie sich zurück und schmettern auf den Grund, was sie ihm entrissen. Mancher Panzer brach da.
Als die Seerose nach dem Sturze endlich aus tiefer Ohnmacht erwachte, fand sie sich auf weiche Algen gebettet.
Das gute Seepferd – es war heute gar nicht ins Amt gegangen – beugte sich über das Lager.
Kühles Morgenwasser umfächelte ihr Gesicht, sie blickte um sich. Schnattern von Entenmuscheln und das fröhliche Meckern einer Geisbrasse drang an ihr Ohr.
»Sie befinden sich in meinem Landhäuschen«, beantwortete das Seepferd ihren fragenden Blick und sah ihr tief in die Augen. »Wollen Sie nicht weiter schlafen, gnädige Frau, es würde Ihnen gut tun!«
Die Seerose konnte aber beim besten Willen nicht. Ein unbeschreibliches Ekelgefühl zog ihr die Mundwinkel herunter.
»War das ein Unwetter heute nacht; mir dreht sich noch alles vor den Augen von dem Gewirbel«, fuhr das Seepferd fort. »Darf ich Ihnen übrigens mit Speck – so einem recht fetten Stückchen Matrosenspeck aufwarten?«
Beim bloßen Hören des Wortes Speck überkam die Seerose eine derartige Übelkeit, daß sie die Lippen zusammenpressen mußte. – Vergebens. Ein Würgen erfaßte sie (diskret blickte das Seepferd zur Seite), und sie mußte erbrechen. Unverdaut kam die Blamolpille zum Vorschein, stieg mit Luftblasen in die Höhe und verschwand.
Gott sei Dank, daß das Seepferd nichts bemerkt hatte. – Die Kranke fühlte sich plötzlich wie neugeboren.
Behaglich ballte sie sich zusammen.
O Wunder, sie konnte sich wieder ballen, konnte ihre Glieder bewegen wie früher.
Entzücken über Entzücken!
Dem Seepferd traten vor Freude Luftbläschen in die Augen. »Weihnachten, heute ist wirklich Weihnachten«, jubelte es ununterbrochen, »und das muß ich gleich dem Tintenfisch melden; Sie werden sich unterdessen recht, recht ausschlafen.«
»Was finden Sie denn so Wunderbares an der plötzlichen Genesung der Seerose, mein liebes Seepferd?« fragte der Tintenfisch und lächelte mild. »Sie sind ein Enthusiast, mein junger Freund! Ich rede zwar sonst prinzipiell mit Laien (Sie, Barsch, einen Stuhl für den Herrn) nicht über die medizinische Wissenschaft, will aber diesmal eine Ausnahme machen und trachten, meine Ausdrucksweise Ihrem Auffassungsvermögen möglichst anzupassen. Also, Sie halten Blamol für ein Gift und schieben seiner Wirkung die Lähmung zu. Oh, welcher Irrtum! Nebenbei bemerkt ist Blamol längst abgetan, es ist ein Mittel von gestern, heute wird allgemein Idiotinchlorür angewandt (die Medizin schreitet nämlich unaufhaltsam vorwärts). Daß die Erkrankung mit dem Schlucken der Pille zusammentraf, war bloßer Zufall – alles ist bekanntlich Zufall –, denn erstens hat Seitenstrangsklerose ganz andere Ursachen, die Diskretion verbietet mir, sie zu nennen, und zweitens wirkt Blamol wie alle diese Mittel gar nicht beim Einnehmen, sondern lediglich beim Ausspucken. Auch dann natürlich nur günstig.
Und was endlich die Heilung anbelangt? – Nun, da liegt ein deutlicher Fall von Autosuggestion vor. – In Wirklichkeit (Sie verstehen, was ich meine: ›Das Ding an sich‹ nach Kant) ist die Dame genau so krank wie gestern, wenn sie es auch nicht merkt. Gerade bei Personen mit minderwertiger Denkkraft setzen Autosuggestionen so häufig ein. – Natürlich will ich damit nichts gesagt haben, – Sie wissen wohl, wie hoch ich die Damen schätze: ›Ehret die Frauen, sie flechten und weben – – –‹ – Und jetzt, mein junger Freund, genug von diesem Thema, es würde Sie nur unnötig aufregen. – A propos, – Sie machen mir doch abends das Vergnügen? Es ist Weihnacht und – meine Vermählung.«
»Wa–? – Vermä– – –«, platzte das Seepferd heraus, faßte sich aber noch rechtzeitig: »Oh, es wird mir eine Ehre sein, Herr Medizinalrat.«
»Wen heiratet er denn?« fragte er beim Hinausschwimmen den Barsch. – »Was Sie nicht sagen: die Miesmuschel?? – Warum nicht gar! – Schon wieder so eine Geldheirat.«
Als abends die Seerose, etwas spät, aber mit blühendem Teint an der Flosse des Seepferdes in den Saal schwamm, wollte der Jubel kein Ende nehmen. Jeder umarmte sie, selbst die Schleierschnecken und Herzmuscheln, die als Brautjungfern fungierten, legten ihre mädchenhafte Scheu ab.
Es war ein glänzendes Fest, wie es nur reiche Leute geben können; die Eltern der Miesmuschel waren eben Millionäre und hatten sogar ein Meerleuchten bestellt.
Vier lange Austernbänke waren gedeckt. – Eine volle Stunde wurde schon getafelt, und immer kamen noch neue Leckerbissen. Dazu kredenzte der Barsch unablässig aus einem schimmernden Pokal (natürlich die Öffnung nach unten) hundertjährige Luft, die aus der Kabine eines Wracks stammte.
Alles war bereits angeheitert. – Die Toaste auf die Miesmuschel und ihren Bräutigam gingen in dem Knallen der Korkpolypen und dem Klappern der Messermuscheln völlig unter.
Das Seepferd und die Seerose saßen am äußersten Ende der Tafel, ganz im Schatten, und achteten in ihrem Glück kaum der Umgebung.
»Er« drückte »ihr« zuweilen verstohlen den einen oder anderen Fühler, und sie lohnte ihn dafür mit einem Glutblick. Als gegen Ende des Mahles die Kapelle das schöne Lied spielte:
»Ja, küssen, –
scherzen
mit jungen Herrn
ist selbst bei Frauen
sehr modern«,
und sich dabei die Tischnachbarn der beiden verschmitzt zublinzelten, da konnte man sich dem Eindruck nicht verschließen, daß die allgemeine Aufmerksamkeit hier allerlei zarte Beziehungen mutmaßte.


»Du, Fredy, was bedeutet den eigentlich dir rote, riesige ›29‹ dort drüben über dem Podium?«
»Na, weißt du, Gibson, du stellst manchmal Fragen!? – Was die ›29‹ bedeutet! – Weshalb sind wir denn hier? – weil Silvester ist – Silvester 1929!«
Die Herren lachten alle über Gibsons Zerstreutheit.
Graf Oskar Gulbransson, der unten im Saale stand, blickte zur Brüstung empor, und als er die fröhlichen Gesichter mit den modischen, lang herabhängenden Schnurrbartspitzen à la chinois über dem verschnörkelten Geländer sah, mußte er unwillkürlich mitlachen und rief hinauf: »Jemand einen Witz gemacht, eh? – Messieurs, wenn Sie wüßten, wie furchtbar lustig Sie mit Ihren mongolisch glattrasierten Schädeln da oben auf dem goldenen Balkon aussehen! – Wie Vollbluttataren. – Warten Sie, ich komme auch hinauf, ich muß nur meine Dame auf ihren Sitz führen. – Es fängt nämlich gleich an –: die Komtesse Jeiteles wird ein Lied von Kurt Sperling singen und der Komponist sie selber auf der Harfe begleiten, kurz: – (er legte die Hände wie Schalldämpfer an die Wangen) – es wird schau–der–haft!«
»Wirklich ein prachtvoller alter Aristokrat, dieser Graf Oskar, – riesig vornehm, und wie er durch das gelbe Seidengewimmel da unten schießt, wie ein Hecht«, sagte einer der Herren, ein Russe, namens Zybin. »Ich habe neulich ein Bild von ihm in der Hand gehabt, wie er vor fünfundzwanzig Jahren oder so ungefähr, aussah, – Frack, – ganz schwarz – von anno dazumal, aber trotzdem verdammt elegant.«
»Muß übrigens eine scheußliche Mode gewesen sein; schon die Idee, sich anliegend und noch dazu schwarz zu kleiden«, warf Fred Hamilton dazwischen, »wenn da auf einem Balle ein paar Herren bei einer Dame standen, mußte das ja rein aussehen, als ob sich die Raben um ein Aas – – – – – –« »In galanten Vergleichen leisten Sie wirklich Übernatürliches, Fredy«, unterbrach der Graf, der etwas atemlos, so schnell er war er die Stufen hinaufgelaufen, hinzutrat – »aber jetzt rasch, Messieurs, ein Glas Sekt, ich habe mich von Frau Werie bereits verabschiedet und möchte mich recht, recht, recht amüsieren.«
»Apropos, Graf, wer ist das junge Mädchen dort?« fragte Gibson, der immer noch von der Balustrade in den oval gebauten Saal hinabsah, aus dem eine Flut von hellroten Polstern, zu Sitzen für die Zuschauer aufeinandergelegt, in entzückendem Kontrast zu den goldgelben türkischen Pluderhosen der Damen und eine Nuance dunkleren Togavestons der Herren hervorleuchtete.
»Welche meinen Sie, lieber Gibson?«
»Die dekolletierte meine dort.«
Allgemeine Heiterkeit.
»Sie sind wirklich köstlich, Gibson; – die dekolletierte! – Es sind doch alle dekolletiert! – Aber ich weiß, wen Sie meinen, – die kleine Chinesin, nicht wahr, neben dem Professor R. mit dem schlecht rasierten Kopf? – Das ist ein Fräulein von Chün-lün-tsang. – – – – AH, da ist ja schon der Champagner!«
Ein livrierter Pavian war vorgetreten und wies zum Zeichen, daß der Wein serviert sei, mit seiner zottigen Hand auf den schillernden Vorhang, der den Hintergrund des Balkons abschloß.
»Eigentlich für Affen eine sehr kleidsame Tracht«, bemerkte ein Herr halblaut, um das Tier, das mittels Hypnose dressiert war und jedes Wort verstand, nicht zu kränken.
»Besonders die Idee, die Knöpfe mit Nummern zu versehen, ist sehr sinnreich, – dadurch kann man sie voneinander unterscheiden«, setzte Fredy hinzu. »Übrigens erinnert das an die kriegerisch lächerlichen Zeiten vor fünfundzwanzig Jahren. – – –«
Der dröhnende Schall einer Tritonmuschel schnitt ihm das Wort ab: das Konzert begann.
Die Bogenlampen erloschen, und der Saal in seinem zarten Schmuck aus japanischen Pfirsichblüten und Efeu versank in tiefe Finsternis.
»Gehen wir, Messieurs, es ist höchste Zeit, – sonst überrascht uns der Gesang«, flüsterte der Graf, und man schlich auf den Zehen in das Trinkzelt.
Hier war alles schon vorbereitet, – die Atlaspolster im Kreise geordnet und zum Sitzen oder Liegen geschlichtet, kleine Wannen aus Chinaporzellan daneben, voll Nelkenblätter zum Trocknen der Finger; – die Sektkelche, mit dem perlenden Gemisch von indischem Soma und Champagner soeben angefüllt, staken in Schulterhöhe in goldenen Drahtschlingen, die vom Plafond herabhängend durch rhythmisch leises Erzittern den Wein in stetem Moussieren erhielten. Von den Zeltwänden strahlte gleichmäßig mildes Kaltlicht aus und floß in märchenhaftem Glanze über die weichen seidenen Teppiche.
»Ich glaube, heute bin ich an der Reihe?« sagte Monsieur Choat, ein kirgisischer Edelmann. »Jumbo, Jumbo«, – und er rief in den winzigen Schalltrichter an dem Metallstab, der mitten vom Boden des Gemaches empor durch einen Ausschnitt im Plafond bis zur vollen Höhe des Hauses reichte; – »Jumbo, Jumbo, die Kugel, rasch, rasch!«
Im nächsten Augenblick glitt der Affe lautlos aus der Dunkelheit die Stange herab, befestigte eine kopfgroße, geschliffene Beryllkugel an zwei Schlingen und verschwand behende wieder in die Höhe.
Der Kirgise zog ein Mescal-Etui hervor und warf den weiten Seidenärmel zurück: »Darf ich vielleicht einen der Herren bitten?!« –
Geschickt brachte ihm der Graf mit einer Pravazschen Spritze eine Injektion am Arme bei: »So, das wird gerade für eine oder zwei Visionen ausreichen.«
Monsieur Choat schob die Beryllkugel ein wenig höher, so daß er sie bequem fixieren konnte, und lehnte sich zurück: »Also – worauf soll ich meine Gedanken richten, meine Herren?«
»Auf den neuen Propheten in Shambala, – Szenen aus einer römischen Arena, – Orionnebel, – Buddha im Stiftungsgarten Kosambi«, riefen alle durcheinander; jeder wollte etwas anderes. –
»Wie wäre es, wenn Sie einmal erforschen wollten, wo eigentlich das Paradies gestanden haben mag«, schlug Graf Oskar vor.
Gibson nützte die günstige Gelegenheit und schlüpfte unbemerkt aus dem Zelt, er hatte dies visionäre Schauen – diesen neuen Sport – nachgerade satt bis zum Überdruß, was kam dabei heraus? Farbenprächtige Halluzinationen, die jeder schilderte, so lebendig er konnte, – und was es eigentlich sei, ob unbewußte Gedanken, die der Beryll reflektierte, ob vergessene Vorstellungen aus früherem Dasein, war doch niemand zu sagen imstande.
Er trat an die Brüstung und schaute hinab.
Harfenakkorde, durchbrochen von abgerissen gesungenen Tönen, die zuweilen im Hintergrunde von einem jähen intensiven Aufblitzen eines Lichtfunkens, – rot, blau, grün, – begleitet waren, zitterten durch die Dunkelheit. – Moderne Musik!
Er lauschte gespannt diesen aufregenden Weckrufen, die seltsam ruckweise an das Herz brandeten, als sollten sie beim nächsten Pulsschlag die durch das Leben dünngeschabten Scheidewände der Seele zu neuer, unerhörter Verzückung durchbrechen.
Der Saal da unten lag in Finsternis, nur die Diamantagrafen im Haar und am Halse der Frauen und Mädchen warfen funkelnd den Schein von winzigen Radiumperlen, die wie Leuchtkäfer grünlich erglommen, auf in Opalpuder schimmernde Busen.
Unbeweglich standen die Herren hinter ihren Damen, und hie und da sah man die vergoldeten Fingernägel aufblitzen, wenn sie, Kühlung zufächelnd mit der Hand, in die unmittelbare Nähe des phosphoreszierenden Haarschmuckes gerieten.
Gibson mühte sich den Platz herauszufinden, wo Fräulein von Chün-lün-tsang sitzen mußte. – Noch heute wollte er den Grafen bitten, ihn vorzustellen – – – – –, da faßte ihn jemand am Arm und zog ihn höflich in das Zelt zurück.
»Ach, verzeihen Sie, lieber Gibson, wenn wir Sie gestört haben, – aber Sie sind ja ein großer Schriftgelehrter, und Monsieur Choat hat da so merkwürdige Visionen im Beryll gehabt und meint, daß sie sich wirklich auf das Paradies, – den Garten Eden, – beziehen könnten.«
»Ja, denken Sie nur, eine vorsintflutliche unendlich üppige Landschaft erschien mir«, bestätigte der Kirgise, »dabei Nordlicht, unsagbar prachtvoll, – weiß mit rosa Rändern, wie Spitzen herabhängend vom Himmel, und die Sonne, glühend rot, zog am Horizont entlang, ohne unterzugehen; es war, als ob sich das Firmament im Kreise drehe und – – –«
»Das sind doch alles die Himmelszeichen des Polarkreises, nicht wahr? – Denken Sie nur, die Wiege der Menschheit auf dem Nordpol!« unterbrach Graf Oskar. – »Übrigens tropisches Klima war tatsächlich in grauer Vorzeit dort oben.«
Gibson nickte mit dem Kopf: »Wissen Sie, daß das alles sehr merkwürdig ist, – wie heißt es denn nur schnell im Zendavesta? Ja: ›Dort oben sah man die Sonne, die Sterne, den Mond einmal nur kommen und gehen im Jahr‹, – und: – ›es schien ein Jahr ein einz'ger Tag zu sein‹, auch steht im Rig-Veda, daß damals die Morgendämmerung tagelang am Himmel stand, ehe die Sonne aufging (die Herren stießen sich an: was der Mensch für ein unglaubliches Gedächtnis hat), und dann sagt schon Anaximenes – – –«
»Ich bitte dich um Gotteswillen, hör schon auf mit deiner Gelehrsamkeit«, rief Fredy und schlug den Vorhang zurück. – »Ah: die Musik ist aus.«
Blendende Helle strömte herein.
Ein plätscherndes, pritschelndes, tätschelndes Geräusch erfüllte den Saal und wollte nicht enden. –
»Welch ein Applaus, meine Herren, sehen Sie nur, wie der Opalpuder in die Luft steigt, – über die Brüstung kommt eine wahre Wolke herauf.«
»Eine recht merkwürdige Mode, diese Art zu applaudieren«, sagte jemand. »Daß sie übrigens dezent wäre, könnte man nicht – – –«
»Na, und wie weh das tun muß, – ich möchte keine Dame sein, bestimmt nicht – – – à propos, wissen Sie nicht, Graf, wer die erste war, die diese Mode erfand?«
»Das kann ich Ihnen ganz genau sagen«, sagte dieser lachend, »das war vor Jahren die Fürstin Juppihoy, eine sehr korpulente Dame, die gewettet hatte, die Menge werde ihr auch das nachmachen, – und sie hatte nicht nur die Courage, sondern auch – – – die Dekolletage dazu. – Sie können sich vorstellen, welches Entsetzen das damals erregte.«
Wieder erscholl das plätschernde, pritschelnde, tätschelnde Geräusch aus dem Saal empor.
Die kleine Gesellschaft schwieg nachdenklich.
»Warum eigentlich die Herren nicht auch mit applaudieren dürfen«, sagte plötzlich Gibson träumerisch.
Einen Augenblick große Verblüffung, dann brachen alle in ein stürmisches, schallendes Gelächter aus.
Gibson wurde rot: »Aber ich meine es doch gar nicht so; hony soit qui mal y pense.« – – –
Die Heiterkeit verdoppelte sich; Fred Hamilton wand sich auf seinem Polster; »Ha, ha, ha, um Gotteswillen, hör auf, – ich sterbe, – mir scheint, du hast an deine kleine Chinesin gedacht.«
Dröhnende Gongschläge hallten durch das Haus.
Der Graf hob sein Glas in die Höhe: »Messieurs, wollen Sie nicht anstoßen, so hören Sie doch«, – vor Lachen konnte er kaum weitersprechen, – »Messieurs, – es schlägt soeben 24 Uhr, – prosit Neujahr 1929, prosit, prosit!« –
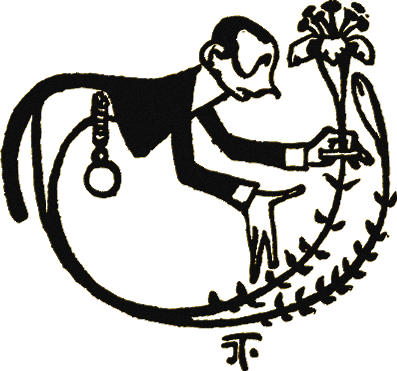

Der Opal, den Miß Hunt am Finger trug, fand allgemeine Bewunderung.
»Ich habe ihn von meinem Vater geerbt, der lange in Bengalen diente, und er stammt aus dem Besitze eines Brahmanen«, sagte sie und strich mit den Fingerspitzen über den großen schimmernden Stein. »Solches Feuer sieht man nur an indischen Juwelen. – Liegt es am Schliff oder an der Beleuchtung, ich weiß es nicht, aber manchmal kommt es mir vor, als ob der Glanz etwas Bewegliches, Ruheloses an sich hätte, wie ein lebendiges Auge.«
»Wie ein lebendiges Auge«, wiederholte nachdenklich Mr. Hargrave Jennings.
»Finden Sie etwas daran, Mr. Jennings?«
Man sprach von Konzerten, von Bällen und Theater, – von allem Möglichen, aber immer wieder kam die Rede auf indische Opale.
»Ich könnte Ihnen etwas über diese Steine, dieses sogenannten Steine mitteilen«, sagte schließlich Mr. Jennings, »aber ich fürchte, Miß Hunt dürfte dadurch der Besitz ihres Ringes für immer verleidet sein. Wenn Sie übrigens einen Augenblick warten, will ich das Manuskript in meinen Schriften suchen.«
Die Gesellschaft war sehr gespannt.
»Also hören Sie, bitte. (Was ich Ihnen hier vorlese, ist ein Stück aus den Reisenotizen meines Bruders – wir haben damals beschlossen, nicht zu veröffentlichen, was wir gemeinsam erlebten.)
Also: Bei Mahawalipur stößt das Dschungel in einem schmalen Streifen bis hart ans Meer. Kanalartige Wasserstraßen, von der Regierung angelegt, durchziehen das Land von Madras fast bis Tritschinopolis, dennoch ist das Innere unerforscht und einer Wildnis gleich, undurchdringlich, ein Fieberherd.
Unsere Expedition war eben eingetroffen, und die dunkelhäutigen tamulischen Diener luden die zahlreichen Zelte, Kisten und Koffer aus den Booten, um sie von Eingeborenen durch die dichten Reisfelder, aus denen nur hie und da Gruppen von Palmyrapalmen wie Inseln in einem wogenden hellgrünen See emporragen, in die Felsenstadt Mahawalipur schaffen zu lassen.
Oberst Stuart, mein Bruder Hargrave und ich nahmen sofort Besitz von einem der kleinen Tempel, die, aus einem einzigen Felsen herausgehauen, eigentlich herausgeschnitzt, wahre Wunderwerke altdrawidischer Baukunst darstellen. Die Früchte beispielloser Arbeit indischer Frommer, mögen sie jahrhundertelang den Hymnen der begeisterten Jünger des großen Erlösers gelauscht haben, – jetzt dienen sie brahmanischem Shivakult, wie auch die sieben aus dem Felsrücken gemeißelten heiligen Pagoden mit den hohen Säulenhallen.
Aus der Ebene stiegen trübe Nebel, schwebten über den Reisfeldern und Wiesen und lösten die Konturen heimziehender Buckelochsen vor den rohgezimmerten indischen Karren in regenbogenartigen Dunst auf. Ein Gemisch von Licht und geheimnisvoller Dämmerung, das sich schwer um die Sinne legt und wie Zauberdunst von Jasmin und Holunderdolden die Seele in Träume wiegt.
In der Schlucht vor dem Aufgang zu den Felsen lagerten unsere Mahratten-Sepoys in ihren wilden malerischen Kostümen und den rot und blauen Turbans, und wie ein brausender Lobgesang des Meeres an Shiva, den Allzerstörer, dröhnten und hallten die Wogenschläge aus den offenen Höhlengängen der Pagoden, die sich vereinzelt längs des Gestades hinziehen.
Lauter und grollender schwollen die Töne der Wellen zu uns empor, wie der Tag hinter den Hügeln versank und Nachtwind sich in den alten Hallen fing.
Die Diener hatten Fackeln in unseren Tempel gebracht und sich in das Dorf zu ihren Landsleuten begeben. Wir leuchteten in alle Nischen und Winkel. Viele dunkle Gänge zogen durch die Felswände, und phantastische Götterstatuen in tanzender Stellung, die Handflächen vorgestreckt mit geheimnisvoller Fingerhaltung, deckten mit ihren Schatten die Eingänge wie Hüter der Schwelle.
Wie wenige wissen, daß alle diese bizarren Figuren, ihre Anordnung und Stellung zueinander, die Zahl und Höhe der Säulen und Lingams Mysterien von unerhörter Tiefe andeuten, von denen wir Abendländer kaum eine Vorstellung haben.
Hargrave zeigte uns ein Ornament an einem Sockel, einen Stab mit vierundzwanzig Knoten, an dem links und rechts Schnüre herabhingen, die sich unten teilten: Ein Symbol, das Rückenmark des Menschen darstellend, und in Bildern daneben Erklärungen der Ekstasen und übersinnlichen Zustände, deren der Yogi auf dem Wege zu den Wunderkräften teilhaftig wird, wenn er Gedanken und Gefühle auf die betreffenden Rückenmarksabschnitte konzentriert. –
›Dies da Pingala, großer Sonnenstrom‹, radebrechte bestätigend Akhil Rao, unser Dolmetsch.
Da faßte Oberst Stuart meinen Arm: ›Ruhig – – – hören Sie nichts?‹
Wir horchten gespannt in der Richtung des Ganges, der, von der kolossalen Statue der Göttin Kala Bhairab verborgen, sich in die Finsternis zog.
Die Fackeln knisterten – sonst Totenstille.
Eine lauernde Stille, die das Haar sträubt, wo die Seele bebt und fühlt, daß etwas geheimnisvoll Grauenhaftes blitzartig ins Leben bricht, wie eine Explosion, und nun unnabwendbar eine Folgen totbringender Dinge aus dem Dunkel des Unbekannten, aus Ecken und Nischen emporschnellen muß.
In solchen Sekunden ringt sich stöhnende Angst aus dem rhythmischen Hämmern des Herzens – wortähnlich, wie das gurgelnde, schauerliche Lallen der Taubstummen: Ugg–ger, – Ugg–ger, Ugg–ger.
Wir horchten vergebens – kein Geräusch mehr.
›Es klang wie ein Schrei tief in der Erde‹, flüsterte der Oberst.
Mir schien es, als ob das Steinbild der Kala Bhairab, des Choleradämons, sich bewegte: unter dem zuckenden Lichte der Fackeln schwankten die sechs Arme des Ungeheuers, und die schwarz und weiß bemalten Augen flackerten wie der Blick eines Irrsinnigen.
›Gehen wir ins Freie, zum Tempeleingang‹, schlug Hargave vor, ›es ist ein scheußlicher Ort hier.‹ –
Die Felsenstadt lag im grünen Lichte wie eine steingewordene Beschwörungsformel.
In breiten Streifen durchglitzerte der Mondschein das Meer, einem riesigen, weißglühenden Schwerte gleich, dessen Spitze sich in der Ferne verlor.
Wir legten uns auf die Plattform zur Ruhe – es war windstill und in den Nischen weicher Sand.
Doch es kam kein rechter Schlaf.
Der Mond stieg höher, und die Schatten der Pagoden und steinernen Elefanten schrumpften auf dem weißen Felsboden zu krötenähnlichen phantastischen Flächen zusammen. ›Vor den Raubzügen der Moguln sollen alle diese Götterstatuen von Juwelen gestrotzt haben – Halsketten aus Smaragden, die Augen aus Onix und Opal‹, sagte plötzlich Oberst Stuart halblaut zu mir, ungewiß ob ich schliefe. – Ich gab keine Antwort.
Plötzlich fuhren wir alle entsetzt empor. Ein gräßlicher Schrei drang aus dem Tempel – ein kurzes, dreifaches Aufbrüllen oder Auflachen mit einem Echo wie von zerschellendem Glas und Metall.
Mein Bruder riß ein brennendes Scheit von der Wand, und wir drängten uns auf den Gang hinab in das Dunkel.
Wir waren vier, was war da zu fürchten.
Bald warf Hargrave die Fackel fort, denn der Gang mündete in eine künstliche Schlucht ohne Deckenwölbung, die, von grellem Mondlicht beschienen, in eine Grotte führte.
Feuerschein drang hinter den Säulen hervor, und von den Schatten gedeckt schlichen wir näher.
Flammen loderten von einem niedrigen Opferstein, und in ihrem Lichtkreis bewegte sich taumelnd ein Fakir, behängt mit den grellbunten Fetzen und Knochenketten der bengalischen Dhurgaanbeter.
Er war in einer Beschwörung begriffen und warf unter schluchzendem Winseln den Kopf nach der Art der tanzenden Derwische mit rasender Schnelle nach rechts und links, dann wieder in den Nacken, daß seine weißen Zähne im Lichte blitzten.
Zwei menschliche Körper mit abgeschnittenen Köpfen lagen zu seinen Füßen, und wir erkannten sehr bald an den Kleidungsstücken die Leichen zweier unserer Sepoys. Es mußte ihr Todesschrei gewesen sein, der so gräßlich zu uns emporgeklungen.
Oberst Stuart und der Dolmetsch warfen sich auf den Fakir, wurden aber von ihm im selben Augenblick an die Wand geschleudert.
Die Kraft, die in dieser abgemergelten Asketengestalt wohnte, schien unbegreiflich, und ehe wir noch zuspringen konnten, hatte der Fliehende bereits den Eingang der Grotte gewonnen.
Hinter dem Opferstein fanden wir die abgeschnittenen Köpfe der beiden Mahratten.«
Mr. Hargrave Jennings faltete das Manuskript zusammen: »Es fehlt ein Blatt hier, ich werde Ihnen die Geschichte selber zu Ende erzählen:
Der Ausdruck in den Gesichtern der Toten war unbeschreiblich. Mir stockt noch heute der Herzschlag, wenn ich mir das Grauen zurückrufe, das uns damals alle befiel. Furcht kann man es nicht gut nennen, was sich da in den Zügen der Ermordeten ausdrückte, – ein verzerrtes, irrsinniges Lachen schien es. – Die Lippen, die Nasenflügel emporgezogen, – der Mund weit offen und die Augen, – die Augen, – es war fürchterlich; stellen Sie sich vor, die Augen – hervorgequollen – zeigten weder Iris noch Pupille und leuchteten und funkelten in einem Glanze wie der Stein hier an Miß Hunts Ring.
Und wie wir sie dann untersuchten, zeigte es sich, daß sie wirkliche Opale geworden waren.
Auch die spätere chemische Analyse ergab nichts anderes. Auf welche Weise die Augäpfel hatten zu Opalen werden können, wird mir immer ein Rätsel bleiben. Ein hoher Brahmane, den ich einmal fragte, behauptete, es geschähe durch sogenannte Tantriks (Wortzauber), – und der Prozeß gehe blitzschnell, und zwar vom Gehirn aus vor sich; doch wer vermag das zu glauben! Er setzte damals noch hinzu, daß alle indischen Opale gleichen Ursprungs seien, und daß sie jedem, der sie trüge, Unglück brächten, da sie einzig und allein Opfergaben für die Göttin Dhurga, die Vernichterin alles organischen Lebens, bleiben müßten.«
Die Zuhörer standen unter dem Eindruck der Erzählung und sprachen kein Wort.
Miß Hunt spielte mit dem Ring.
»Glauben Sie, daß Opale wirklich deswegen Unglück bringen, Mr. Jennings?« sagte sie endlich. »Wenn Sie es glauben, bitte, vernichten Sie den Stein!«
Mr. Jennings nahm ein spitzes Eisenstück, das als Briefbeschwerer auf dem Tische lag, und hämmerte leise auf den Opal, bis er in muschelige, schimmernde Splitter zerfiel.
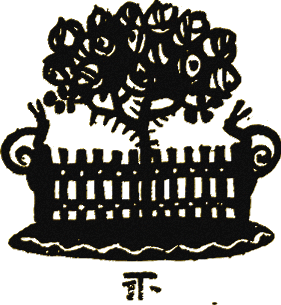

Chlodwig Dohna, ein nervöser Mensch, der ununterbrochen – jawohl ununterbrochen – sozusagen mit angehaltenem Atem achtgeben muß, um nicht jeden Moment sein psychisches Gleichgewicht zu verlieren und eine Beute seiner fremdartigen Gedanken zu werden! – Dohna, der mit der Pünktlichkeit einer Maschine kommt und geht, fast nie spricht und sich mit den Kellnern im Klub, um jedes überflüssige Wort zu meiden, nur durch Zettel verständigt, die seine Anordnungen für die kommende Woche enthalten, der soll krankhaft nervös sein?! –
Das ist ja rein zum Lachen!
»Er muß untersucht werden«, meinten die Herren und beschlossen, um Dohna ein wenig auszuholen, kurzerhand eine Festlichkeit im Klub, der er nicht gut ausweichen konnte.
Sie wußten ganz gut, daß ein besonders höfliches und korrektes Benehmen ihn am leichtesten in eine angeregte Stimmung versetzte, und wirklich ging Dohna früher, als man gehofft hatte, aus sich heraus. –
»Ich möchte so gerne wieder einmal ein Seebad aufsuchen«, sagte er, »wie in früheren Zeiten, wenn ich nur den Anblick der mehr oder weniger nackten Menschen vermeiden könnte. Sehen Sie, noch vor fünf Jahren konnte mich ein menschlicher Körper unter Umständen sogar begeistern, – griechische Statuen waren mir ein Kunstgenuß. – Und jetzt? – Seit mir die Schuppen von den Augen gefallen sind, quält mich ihr Anblick wie physischer Schmerz. – Bei den modernen Skulpturen mit den wirbelnden oder überschlanken Formen geht es noch halbwegs, aber ein nackter lebender Mensch ist und bleibt mir das Grauenhafteste, das sich denken läßt. – Die klassische Schönheit ist eine Schulsuggestion, die sich vererbt wie eine ansteckende Krankheit. – Betrachten Sie doch einmal eine Hand. Ein widerlicher Fleischklumpen mit fünf verschieden langen, scheußlichen Stummeln! Setzen Sie sich ruhig hin, schauen Sie so eine Hand an und werfen Sie alle Erinnerungen fort, die daran hängen, – betrachten Sie sie, kurz gesagt, wie etwas ganz Neues, und Sie werden verstehen, was ich meine. Und gar wenn Sie das Experiment auf die ganze menschliche Gestalt ausdehnen! Da faßt einen das Grausen, ich möchte sagen, die Verzweiflung, – eine nagende Todespein. Man fühlt den Fluch der Vertreibung aus dem Paradies am eigenen Fleische. Ja! – Wirklich schön ist eben nur das, was man sich mit Grenzen nicht vorstellen kann, – etwa der Raum; alles andere, begrenzte, selbst der prächtigste Schmetterlingsflügel, ruft den Eindruck der Verkrüppelung wach. – Die Ränder, die Grenzen der Dinge, werden mich noch zum Selbstmorde treiben; sie machen mich so elend, und es würgt mich, wie sie mir in die Seele schneiden. –
Bei manchen Formen tritt mich dies Leiden weniger quälend an, – wie ich schon sagte: bei den stilisierten Linien der Sezession, aber unerträglich wird es bei den natürlichen, die quasi frei wachsen. – Der Mensch! – Der Mensch! Was peinigt einen so beim nackten Menschen?! Ich kann es nicht ergründen. Fehlen ihm Federn oder Schuppen, oder Lichtausstrahlungen? Ich sehe ihn immer wie ein Gerüst vor mir, um das herum die eigentliche Hülle fehlt – leer wie ein Rahmen ohne Bild. – Doch wohin soll ich die Augen geben, die so gar nicht zu dieser Vorstellung passen und so unbegrenzt scheinen?« –
Chlodwig Dohna hatte sich ganz in dem Thema verloren, sprang endlich auf und ging erregt im Zimmer auf und ab und biß dabei nervös an seinen Nägeln.
»Sie haben sich wohl viel mit Metaphysik oder Physiognomik befaßt?« fragte ein junger Russe, Monsieur Petroff.
»Ich? Mit Physiognomik? – Nein. Brauche es auch gar nicht. Wenn ich bloß die Hosenbeine eines Menschen ansehe, weiß ich alles über ihn und kenne ihn besser als er sich selbst.
Lachen Sie nicht, mein Herr, es ist mein voller Ernst.«
Die Frage mußte Dohna immerhin in seinen sich fortspinnenden Grübeleien unterbrochen haben, – er setzte sich zerstreut nieder und empfahl sich plötzlich steif und förmlich von den Herren, die einander befremdet ansahen, aber nicht sonderlich befriedigt schienen: – es war ihnen zu wenig gewesen.
Am nächsten Tag fand man Dohna tot vor seinem Schreibtische.
Er hatte sich erschossen.
Vor ihm lag ein fußlanger Bergkristall mit spiegelnden Flächen und scharfen Kanten.
Der Verstorbene war vor fünf Jahren ein fröhlicher Mensch gewesen, der von Vergnügen zu Vergnügen eilte und mehr auf Reisen als zu Hause war.
Zu dieser Zeit lernte er in dem Kurorte Levico einen indischen Brahminen Mr. Lala Bulbir Singh kennen, der in seinen Anschauungen große Umwälzungen hervorbrachte.
An den Ufern des regungslosen Caldonazzo-Sees hatten sie oft geweilt, und Dohna hatte mit tiefer Verwunderung die Reden des Inders angehört, der, in allen europäischen Wissenszweigen auf das Gründlichste geschult, dennoch über sie in einer Weise sprach, die erkennen ließ, daß er sie nicht viel höher als Kinderspielzeug achtete.
Kam er auf sein Lieblingsthema: die direkte Erkenntnis der Wahrheit, so ging von seinen Worten, die er stets in einem eigentümlichen Rhythmus aneinander reihte, eine überwältigende Kraft aus, und dann schien es, als ob das Herz der Natur still stände und das unruhige Schilf gespannt dieser uralten heiligen Weisheit lausche.
Aber auch viele seltsame Berichte erzählte er Dohna, die wie Märchen klangen: von der Unsterblichkeit im Körper und dem geheimen profunden Wissen der Sekte Paradâ.
Die ungeheure glühende Oberfläche würde naturgemäß in kurzer Zeit durch Oxydation allen Sauerstoff der Erde aufsaugen und die Menschheit dem Erstickungstode preisgeben.
Lala Bulbir Singh hatte die Kenntnis dieser Vorhersage aus jenen geheimen Manuskripten geschöpft, die in Indien einzig und allein einem Hochgradbrahminen zugänglich sind und für einen solchen jeden Zweifel an Wahrheit ausschließen.
Was aber Dohna besonders überraschte, war die Erzählung, daß ein neuer europäischer Prophet, namens Jan Doleschal, der sich in Prag aufhalte, erstanden sei und die gleiche Kenntnis lediglich aus sich selbst und durch geistige Offenbarungen erhalten habe. –
Wie der Inder steif und fest behauptete, sei Doleschal nach gewissen geheimen Zeichen auf Brust und Stirne die Wiederverkörperung eines Yogi aus dem Stamme der Sikhs, der zur Zeit des Guru Nanak gelebt und jetzt die Mission habe, einen Teil der Menschheit aus dem allgemeinen Untergange zu erretten. –
Er predige, wie vor 3000 Jahren der große Hindulehrer Patanjali, die Methode, durch Anhalten des Atems und gleichzeitige Konzentration der Gedanken auf ein gewisses Nervenzentrum die Tätigkeit der Lungen aufzuheben und das Leben unabhängig von atmosphärischer Luft zu gestalten.
Dohna war sodann in Gesellschaft Lala Bulbir Singhs in die Nähe Prags gereist, um den Propheten in eigener Person kennen zu lernen.
Auf dem Landsitze eines Fürsten fand das Zusammentreffen statt. –
Niemand, der nicht bereits zur Sekte gehörte oder von Gläubigen eingeführt wurde, durfte die Besitzung betreten.
Doleschals Eindruck war noch faszinierender als der des Brahminen, mit dem ihn übrigens eine tiefe Freundschaft verband. –
Der heiße konvergierende Blick seiner schwarzen Augen war unerträglich und drang wie ein glühender Draht ins Gehirn.
Dohna verlor jeden seelischen Halt unter dem überwältigenden Einflusse dieser beiden Männer. –
Er lebte wie im Taumel dahin und hielt mit der kleinen Gemeinde die vorgeschriebenen stundenlangen Gebete. – Halb träumend hörte er die rätselhaften ekstatischen Reden des Propheten, die er nicht verstand, und die dennoch wie Hammerschläge in sein Herz fielen und ein quälendes Dröhnen im ganzen Körper hervorriefen, um ihn bis tief in den Schlaf zu verfolgen. –
Jeden Morgen zog er mit den übrigen auf die Anhöhe des Parkes, wo eine Gruppe Arbeiter unter Leitung des Inders beschäftigt war, ein tempelähnliches achteckiges Gebäude zu vollenden, dessen Seitenteile ganz aus dicken Glastafeln bestanden.
Durch den Boden des Tempels führten mächtige Metallröhren zu einem naheliegenden Maschinenraum. –
Einige Monate später befand sich Dohna schwer nervenleidend in Begleitung eines befreundeten Arztes in einem Fischerdorfe der Normandie als jener sonderbare, sensitive Mensch, dem die Formen der Natur eine ununterbrochene geheimnisvolle Sprache redeten. –
Sein letztes Erlebnis mit dem Propheten hatte ihn fast getötet, und die Erinnerung daran war bis zu seinem Tode nicht mehr von ihm gewichen.
Er war mit Männern und Weibern der Sekte in dem gläsernen Tempel eingeschlossen. –
In der Mitte der Prophet mit unterschlagenen Beinen auf einem roten Postamente. Sein Bild bricht sich in den achteckigen Glaswänden, daß es scheint, als sei er in hundert Verkörperungen zugegen. –
Scheußlicher, stinkender Rauch von verbranntem Bilsenkraut wirbelt aus einer Pfanne und legt sich schwer wie die Hände der Qual auf die Sinne. –
Ein schluchzendes, schlapfendes Geräusch dringt aus dem Boden herauf: sie pumpen die Luft aus dem Tempel. –
Erstickenden Gase fallen zur Decke herein, in der armdicke Schläuche münden: Stickstoff –.
Wie Schlangen des Todes legt sich die schnürende Angst um Hals und Kopf. –
Der Atem wird röchelnd, das Herz hämmert zum Zerspringen.
Die Gläubigen schlagen an die Brust.
Der Prophet sitzt wie aus Stein gehauen, und alle fühlen sich von seinen starren schwarzen Augen verfolgt, die ihnen aus den Ecken drohend entgegenspiegeln. –
Halt, halt! – Um Gottes willen Luft, – Luft! – Ich ersticke. –
Alles dreht sich im Wirbel, der Körper verrenkt sich, die Finger krallen sich in die Kehle. –
Heulende Schmerzen wie der Tod das Fleisch von den Knochen saugt.
Weiber werfen sich zu Boden und winden sich im Krampfe des Erstickens. –
Die dort reißt sich mit blutigen Nägeln die Brust auf. –
In den Spiegeln die schwarzen Augen werden immer mehr und bedecken die Wände.
Begrabene Szenen aus dem Leben treten vor die Seele, und wirre Erinnerungen tanzen: Der Caldonazzo-See rauscht wie die Brandung, – Länderstrecken verdunsten, – der See ist ein Meer aus glühendem Kupfer geworden, und grüne Flammen hüpfen über dem Krater.
Aus der erstickenden Brust donnert der Herzschlag, und Lala Bulbir Singh fliegt als Geier über die Glut.
– – – Dann ist alles zerbrochen, erstickt, geborsten.
Noch ein Aufflackern klaren Bewußtseins: Aus den Ecken spiegelt die statuenhafte Gestalt Doleschals, seine Augen sind tot, und ein grauenhaftes Lächeln liegt wie eine Maske auf seinem Gesicht. –
Risus sardonisus – das Leichengrinsen –, so nannten es die Alten.
Dann schwarze Nacht, ein kalter Windstoß fährt über den Körper. – Eiswogen dringen in die Lungen, und das Schluchzen der Pumpen ist verstummt.
Aus der Ferne klingt die rhythmische Stimme Lala Bulbir Singhs: »Doleschal ist nicht tot, er ist in ›Samadhi‹ – der Verzückung der Propheten! – –«
Das alles hatte Dohnas Innerstes unheilbar erschüttert und die Tore seiner Seele erbrochen. –
Ja, wenn es einen Schwachen trifft, wirft es ihn um. –
Und seine Seele ist wund geblieben.
Die Erde werde ihm leicht.

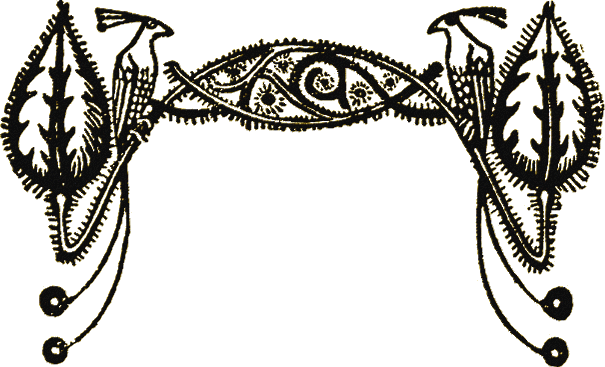
Der Gesellschaftsraum des Sanatoriums war stark besucht, wie immer; – alles saß still und wartete auf die Gesundheit.
Man sprach miteinander nicht, da man vom andern eine Krankheitsgeschichte befürchtete – oder Zweifel an der Behandlungsmethode. –
Es war unsagbar öde und langweilig, und die faden deutschen Sinnsprüche, mit schwarzen Glanzbuchstaben auf weiße Kartons gepappt, wirkten wie ein Brechreiz. – –
An einem Tische, mir gegenüber, saß ein kleiner Junge, den ich beständig ansah, weil ich sonst meinen Kopf in eine noch unbequemere Lage hätte bringen müssen.
Geschmacklos angezogen, sah er unendlich stupid aus mit seiner niedrigen Stirn. – An seinem Sammetärmeln und Hosen hatte die Mutter weiße Spitzenbesätze befestigt. –
Auf uns allen lastete die Zeit, – sog uns aus wie ein Polyp. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn plötzlich diese Menschen wie ein Mann, ohne sogenannte Veranlassung, mit einem Wutgeheul aufgesprungen wären und alles – Tische, Fenster, Lampen – in Raserei zertrümmert hätten.
Warum ich nicht selbst so handelte, war mir eigentlich unverständlich; vermutlich unterließ ich es aus Furcht, daß die anderen nicht gleichzeitig mitmachen würden, und ich hätte mich dann beschämt wieder niedersetzen müssen.
Dann sah ich wieder die weißen Spitzenbesätze und fühlte, daß die Langeweile noch quälender und drückender geworden war; – – ich hatte das Gefühl, als ob ich eine große graue Kautschuk-Kugel in der Mundhöhle hielte, die immer größer wurde und mir ins Gehirn hinein wuchs. – –
In solchen Momenten der Öde ist einem sonderbarerweise auch der Gedanke an irgendeine Veränderung ein Greuel. Der Junge reihte Dominosteine in ihre Schachtel ein und nahm sie dann in fieberhafter Angst wieder heraus, um sie anders zu legen. – Es war nämlich kein Stein mehr übrig, und doch war die Schachtel nicht ganz voll – wie er gehofft –, es fehlte bis zum Rand noch eine ganze Reihe. – – – Er packte seine Mutter endlich heftig am Arm, deutete in wilder Verzweiflung auf diese Asymmetrie und brachte nur die Worte heraus: »Mama, Mama!« – Die Mutter hatte soeben mit einer Nachbarin über Dienstboten und ähnliche ernste Dinge gesprochen, die das Frauenherz bewegen, und blickte nun glanzlos – wie ein Schaukelpferd – auf die Schachtel. –
»Leg die Steine quer«, sagte sie dann.
Im Gesicht des Kindes blitzte ein Hoffnungsstrahl auf, – und von neuem ging es mit lüsterner Langsamkeit an die Arbeit. – –
Wieder verstrich eine Ewigkeit.
Neben mir knisterte ein Zeitungsblatt. – –
Wieder fielen mir die Sinnsprüche in die Augen, – und ich fühlte mich dem Wahnsinn nahe. – –
Jetzt! – – Jetzt – – das Gefühl kam von außen über mich, sprang mir auf den Kopf, wie der Henker.
Ich starrte den Jungen an, – von ihm zog es zu mir herüber. – – Die Schachtel war jetzt voll, aber ein Stein war übrig geblieben!
Der Junge riß die Mutter fast vom Stuhl. – Sie hatte schon wieder von Dienstboten gesprochen und stand auf und sagte: »Wir gehen nun zu Bett, du hast lange genug gespielt.« –
Der Junge gab keinen Laut von sich, er stierte nur mit irren Augen um sich, – – – die wildeste Verzweiflung, die ich je gesehen. –
Ich wand mich in meinem Fauteuil und krampfte die Hände, – es hatte mich angesteckt.
Die beiden gingen hinaus, und ich sah, daß es draußen regnete. – – Wie lange ich noch saß, weiß ich nicht mehr. – Ich träumte von all den trüben Erlebnissen meines Lebens, – sie sahen mit schwarzen Domino-Augen einander an, als ob sie etwas Unheimliches suchten, und ich wollte sie in einen grünen Sarg einreihen, – – aber jedesmal waren ihrer zu viel oder zu wenig. – –


Wenn einer glaubt, daß die geheimen Lehren des Mittelalters mit den Hexenprozessen ausgestorben sind, oder daß sie gar auf bewußter oder unbewußter Täuschung beruhen, – ist er arg im Irrtum.
Niemand hatte das besser begriffen als Amadeus Veverka, der heute im okkulten Orden der Hermetischen Brüderschaft von Luxor unter symbolistischem Gepränge zum »superieur inconnu« erhoben worden war und jetzt nachdenklich – durchschauert von den Lehren des Buches Ambertkend – auf einem behauenen Steinblock am Abhange der »Nusler Stiege« sitzt und schlaftrunken in die blaue Nacht hinausgähnt.
Der junge Mann läßt alle die fremdartigen Bilder im Geiste an sich vorüberziehen, die heute abend vor sein Auge getreten waren – – er hört wie aus weiter Ferne noch die eintönige Stimme des Arch-Zensors Ganesha: »Die erste Figur, über welche man das Wort Hom aussprechen muß, zeiget sich unter einer schwarz und gelb gemischten Farbe, sie ist in dem Hause des Saturn. Wenn unser Geist einzig mit dieser Figur beschäftigt ist, wenn unsere Augen fest auf sie geheftet sind und wir uns selbst den Namen Hom aussprechen, so öffnen sich die Augen des Verstandes, und man erwirbt sich das Geheimnis – – –«
Und die Brüder des Ordens standen umher, das blaue Band um die Stirn geschlungen und die Stäbe mit Rosen bekränzt. – Freie Forscher, die die Tiefen der Gottheit ergründen, mit Masken und weißen Talaren angetan, damit keiner den andern kenne und keiner vom andern wisse. – (Wenn man sich aber auf der Straße begegnet, erkennt man sich am Händedruck.) – Ja, ja – solche Institutionen sind oft unerforschlich und wunderbar.
Amadeus Veverka greift unter seine Weste, ob er das Abzeichen seiner neuen Würde, die goldene Münze mit dem emaillierten Traubenkern, noch habe und schwelgt im Gefühle stolzer Überlegenheit über diese schlafenden Menschen im nächtlichen Häusermeer, die nichts Besseres kennen, als die Mysterien der Magistratserlässe und wie man gut esse und viel trinke.
Er wiederholt sich, an den Fingern zählend, all das, was von jetzt ab streng geheim zu halten sei.
»Wenn das so fortgeht«, flüstert ihm jenes niederträchtige innere Ich zu, das begeisterte deutsche Poeten so schön unter dem Sinnbild des »schwarzen Ritters zur Linken« verhüllen, »so werde ich schließlich noch das Einmaleins geheim halten müssen.«
Selbstverständlich jagte er mit einem energischen Fußtritt diesen Teufel in seine finstere Welt zurück, wie es einem jungen Superieur inconnu geziemt, und wie es die Bruderschaft von ihm erwartet. –
Die letzte Straßenlaterne in seiner Nähe hat man erdrosselt, und über der dunstverhüllten Stadt flimmert nur das schwache Licht der Sterne. – Sie blinzen gelangweilt auf das graue Prag und gedenken trübselig der alten Zeiten, da noch der Wallensteiner von seinem Schlosse auf der Kleinseite grübelnd empor zu ihnen blickte. – Und wie die Alchymisten Kaiser Rudolfs in ihren Schwalbennestern auf der Daliborka nächtlich kochten und murmelten und erschreckt die Feuer löschten, wenn der Mars in Mondesnähe kam. – Die Zeiten des Nachdenkens sind um, und Prag liegt und schnarcht wie ein betrunkenes Marktweib. Ringsum hügeliges Land. – Ernst und geheimnisvoll schweigt das Nusler Tal vor dem träumerischen Geheimjünger, – im fernen Hintergrunde die massigen tiefdunklen Wälder, in deren Lichtungen die Strolche schlafen, die bei der Prager Polizei noch keine Anstellung als Detektive gefunden haben.
Weiße Nebel tanzen auf den nassen Wiesen, – aus tiefer Ferne ruft das verträumte Pfeifen der Lokomotive eine kranke Sehnsucht wach.
Amadeus Veverka denkt und denkt: Wie stand es doch in dem alten Manuskript über die verheißenen Offenbarungen der inneren Natur, das während der zwanglosen Besprechung Bruder Sesostris vorgelesen hatte?:
»Wenn du in den Nachthimmel siehst und willst das Schauen erlangen, so richte deinen Blick auf einen Punkt, den du dir in weiter Ferne denkst, und schiebe ihn immer weiter und weiter von dir weg, bis du fühlst, daß die Achseln deiner Augen sich nicht mehr schneiden. – Dann wirst du mit den Augen der Seele sehen: ernste, traurige und komische Dinge, – wie sie im Buche der Natur aufgezeichnet sind –; Dinge, die keinen Schatten werfen. – Und dein Sehen wird mit dem Denken verschmelzen.«
Der junge Mann sieht hinaus in das wolkenlose Dunkel, bis er seine Augen vergißt. – Geometrische Figuren stehen am Himmel, wachsen und verändern sich, dunkler als die Nacht.
Dann schwinden sie und Geräte erscheinen, wie sie das banale Leben braucht: ein Rechen, eine Gießkanne, Nägel, eine Schaufel. – Und jetzt ein Sessel mit grünem Rips bezogen und mit zerbrochener Lehne.
Veverka quält sich ab, die alte Lehne durch eine neue zu ersetzen. – Vergebens. – Jedesmal, wenn er glaubt, am Ziele zu sein, zerrinnt das Bild und fährt in seine alte Form zurück. – Endlich verschwindet es ganz, die Luft scheint wie Wasser und riesige Fische mit leuchtenden Schuppen und goldenen Punkten schwimmen einher. – Wie sie die purpurnen Flossen bewegen, hört er es im Wasser brausen. – Erschreckt zuckt Amadeus zusammen. Wie ein jäh Erwachender. – Ein eintöniges Singen dringt durch die Nacht. – Er steht auf: Ein paar Leute aus dem Volke. – Slawischer Singsang. Schwermütig nennen es die, die davon erzählen, und es doch nie gehört haben.
Glücklich der Sterbliche, der es nie vernommen. –
Im Westen ragt das Palais des Selchers Schmel.
Wer kennt ihn nicht, den Hochverdienten! Sein Ruhm klingt über die Lande bis an das blaue Meer. – Gotische Fenster schauen stolz hinab ins Tal. –
Die Fische sind verschwunden, und Amadeus Veverka sucht von neuem das Sehfeld in der Unendlichkeit. Ein heller Fleck, kreisrund, der sich mehr und mehr weitet, leuchtet auf. Rosa Gestalten treten in den Brennpunkt, mikroskopisch klein und doch so scharf, wie durch eine Linse gesehen. – Von blendendem Licht beschieden, – und die Körper werfen keinen Schatten.
Ein unabsehbarer Zug marschiert heran, rhythmisch im Takt, – es schüttert die Erde. Schweine sind es – Schweine! Aufrecht gehende Schweine! – Voran die edelsten unter ihnen, die ersten im Zuge der Seelenwanderung, die schon auf Erden die tapfersten waren – und jetzt violette Cereviskappen tragen und Couleurband, damit jeder sehe, in welcher Gestalt sie sich dereinst wiederverkörpern werden.
Es schrillen die Querpfeifen der Spielleute – immer breiter drängen die rosa Gestalten, und in ihrer Mitte wankt ein dunkler, gebückter, menschlicher Schemen, gefesselt an Händen und Füßen. – Es geht zum Richtplatz, – zwei gekreuzte Schinkenknochen bezeichnen die Stätte. Schwere Ketten von Knackwürsten hängen an dem Gefangenen nieder und schleppen ihm nach in dem wirbelnden Staube. – Die Querpfeifen sind verstummt, es steigt der Kantus:
Das ist der Selcher Schmel,
Das ist der Selcher Schmel,
das ist der lederne Selcher Schmel,
sa, sa
Selcher Schmel.
Das ist der Selcher Schmel!
Jetzt haben sie halt gemacht, sammeln sich im Kreise und harren des Urteils. Der Gefangene soll sagen, was er zu seiner Verteidigung vorzubringen hat. Jedes Schwein weiß doch, daß man dem Beschuldigten alle Anklagspunkte zu nennen hat. Genauso wie in einem Offiziers-Ehrenrate. – Ein riesiger Eber mit blutiger Schürze hält die Verteidigungsrede.
Er weist darauf hin, daß der Angeklagte nur im besten Glauben und in flammender Begeisterung für die heimische Industrie zu handeln vermeinte, als er tausende und abertausende der ihrigen dem Magen der Großstadt überlieferte.
Alles umsonst. – Die zu Richtern ernannten Schweine lassen sich durch die Bestimmungen des Gesetzbuches nicht beirren und ziehen erbarmungslos die schon vorbereiteten Urteile aus den Taschen. Wie sie es so oft bei Lebzeiten gesehen haben, und wie es Sitte auf Erden. –
Der Verurteilte hebt flehend die Hände empor und bricht zusammen.
Das Bild erstarrt – verschwindet und kehrt von neuem wieder. – So rollt die Vergeltung ab, bis auch das letzte Schwein gerächt ist.
Amadeus Veverka fährt aus dem Schlummer, er hat sich mit dem Kopf an dem Griff seines Stockes gestoßen, den er in beiden Händen hält. Wieder fallen ihm die Augen zu und wirre Begriffe tanzen in seinem Hirn.
Diesmal wird er sich alles genau merken, damit er es weiß, wenn er erwacht.
Die Melodie will ihm nicht aus dem Kopf:
»Wer kommt dort von der Höh,
Wer kommt dort von der Höh?
Wer kommt dort von der ledernen Höh,
sa, sa
ledernen Höh,
Wer kommt dort von der Höh.«
und dagegen läßt sich nicht ankämpfen.

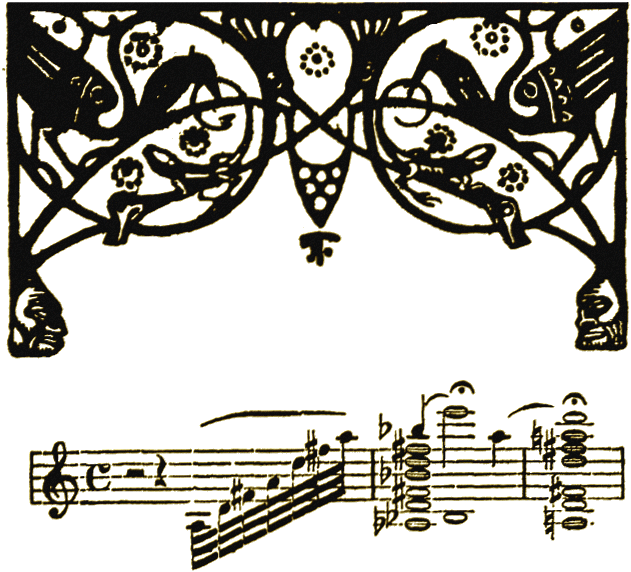
Melanchthon tanzte mit der Fledermaus, die den Kopf unten und oben die Füße hatte.
Die Flügel um den Leib geschlagen und in den Krallenzehen einen großen goldenen Reifen steif emporhaltend, wie um anzudeuten, daß sie von irgendwo herabhänge, sah sie ganz absonderlich aus, und es mußte einen merkwürdigen Eindruck auf Melanchthon machen, wenn er beim Tanzen beständig durch diesen Ring zu sehen gezwungen war, der genau in seine Gesichtshöhe reichte.
Sie war eine der originellsten Masken auf dem Feste des persischen Prinzen, – auch eine der scheußlichsten allerdings – diese Fledermaus. –
Sogar seiner Durchlaucht Mohammed Darasche-Koh, dem Gastgeber, war sie aufgefallen.
»Schöne Maske, ich kenne dich«, hatte er ihr zugeflüstert und damit große Heiterkeit bei den Nebenstehenden erregt.
»Es ist bestimmt die kleine Marquise, die intime Freundin der Fürstin«, meinte ein holländischer Ratsherr, gekleidet im Stile Rembrandts – es könne gar nicht anders sein; jeden Winkel wisse sie im Schlosse, – ihren Reden nach – und vorhin, als mehreren Kavalieren der »frostige« Einfall gekommen, sich von dem alten Kammerdiener Filzstiefel und Fackeln bringen zu lassen, um draußen im Parke Schneeballen zu werfen, wobei die Fledermaus ausgelassen mitgetollt hatte –, hätte er wetten mögen, ein ihm wohlbekanntes Hyazintharmband an ihrem Handgelenk aufblitzen gesehen zu haben.
»Ach, wie interessant«, mischte sich ein blauer Schmetterling ins Gespräch, – »könnte da nicht Melanchthon vorsichtig ein wenig sondieren, ob Graf de Faast, wie es in letzter Zeit den Anschein hat, bei der Fürstin wirklich Hahn im Korbe ist?«
»Ich warne dich, Maske, sprich nicht so laut«, unterbrach ernst der holländische Ratsherr. »Nur gut, daß die Musik den Walzerschluß fortissimo spielte, – vor wenigen Augenblicken noch stand der Prinz hier ganz in der Nähe!«
»Ja, ja, am besten kein Wort über solche Dinge«, riet flüsternd ein ägyptischer Anubis, »die Eifersucht dieses Asiaten kennt keine Grenzen; und es liegt vielleicht mehr Zündstoff im Schlosse aufgehäuft, als wir alle ahnen. – Graf de Faast spielt schon zu lange mit dem Feuer, und wenn Darasche-Koh wüßte – – –«
Eine rauhe, zottige Figur, ein geschlungenes Knäuel aus Seil darstellend, bahnte sich – in wilder Flucht vor einem hellenischen Krieger in schimmerndem Waffenschmuck – eine Gasse durch die Gruppe der Masken, die den beiden verständnislos nachsahen, wie sie auf flinken Gummisohlen über den spiegelglatten Steinboden huschten.
»Hättest du keine Angst, durchgehauen zu werden, Mynher Kannitverstahn, wenn du der gordische Knoten wärest und wüßtest, daß Alexander der Große hinter dir her ist?« spottete die umgekehrte Fledermaus und tippte mit dem Fächer auf des Holländers ernsthafte Nase.
»Ei, ei, ei, schöne Marquise Fledermaus, der scharfe Geist verrät sich stets«, scherzte ein baumlanger »Junker Hans« mit Schweif und Pferdefuß. »Wie schade, ach wie schade, daß man dich – Füßchen oben – nur als Fledermaus so auf dem Kopfe stehen sehen darf.«
Jemand stieß ein brüllendes Gelächter aus.
Alle drehten sich um und sahen einen dicken Alten mit breiten Hosen und einem Ochsenkopf.
»Ah, der pensionierte Herr Handelsgerichtsvizepräsident hat gelacht«, sagte trocken der Junker Hans.
Da ertönt dumpfes Läuten, und ein Henker im roten Talar der westfälischen Feme, eine erzene Glocke schwingend, stellt sich inmitten des ungeheuern Saales auf – über sein blitzendes Beil gelehnt.
Aus den Nischen und Loggien strömen die Masken herbei: Harlekins, »Ladies with the rose«, Menschenfresser, Ibisse und gestiefelte Kater, Piquefünfe, Chinesinnen, deutsche Dichter mit der Aufschrift: »Nur ein Viertelstündchen«, Don Quixotes und Wallensteinische Reiter, Kolumbinen, Bajadèren und Dominos in allen Farben.
Der rote Henker verteilt Täfelchen aus Elfenbein mit Goldschrift unter die Menge.
»Ah, Programme für die Vorstellung!!«
»Der Mann in der Flasche«
Marionetten-Komödie im Geiste Aubrey Beardsleys
von Prinz Mohammed Darasche-Koh
Personen:
Der Mann in der Flasche – Miguel Graf de Faast
Der Mann auf der Flasche – Prinz Mohammed Darasche-Koh
Die Dame in der Sänfte –
* * * *
Vampyre, Marionetten, Buckelige, Affen, Musikanten
Ort der Handlung:
Ein offener Tiger-Rachen
»Was?! Vom Prinzen selbst das Puppenspiel?«
»Vermutlich eine Szene aus 1001 Nacht?«
»Wer wird denn die Dame in der Sänfte geben?« hört man neugierige Stimmen durcheinander fragen.
»Unerhörte Überraschungen stehen uns heute noch bevor, o ja«, zwitschert ein niedlicher Incroyable in Hermelin und hängt sich in einen Abbé ein, – »weißt du, der Pierrot vorhin, mit dem ich die Tarantella tanzte, das war der Graf de Faast, der den Mann in der Flasche spielen wird, und er hat mir viel anvertraut: – Die Marionetten werden schrecklich unheimlich sein, aber nur für die, die es verstehen, weißt du – und einen – – – – Elefanten hat der Prinz eigens aus Hamburg telegraphisch bestellt – – – aber du hörst mir ja gar nicht zu!« – Und ärgerlich läßt die Kleine den Arm ihres Begleiters los und läuft davon.
Durch die weiten Flügeltüren fluten immer neue Scharen von Masken aus den Nebengemächern in die Festeshalle, sammeln sich planlos in der Mitte, laufen durcheinander wie das ewig wechselnde Farbenspiel eines Kaleidoskopes, oder drücken sich an den Wänden zusammen, die wundervollen Fresken Ghirlandajos zu bestaunen, die bis zur blauen, sternenbesäten Decke emporsteigend gleich Märchengeländen den Saal umrahmen.
Wie eine buntschillernde Insel des Lebens liegt die Halle, umspült von den Gefilden farbengebundener Phantasien, die, einst in froh pochenden Künstlerherzen erwacht, eine jetzt kaum mehr verständlich einfache und langsame Sprache den hastenden Seelen des Heute zuraunen.
Diener reichen Erfrischungen auf Silbertassen in das fröhliche Gewoge, – Sorbet und Wein. – – Sessel werden gebracht und in die Fensternischen gestellt.
Mit scharrendem Geräusch schieben sich die Wände der einen Schmalseite zurück, und langsam rollt eine Bühne aus dem Dunkel vor, mit rotbraun und gelb geflammter Umrahmung und weißen Zänhen oben und unten: ein stilisierter, gähnender Tigerrachen.
In der Mitte der Szene steht eine riesige kugelförmige Flasche. Aus fußdickem Glas. Fast zwei Mann hoch und sehr geräumig. Die kolossalen Ebenholztüren des Saales fliegen auf, und mit majestätischer Ruhe tritt ein Elefant – gold- und juwelengeschmückt – herein. Auf seinem Nacken der rote Henker lenkt ihn mit dem Stiel seines Beiles.
Von den Spitzen der Stoßzähne schwingen Ketten von Amethysten, nicken Wedel aus Pfauenfedern.
Goldgewirkte Decken hängen dem Tiger in rosinfarbenen Quasten über die Flanken bis auf den Boden herab.
Die ungeheure Stirne hinter einem Netz mit funkelnden Edelsteinen, schreitet der Elefant gelassen durch den Festraum.
In Zügen umdrängen ihn die Masken und jauchzen der bunten Schar vornehmer Darsteller zu, die in einem Palankin auf seinem Rücken sitzen: Prinz Darasche-Koh mit Turban und Reiheragraffe. – Graf de Faast als Pierrot daneben. – Marionetten und Musikanten lehnen starr und steif wie Holzpuppen.
Der Elefant ist bei der Bühne angelangt und hebt mit dem Rüssel Mann um Mann aus dem Palankin; – Händeklatschen und lauter Jubel, als er den Pierrot nimmt und in den Hals der Flasche hinabgleiten läßt, dann den Metalldeckel schließt und den Prinzen obendrauf setzt.
Die Musikanten haben sich im Halbkreis niedergelassen und ziehen seltsame, dünne, gespenstisch aussehende Instrumente hervor.
Ernsthaft sieht der Elefant ihnen zu, dann kehrt er langsam um und schreitet zum Eingang zurück. Toll und ausgelassen wie Kinder hängen sich ihm scharenweise die Masken an Rüssel, Ohren und Stoßzähne und wollen ihn jauchzend zurückhalten; – – er spürt ihr Zerren kaum.
Die Vorstellung beginnt. Irgendwoher, wie aus dem Boden herauf, tönt leise Musik. –
Puppenorchester und Marionetten bleiben leblos wie aus Wachs.
Der Flötenbläser stiert mit gläsernem, blödsinnigen Ausdruck zur Decke; – die Züge der Rokokodirigentin in Perücke und Federhut, den Taktstock wie lauschend erhoben und den spitzen Finger geheimnisvoll an die Lippen gelegt, sind in grauenhaft lüsternem Lächeln verzerrt.
Im Vordergrund der Bühne die Marionetten – ein buckliger Zwerg mit kalkweißem Gesicht, ein grauer grinsender Teufel und eine fahle geschminkte Sängerin mit roten lechzenden Lippen – scheinen in satanischer Bosheit um ein schreckliches Geheimnis zu wissen, das sie in brünstigem Krampfe erstarren ließ.
Das haarsträubende Entsetzen des Scheintodes brütet über der regungslosen Gruppe.
– – Nur der Pierrot in der Flasche ist in ruheloser Bewegung, – schwenkt seinen spitzen Filzhut, verbeugt sich, und mitunter grüßt er hinauf zu dem persischen Prinzen, der mit gekreuzten Beinen unbeweglich auf dem Deckel der Flasche sitzt, – dann wieder schneidert er tolle Grimassen.
Seine Luftsprünge bringen die Zuschauer zum Lachen, – – – – wie grotesk er aussieht!
Die dicken Glaswände verzerren seinen Anblick so seltsam; – manchmal hat er Glotzaugen, die hervorquellen und so wunderlich funkeln, dann wieder gar keine Augen, nur Stirne und Kinn, – oder ein dreifaches Gesicht; – zuweilen ist er dick und gedunsen, dann wieder skelettartig dürr und langbeinig wie eine Spinne. – Oder sein Bauch schwillt zur Kugel an.
Jeder sieht ihn anders, nachdem der Blick auf die Flasche fällt.
In gewissen kurzen Zeiträumen ohne jeden erkennbaren, logischen Zusammenhang kommt ruckweise ein spukhaftes, sekundenlanges Leben in die Gestalten, das gleich darauf wieder in die alte, grauenvolle Leichenstarre versinkt, daß es scheint, als hüpfe das Bild über tote Zwischenräume hinweg von einem Eindruck zum andern, – wie der Zeiger einer Turmuhr traumhaft von Minute zu Minute zuckt.
Einmal hatten die Figuren aus schnellenden Kniekehlen heraus drei gespenstische Tanzschritte seitwärts der Flasche zugemacht; – und im Hintergrund verrenkte sich ein verwachsenes Kind wie in lasterhafter Qual. –
Von den Musikanten einer – ein Baschkir mit irrem, wimpernlosem Blick und birnenförmigem Schädel – nickte dazu und spreizte mit einem Ausdruck schreckhafter Verworfenheit seine dürren, gräßlichen Finger, die trommelschlägerartig in kugelförmige Enden ausliefen, wie wächserne Symbole einer geheimnisvollen Entartung.
Dann wieder war an die Sängerin ein phantastisches weibliches Zwitterwesen herangesprungen – mit langen, schlotternden Spitzenhöschen – und in tänzelnder Stellung erstarrt.
Wie erfrischendes Aufatmen wirkte es förmlich, als mitten in eine solche Pause der Regungslosigkeit durch die rosaseidenen Vorhänge aus dem Hintergrunde eine verschlossene Sänfte aus Sandelholz von zwei Mohren auf die Szene getragen und in die Nähe der Flasche niedergestellt wurde, auf die jetzt von oben plötzlich ein fahles, mondscheinartiges Licht fiel.
Die Zuschauer waren sozusagen in zwei Lager geteilt, die einen – unfähig sich zu rühren und sprachlos – ganz im Banne dieser traumhaft vampyrartigen, rätselhaften Marionettentänze, von denen ein dämonisches Fluidum vergifteter, unerklärlicher Wollust ausströmte, – während die andere Gruppe, zu plump für derlei seelische Schrecken, nicht aus dem Lachen über das spaßige Gebaren des Mannes in der Flasche herauskam.
Dieser hatte zwar die lustigen Tänze aufgegeben, aber sein jetziges Benehmen kam ihnen nicht minder komisch vor.
Durch alle möglichen Mittel trachtete er offenbar, irgend etwas ihm äußerst dringend Scheinendes dem auf dem Flaschendeckel sitzenden Prinzen verständlich zu machen.
Ja, er schlug und sprang zuletzt gegen die Wandungen, als wolle er sie zerbrechen oder gar die Flasche umwerfen.
Dabei hatte es den Anschien, als schreie er laut, obwohl natürlich nicht das leiseste Geräusch durch das fußdicke Glas drang.
Die pantomimischen Gebärden und Verrenkungen des Pierrots beantwortete der Perser von Zeit zu Zeit mit einem Lächeln, – oder er wies mit dem Finger auf die Sänfte.
Die Neugier des Publikums erreichte den Höhepunkt, als man bei einer solchen Gelegenheit deutlich bemerkte, daß der Pierrot sein Gesicht längere Zeit fest an das Glas drückte, wie um etwas drüben am Sänftenfenster zu erkennen, dann aber plötzlich wie ein Wahnsinniger die Hände vor den Kopf schlug, als hätte er etwas Gräßliches erblickt, auf die Knie fiel und sich die Haare raufte. – Dann sprang er auf und raste mit solcher Schnelle in der Flasche herum, daß man bei den spiegelnden Verzerrungen manchmal nur noch ein helles, umherflatterndes Tuch zu sehen vermeinte.
Groß war auch das Kopfzerbrechen im Publikum, was es denn eigentlich mit der »Dame in der Sänfte« für eine Bewandtnis habe; man konnte wohl wahrnehmen, daß ein weißes Gesicht an die Sänftenscheibe gepreßt war und unbeweglich zur Flasche hinübersah, – alles andere aber verdeckte der Schatten, und man war auf bloßes Raten angewiesen.
»Was nur der Sinn dieses unheimlichen Puppenspieles sein mag?« flüsterte der blaue Domino und schmiegte sich ängstlich an den Junker Hans.
Erregt und mit gedämpfter Stimme tauschte man seine Meinungen aus.
Einen so recht eigentlichen Sinn habe das Stück nicht, – – nur Dinge, die nichts Gehirnliches bedeuten, könnten den verborgenen Zutritt zur Seele finden, – meinte ein Feuersalamander, und so, wie es Menschen gäbe, die beim Anblick der wässerigen Absonderungen blutleerer Leichen, von erotischem Taumel geschüttelt, kraftlose Schreie der Verzückung ausstießen, so gäbe es gewiß auch – – – –
»Kurz und gut: Wollust und Entsetzen wachsen auf einem Holz«, unterbrach die Fledermaus, »aber glaubt mir, ich zittere am ganzen Körper vor Aufregung, es liegt etwas unsagbar Grauenhaftes in der Luft, das ich nicht abschütteln kann; immer wieder legt es sich um mich wie dicke Tücher. – Geht das von dem Puppenspiel aus? – Ich sage nein; auf mich strömt es vom Prinzen Darasche-Koh über. Warum sitzt er so scheinbar teilnahmslos da oben auf der Flasche? Und doch läuft manchmal ein Zucken über sein Gesicht!! – – – Irgend etwas Unheimliches geht hier vor, ich lasse mir's nicht nehmen.«
»Eine gewisse symbolistische Bedeutung glaube ich doch herausgefunden zu haben, und dazu paßt ganz gut, was du eben sagtest«, mischte sich Melanchthon in das Gespräch.
»Ist denn nicht der ›Mann in der Flasche‹ der Ausdruck der im Menschen eingeschlossenen Seele, die ohnmächtig zusehen muß, wie die Sinne – die Marionetten – sich frech ergötzen, und wie alles der unaufhaltsamen Verwesung im Laster entgegengeht?«
Lautes Gelächter und Händeklatschen schnitt ihm die Rede ab.
Der Pierrot hatte sich auf dem Boden der Flasche zusammengekrümmt und umkrallte mit den Fingern seinen Hals. – Dann wieder riß er den Mund weit auf, deutete in wilder Verzweiflung auf seine Brust und nach oben – und faltete schließlich flehend die Hände, als wolle er etwas vom Publikum erbitten.
»Er will zu trinken haben, – na ja, so eine große Flasche und kein Sekt drin – gebt ihm doch zu trinken, ihr Marionetten«, rief ein Zuschauer.
Alles lachte und klatschte Beifall.
Da sprang der Pierrot wieder auf, riß sich die weißen Kleider von der Brust, machte eine taumelnde Bewegung und fiel der Länge nach zu Boden.
»Bravo, bravo, Pierrot – großartig gespielt; da capo, da capo«, jubelte die Menge.
Als jedoch der Mann sich nicht mehr rührte und keine Miene machte, die Szene zu wiederholen, legte sich langsam der Applaus und die allgemeine Aufmerksamkeit wandte sich den Marionetten zu.
Diese standen noch immer in derselben geisterhaften Stellung, die sie zuletzt eingenommen hatten, doch lag jetzt eine Art Spannung in ihren Mienen, die früher nicht wahrzunehmen gewesen. Es schien, als ob sie auf irgend ein Stichwort warteten.
Der bucklige Zwerg mit dem kalkweißen Gesicht drehte schließlich vorsichtig seine Augen nach dem Prinzen Darasche-Koh. –
Der Perser rührte sich nicht.
Seine Züge sahen verfallen aus.
Endilch trat von den Figuren im Hintergrund einer der Mohren zögernd an die Sänfte heran und öffnete den Schlag.
Und da geschah etwas höchst Seltsames.
Steif fiel ein nackter weiblicher Körper heraus und schlug mit dumpfem Klatschen lang hin.
Einen Augenblick Totenstille, dann schrien tausend Stimmen durcheinander; – – – es brauste der Saal.
»Was ist's – was ist geschehen?«
Marionetten, Affen, Musikanten, – alles sprang zu; Masken schwangen sich auf die Bühne:
Die Fürstin, die Gemahlin Darasche-Koh lag da, ganz nackt; auf ein stählernes Stangengerüst geschnürt. Die Stellen, wo die Stricke in das Fleisch einschnitten, waren blau unterlaufen.
Im Munde stak ihr ein seidener Knebel. –
Unbeschreibliches Entsetzen lähmte alle Arme.
– »Der Pierrot!« gellte plötzlich eine Stimme, – »der Pierrot!« – Eine wahnsinnige, unbestimmte Angst fuhr wie ein Dolchstoß in alle Herzen.
– »Wo ist der Prinz?«
Der Perser war während des Tumults spurlos verschwunden. –
Schon stand Melanchthon auf den Schultern des Junker Hans; vergebens, – – er konnte den Deckel der Flasche nicht heben, und das kleine Luftventil war – – – – – zugeschraubt! –
»So schlagt doch die Wandungen ein, schnell, schnell!«
Der holländische Ratsherr entriß dem roten Henker das Beil, mit einem Satz sprang er auf die Bühne.
Es klang wie eine geborstene Glocke, als die Schläge schmetternd niederfielen; – ein schauerlicher Ton.
Tiefe Sprünge zuckten durch das Glas wie weiße Blitze; die Schneide der Axt bog sich.
Endlich – endlich – – – die Flasche brach in Trümmer. Darinnen lag, erstickt, die Leiche des Grafen de Faast, die Finger in die Brust gekrallt.
Durch die Festeshalle mit lautlosem Flügelschlag unsichtbar zogen die schwarzen Riesenvögel des Entsetzens.
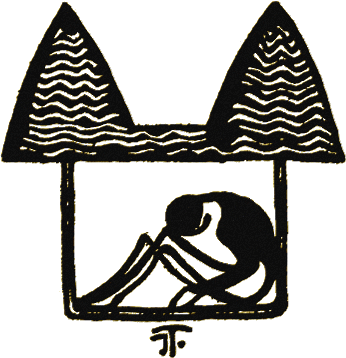

Hamilkar Baldrian, der einsame Sonderling, saß vor seinem Fenster und blickte durch die Scheiben in die herbstliche Dämmerung.
Am Himmel standen dunkelgeballt graublaue Wolken, die langsam ihre Umrisse veränderten, wie das Schattenspiel einer Riesenhand, die sich irgendwo in unsichtbarer Ferne träg bewegte.
Über dem frostigen Dunst der Erde ein blindes trauriges Abendrot.
Dann sanken die Wolken, lagerten schwer im Westen und durch den Nebel spähten die Sterne mit glitzernden Augen. Grübelnd erhob sich Baldrian und schritt auf und ab. Eine schwere Sache das – mit der Geisterbeschwörung! Aber hatte er nicht alles streng befolgt, was das große Grimoire des Honorius vorschrieb?! – Gefastet, gewacht, sich gesalbt und täglich das Seufzerlein der hl. Veronika hergesagt?
Nein, nein – es muß gelingen, der Mensch ist auf Erden das Höchste und die Kraft der Hölle ihm untertan. –
Er ging wieder zum Fenster und wartete lange, bis die Hörner des Mondes, gelb und trüb, sich über die erstarrten Äste der Ulmen schoben.
Dann zündete er vor Aufregung zitternd seinen alten Leuchter an und holte allerhand seltsame Dinge aus Schrank und Truhe: Zauberkreise, grünes Wachs, einen Stock mit Krone, trockene Kräuter. Knüpfte alles in ein Bündel, stellte es sorgfältig auf den Tisch und begann, ein Gebet murmelnd, sich langsam auszuziehen, bis er ganz nackt war.
Der flackernde Leuchter warf hämische Reflexe auf den verfallenen Greisenkörper mit der welken, gelblichen Haut, die ölig glänzend sich über den spitzen Knien, Lenden- und Schulterknochen spannte. Der kahle Schädel nickte über der eingesunkenen Brust und sein kugelförmiger, grausiger Schatten fuhr an der kalkweißen Wand unschlüssig umher, als ob er etwas suchen wolle in qualvoller Ungewißheit. Fröstelnd ging der Alte zum Ofen, hob einen glasierten tönerne Topf herab und löste die raschelnde Hülle, die ihn verschloß; – eine fettige, übelriechende Masse war darin. Heute gerade vor einem Jahr hatte er sie zusammengeschmolzen: – Mandragorawurzel, Bilsenkraut, Wachs und Spermazeti und – und –, er schüttelte sich vor Ekel, – eine zu Brei verkochte Kinderleiche; – die Totenfrau hatte sie ihm verkauft.
Zögernd grub er seine Finger in das Fett, schmierte es sich auf den Leib, verrieb es in den Kniekehlen und Achselhöhlen, dann wischte er seine Hände auf der Brust ab und zog ein altes vergilbtes Hemd an: das »Erbhemd«, das man zum Zaubern braucht, – und seine Kleider darüber. – Die Stunde war da!
Ein Stoßgebet. Und das Bündel mit den Geräten her. Nur nichts vergessen, sonst hat der Böse die Macht, den Schatz noch im letzten Augenblick zu verwandeln, wenn Tageslicht darauf fällt. – – Oh, solche Fälle sind schon dagewesen!
Halt, die Kupferplatte, Kohlenbecken – und Zunder zum Anglimmen!
Mit unsichern Schritten tappt Baldrian die Treppe hinab.
Das Haus war in früheren Zeiten ein Kloster gewesen, jetzt wohnte er ganz allein darin, und das Waschweib aus der Nachbarschaft brachte ihm tagsüber, was er brauchte.
Kreischen und Dröhnen einer schweren eisernen Türe und ein verfallener Raum öffnete sich. –
Kellergeruch und dicke Spinnweben überall, Schutt in den Ecken und Scherben schimmeliger Blumentöpfe.
Ein paar Hände voll Erde in die Mitte des Raumes getragen – – – – – so! (denn die Füße des Exorzisten müssen auf Erde stehen) – eine alte Kiste zum Sitzen, den Pergamentkreis ausgearbeitet. Mit dem Namen Tetragrammaton nach Norden; sonst kann das größte Unglück geschehen. Jetzt den Zunder und die Kohlen angezündet!
Was war das?
Das Pfeifen von Ratten – nichts sonst.
Kräuter und die Glut: Ginster, Nachtschatten, Stechapfel. – Wie das prasselt und qualmt.
Der Alte löscht die Laterne aus, beugt sich über die Pfanne und atmet den giftigen Rauch ein; er kann sich kaum aufrecht halten, so betäubt es ihn.
Und das schreckliche Sausen in den Ohren!
Mit dem schwarzen Stock berührt er die Wachshäufchen, die auf der Kupferplatte langsam zerschmelzen, und murmelt mit letzter Kraft und stockender Stimme die Beschwörungsformeln des Grimoires:
»– – – rechte Himmelsbrot und Speise der Engel – – – – Schrecken der Teufel bist – – – – ob ich gleich voll sündigen Unflats – – – – diese reißenden Wölfe und stinkenden Höllenböcke zu bezwingen gewürdiget werde – – – – – Harnisch – – – – zaudert ihr länger vergebens – – – – – – – Aimaymon Astaroth – – – – – diesen Schatz nicht mehr länger zu verwehren – – – – – Astaroth – – – – – beschwöre – – – – – Eheye – – – Eschereheye.«
Er muß sich niedersetzen, Todesangst befällt ihn; – die drosselnde unbestimmte Furcht dringt durch den Boden und die Mauerritzen, senkt sich von der Decke herab: das grauenhafte Entsetzen, das das Nahesein der haßerfüllten Bewohner der Finsternis verkündet!
Es pfeifen die Ratten. Nein, nein – – nicht Ratten – – ein gellendes Pfeifen, das den Kopf zersprengt.
Das Sausen!
Es ist das Blut in den Adern. Das Sausen – – – – – – von Flügeln. Die Kohlen verglimmen.
Da, ha: – – Schatten an der Wand. Der Alte stiert mit gläsernen Augen hin. – – – Moderflecke sind es und abgeschuppter Bewurf.
– – – – Sie bewegen sich, sie bewegen sich – – – –: ein Knochenschädel mit Zähnen. – – Hörnern! – – und leere, schwarze Augenhöhlen. Skelettarme schieben sich langsam geräuschlos nach, ein Ungeheuer wächst aus der Wand – in hockender Stellung, und erfüllt das Gewölbe. Das Gerippe einer riesigen Kröte mit dem Schädel eines Stieres. Die gebleichten Knochen heben sich fast grell aus der Dunkelheit ab. – – – Der höllische Astaroth!
Der Alte hat sich aus dem Zauberkreis in einen Winkel geflüchtet und preßt sich bebend an die kalte Mauer, er kann das rettende Bannwort nicht sagen, die schwarzen, gräßlichen Augenhöhlen verfolgen ihn und starren auf seinen Mund. Sie haben ihm die Zunge gelähmt, – er kann nur mehr röcheln in furchtbarer Angst. –
Langsam, stetig kriecht das Gespenst auf ihn zu – – (er glaubt das Schlürfen der Rippen auf den Steinen zu hören) – – und hebt tastend die Krötenhand nach ihm. – – – – An den Knochenfingern klirren silberne Ringe mit glanzlosen verstaubten Topasen, vermoderte Schwimmhäute verbinden lose die Glieder und strömen einen entsetzlichen Geruch aus nach verwestem Fleisch.
Jetzt – – faßt es ihn an. – – Eisige Kälte steigt ihm ins Herz. – – Er will – will – –, da schwinden ihm die Sinne, und er fällt vornüber aufs Gesicht.
Die Kohlen sind erloschen, narkotischer Rauch hängt in der Luft und ballt sich längs der Decke. Durch das vergitterte, winzige Kellerfenster wirft das Mondlicht gelbe schräge Strahlen in den Winkel, wo der Alte bewußtlos liegt.
Baldrian träumt, daß er fliege. Sturmwind peitscht ihm den Leib. Ein schwarzer Bock rast vor ihm durch die Luft, er fühlt die zottigen Läufe dicht vor seinen Augen, und die tollen Hufe schlagen ihm fast ins Gesicht.
Unter ihm die Erde, – weit, weit. Dann fällt er, wie durch einen schwarzsamtenen Trichter, immer tiefer und schwebt über einer Landschaft. Er kennt sie gut: Dort der moosbewachsene Grabstein, – auf dem Erdbuckel der kahle Ahorn mit den entblätterten Ästen, die sich wie fleischlose Arme zum Himmel krampfen. Herbstlicher Reif auf dem nächtlichen Sumpfgras.
Das Moorwasser steht seicht im Boden und schimmert durch den Nebel wie ein großes erblindetes Auge.
Sind das nicht Gestalten in dunklen Hüllen, die dort im Schatten des Grabsteines sich sammeln mit blitzenden Waffen und metallfunkelnden Köpfen und Spangen?! Sie lagern sich im Halbkreis zu einer gespenstischen Beratung. Des Alten Seele durchzuckt ein Gedanke: Der Schatz! Die Schemen der Toten sind's, die einen vergrabenen Schatz hüten! Und sein Herz stockt vor Habgier.
Er späht hinab von seiner Höhle, – immer näher rückt die Erde, jetzt klammert er sich an den Zweigen des Ahorns an, leise – leise. –
Da. – Ein dürrer Ast biegt sich und ächzt. – Die Toten schauen zu ihm empor. – – – Er kann sich nicht mehr halten und fällt – fällt mitten unter sie.
Sein Kopf schlägt hart auf den Grabstein.
Er erwacht und sieht die Moderflecke an der Wand. Keuchend taumelt er zur Türe, die Treppe hinauf mit brechenden Knien.
Er wirft sich auf das Bett, – – seine zahnlosen Kiefer schlottern vor Furcht und Kälte.
Die rote filzige Decke legt sich um ihn, raubt ihm den Atem, bedeckt ihm Mund und Augen. Er will sich umdrehen und kann nicht, auf seiner Brust hockt ein wolliges scheußliches Tier: die Fledermaus des Fieberschlafs, mit riesigen purpurnen Flügeln, und hält ihn mit ihrer Last unwiderstehlich in die dumpfig-schmutzigen Polster gepreßt.
Den ganzen Winter lag der Greis an den Folgen dieser Nacht danieder. Langsam ging es mit ihm zu Ende.
Er sah von seiner Lagerstätte zu dem kleinen Fenster hinüber, wenn die Schneeflocken im Sturm vorbeiflogen und ungeduldige Tänze aufführten, oder empor zur weißen Zimmerdecke, auf der ein paar Fliegen ihre planlosen Wanderungen hielten.
Und wenn von dem alten Kachelofen her es gar so gut nach verbrannten Wacholderbeeren roch, (»Kreche, Kreche« – ach wie er husten mußte) da malte er sich aus, wie er im Frühjahr draußen beim Heidegrab den Schatz heben werde, von dem er geträumt, und fürchtete nur, daß sich das Geld vielleicht doch verwandeln könne, denn so ganz in Ordnung war die Beschwörung des Astaroth ja nicht gewesen.
Einen genauen Plan hatte er auf einem abgerissenen Buchdeckel gezeichnet: den einsamen Ahornbaum, den kleinen Moorweiher und hier + den Schatz, – ganz in der Nähe des verwitterten Grabsteines, den jedes Kind kennt.
Der Buchdeckel lag auf dem Bürgermeisteramt und Hamilkar Baldrian auf dem Friedhof draußen.
»Einen Millionenschatz hat der Alte entdeckt, er war nur zu schwer gewesen, daß er ihn hätte ausgraben können«, lief das Gerücht durch das Städtchen und man beneidete seinen Neffen, den Erben, einen Schriftsteller.
Die Grabungen begannen, die Stelle war im Plane so deutlich bezeichnet.
Einige Spatenstiche nur – – – da – – da: Hurra, hurra, hurra! eine eiserne, rostbedeckte Kassette!
In Triumph wurde sie auf die Amtsstube getragen. Berichte gingen in die Hauptstadt, der Erbe sei von dem Funde zu verständigen, eine Kommission an Ort und Stelle zu entsenden usw. – usw.
Der kleine Bahnhof wimmelte von Menschen, Beamten in Uniform, Reportern, Detektiven, Amateurphotographen, ja, sogar der Herr Landesmuseumsdirektor war angekommen, um den interessanten Fleck Erde zu besichtigen.
Alles zog hinaus auf die Heide und glotzte stundenlang in das frisch gegrabene Loch, vor dem der Flurschütz Wache hielt.
Das saftige Moorgras war zertreten von den vielen gekerbten Gummischuhen, aber die hellgrünen Weihersträucher in ihrem jugendfrischen Frühlingsschmuck blinzelten einander mit den seidenen Weidenkätzchen listig zu, und wenn ein Windstoß kam, krümmten sie sich in plötzlich ausbrechendem stummen Gelächter, daß ihre Häupter die Wasserfläche berührten. Warum wohl?
Auch die Krötenkönigin, die dicke mit der rotgetupften Weste, die in ihrer Veranda aus Ranunculus und Pfeilkraut die süße Maienluft genoß und doch sonst immer so würdevoll tat, weil sie 100,003 Jahre alt war, hatte heute wahre Anfälle von Lachkrämpfen. Sie riß das Maul auf, daß ihre Augen ganz verschwanden und schlenkerte wie besessen die linke Hand in die Luft. Fast wäre ihr dabei ein silberner Topasring vom Finger gefallen.
Unterdessen war von der Kommission die gefundene Kassette geöffnet worden.
Ein fauler Geruch entströmte ihr, so daß im ersten Augenblick alles zurückprallte. Seltsamer Inhalt!
Eine elastische Masse, schwarz und gelb, zäh und von glänzender Oberfläche. –
Es wurde hin und her geraten und der Kopf geschüttelt.
»Ein alchemistisches Präparat – offenbar«, sagte endlich der Herr Landesmuseumsdirektor.
»Alchemistisch, – alchemistisch«, lief es von Mund zu Mund.
»Alchemistisch? Wie schreibt man das? – Mit zwei L?« drängte sich ein Zeitungsmensch vor.
»Nebbich, ä Düngermittel«, murmelte ein anderer vor sich hin.
Die Kassette wurde wieder verschlossen und an das wissenschaftliche Institut für Chemie und Physik mit dem Ersuchen um ein allgemein verständliches Gutachten gesandt. Alle weiteren Nachgrabungen in der Moorheide blieben erfolglos. Auch die verwitterte Grabschrift auf dem Stein gab keinen Aufschluß: Willi Oberkneifer + + + Leutnant i. R.? Darunter eingemeißelt zwei gekreuzte Fußtritte, die sich wahrscheinlich auf irgend ein verschleiertes Ereignis im Leben des Verblichenen bezogen?
Offenbar war der Mann den Heldentod gestorben.
Die geringen Mittel des erbenden Schriftstellers waren durch die Kosten gefährlich zusammengeschmolzen, und den Rest gab ihm das wissenschaftliche Gutachten, daß nach drei Monaten eintraf:
Zuerst einige Seiten hindurch die unternommenen vergeblichen Versuche angeführt, dann die Eigenschaften der rätselhaften Materie aufgezählt und zum Schluß das Resultat, daß die Masse in keiner Hinsicht in die Zahl der bisher bekannten Stoffe eingereiht werden könne.
Also wertlos! – Die Kassette keinen Heller wert!
Am selben Abend noch setzte der Herbergswirt den armen Schriftsteller vor die Tür. – – Die Schatzaffäre schien abgetan.
Doch noch eine ganz kleine Aufregung sollte dem Städtchen blühen.
Am nächsten Morgen rannte der Dichter ohne Hut mit wallenden Locken durch die Straßen zum Magistrat.
»Ich weiß es«, schrie er immerfort, »ich weiß es.«
Man umringte ihn. »Was wissen Sie?«
»Ich habe heute auf dem Moor übernachtet«, keuchte der Dichter atemlos, – »übernachtet – uch – da ist mir ein Geist erschienen und hat mir gesagt, was es ist. – Früher – uch – sind dort draußen so viele ehrenrätliche Versammlungen abgehalten worden – uch – und da – uch – – –«
»Zum Teufel, was ist's also mit der Materie?« rief einer.
Der Dichter fuhr fort:
»– spezifisches Gewicht 23, glänzende Außenseite, zweifarbig, in allen kleinsten Teilen gebrochen und dabei zusammenklebend wie Pech, – ungemein dehnbar, penetranter – – –«
Die Menge wurde ungeduldig. Aber das stand ja doch schon in der wissenschaftlichen Analyse!
»Also, der Geist sagte mir, es sein ein fossiles koaguliertes Offiziersehrenwort! – und ich habe gleich an ein Bankhaus geschrieben, um dieses Kuriosum zu Geld zu machen.«
Da schwiegen sie, griffen ihn und sahen, daß er irre redete. Wer weiß, ob der Ärmste nicht mit der Zeit wieder vernünftig geworden wäre, als aber die Antwort auf seinen Brief kam:
»Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, quästionierten Artikel weder lombardieren noch per komptant akquirieren zu können, da wir kein Wertobjekt in demselben, auch wenn er nicht fossil und koaguliert wäre, – zu erblicken vermögen. Wollen Sie sich immerhin an ein Haus zur Verwertung von Abfallstoffen wenden.
Hochachtend
Bankhaus A. B. C. Wucherstein Nachfolger.«
Da schnitt er sich die Kehle durch. –
Jetzt ruht er neben seinem Onkel Hamilkar Baldrian.
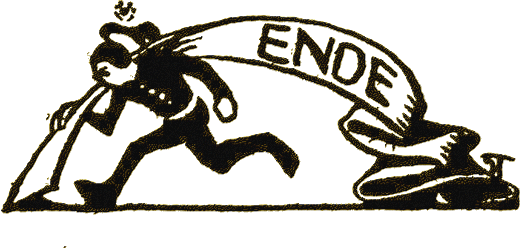
Roy Glashan's Library
Non sibi sed omnibus
Go to Home Page
This work is out of copyright in countries with a copyright
period of 70 years or less, after the year of the author's death.
If it is under copyright in your country of residence,
do not download or redistribute this file.
Original content added by RGL (e.g., introductions, notes,
RGL covers) is proprietary and protected by copyright.